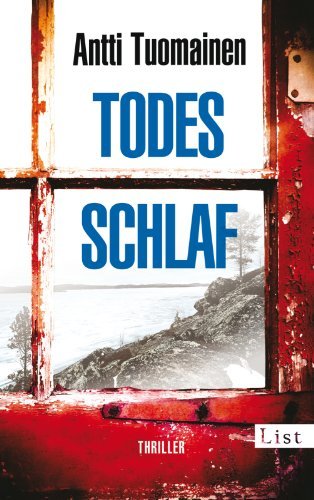Es war einmal ein Entenpfuhl
Eine Beerdigung führt den namenlosen Ich-Erzähler in den Ort seiner Kindheit nach Sussex zurück. Vermeintlich ziellos kurvt er nach dem Gottesdienst durch die Gegend, um eine leere Stunde totzuschlagen, doch etwas in ihm navigiert ihn zum »alten Haus«, wo er vom fünften bis zum zwölften Lebensjahr mit Eltern und Schwester gelebt hatte, weiter zum später errichteten »neuen Haus« der Familie, dann treibt es den Mann wie von selbst ein Stück hinaus aus der Stadt zum nächsten Ziel.
Glücklich scheint der etwa Vierzigjährige nicht, eher zur Melancholie neigend. Seine Ehefrau hat ihn schon vor zehn Jahren verlassen, die erwachsenen Kinder führen ihr eigenes Leben. Eine neue Beziehung einzugehen, dazu fühlt er sich nicht in der Lage. Er macht Kunst, die die »Leerräume« in seinem Leben füllt.
Er war auch »kein glückliches Kind« – und das ist noch euphemistisch formuliert. Was könnte trauriger sein als die Feier zu seinem siebten Geburtstag? Alles ist vorbereitet: Wackelpudding, Kuchen mit Kerzen, Partyspiele, Papphütchen, ein großer Tisch und fünfzehn Klappstühle. Doch alle bleiben leer, denn niemand ist der Einladung des introvertierten Kindes gefolgt. Am Abend schenkt ihm der Vater ein Kätzchen. »Fluffy«, neugierig und anhänglich, bringt ein kleines Glück, das nach kurzer Zeit durch eine Welle neuen Unheils weggespült wird. Ein Taxi überrollt das Tierchen. Dem Fahrzeug entsteigt der neue Untermieter, ein Opalschürfer aus Südafrika. Für ihn muss der Knabe sein Zimmer räumen und bei der zänkischen Schwester einziehen. Eines Tages klaut der Logiegast Vaters Mini aus der Hauseinfahrt und fährt bis zum »Ende der Straße«, wo er die Abgase ins Innere leitet und sich umbringt. Aber an diesem Tag und Ort lernt der Junge die wenige Jahre ältere Lettie kennen.
Das Mädchen nimmt ihn mit zur Hempstock-Farm, dem ältesten Hof der Gegend, der sogar im Domesday Book von William the Conqueror aufgeführt ist. Während er dort warmen Haferbrei mit selbstgemachter Brombeermarmelade löffelt, fühlt er sich geborgen. Allerdings verwundert ihn, dass die beiden Frauen, die aus den Stallungen kommen, des Selbstmörders letzte Gedanken und seinen Abschiedsbrief bereits kennen.
Die Autofahrt über einen holprigen Pfad, gesäumt von Brombeergestrüpp, Haselnusssträuchern und wilden Hecken, wird zur Zeitreise zurück zu jenem Gehöft. Die beiden hellsichtigen Damen damals waren Mrs. Ginnie Hempstock und ihre Mutter »Gramma« Hempstock, die den »Urknall« erlebt hatte und sich noch daran erinnern kann, »wie der Mond erschaffen wurde«. Wie in dieser skurrilen, männerlosen Frauen-Welt Letties Herkunft biologisch zu erklären sei, bleibt eins der vielen Geheimnisse, die dem Erzähler wieder einfallen, während er sich dem roten Backsteingebäude »in seiner ganzen verfallenen Pracht« nähert.
Kaum steht er im Flur, fühlt sich der Erzähler wieder wie der Siebenjährige von damals. Aus der stämmigen, kräftig zupackenden Mrs. Ginnie Hempstock ist jetzt eine ebenso dürre und zierliche Person geworden, wie es einst ihre Mutter war. Dann zieht es ihn hinaus in den Hof, am Hühnerstall und der alten Scheune vorbei zu einem kleinen Pfuhl mit Entengrütze und Lilienblättern, den Lettie einen »Ozean« genannt hatte. All dies fällt dem Erzähler wieder ein, als er auf der uralten Holzbank mit der abgeblätterten grünen Farbe Platz nimmt, in den Tümpel schaut und nachsinnt, wo Lettie damals hingegangen ist: »Irgendwo weit weg.«
Mit dem besinnlichen Blick in den Ententeich endet der Prolog und beginnt viele Seiten später der Epilog, der mit der Abreise des Erzählers endet. Zwischen den beiden Brückenköpfen in unserer ›normalen‹ Welt erstrecken sich fünfzehn Kapitel voller teils amüsanter, teils hintergründiger, teils rätselhafter, teils realistischer, teils mysteriöser, meist aber düsterer Episoden aus der Kindheit der beiden Protagonisten.
Das war nicht Ort noch Zeit der Idylle. Das Böse ist immer und überall. Als Mutter einen Teilzeitjob in einer Apotheke annimmt, wird die Haushälterin Ursula Monkton eingestellt. Sie macht sich an Vater ran und kontrolliert, erpresst und bedroht das verängstigte Kind als innere Stimme: »Ich war in dir. [...] Wenn du irgendjemandem irgendetwas erzählst, [...] werde ich davon erfahren.« Der Junge spürt, dass diese Frau die Familie zu sprengen vermag, leidet unter der Abwesenheit der Mutter und muss erkennen, dass sein Vater gewalttätig sein kann.
Zwar findet der Knabe Trost und wärmenden Schutz bei Lettie. Doch muss er mit ihr ein Abenteuer überstehen, das albtraumhafte Schrecken birgt. Die Bedrohung durch das Monster Ursula nimmt überhand, die Frau verwandelt sich in ein Wesen aus Stoffstreifen, das den Jungen auf dem Dachboden einsperren, sein Herz herausreißen will. Fast wie die Moiren der griechischen Mythologie vermögen ihn die Hempstock-Girls mit vereinten mystischen Kräften zu retten: »Gramma« kann durch »Schnippeln und Stopfen« seines Bademantels die Zeitläufte abwandeln, und Lettie hat Macht über die »Hungervögel«. Indem sie den Ozean in ihren Wassereimer schüttet, ist er transportabel, und der Junge kann hineinsteigen, bis die Meereswellen über ihm zusammenschlagen. Das Wasser dringt in ihn ein, das Universum breitet sich aus, und er begreift, wie die Welt beschaffen ist ...
So richtig klar ist mir auch in der Rückschau nicht, wohin der Zug eigentlich gehen soll: Steckt ein philosophisches, existentialistisches oder tiefenpsychologisches Konzept hinter diesem Roman, oder will der Autor mit einem Cocktail aus Surrealismus und Symbolik, Magie und Poesie, Urmutter-Mythologie und Harry-Potter-Mätzchen einfach nur unsere Imagination kitzeln? Hinter den bunten Andeutungen bleiben alle Fragen offen. Die Fantasie des Lesers ist allemal gefragter als seine Kombinationsgabe.
Was hat es mit den Hempstock-Frauen auf sich? Ihre Heimat liegt »jenseits des Ozeans«, und sie haben alles schon »die ganze Zeit gewusst«. Was hat es mit Letties winzigem Tümpel, der ein Ozean sein soll, auf sich? Ist er ein Schwarzes Loch, Frau Holles Brunnenschacht, Alices Kaninchenbau, Platform Nine and Three Quarters oder gar der Styx? Einmal zieht unser junger Erzähler einen endlos langen Wurm aus seinem Fuß, doch ein kleines Stück bleibt stecken – als Portal für ein Wesen, das sein Leben bedrohen wird.
Neil Gaimans Roman »The Ocean at the End of the Lane«  wird bisweilen auch als Jugendbuch empfohlen. Weil es so schön romantisch-märchenhaft von Kindern, Glück, Opferbereitschaft und dem Sieg des Guten über das Böse erzählt? Auch eher rational veranlagte Jugendliche könnten den immer irrealer werdenden Handlungsverlauf und das schwammige Konzept dahinter unbefriedigend und die Schwarz-Weiß-Illustrationen (nur in der deutschen Ausgabe hinzugefügt?) etwas zu plakativ finden.
wird bisweilen auch als Jugendbuch empfohlen. Weil es so schön romantisch-märchenhaft von Kindern, Glück, Opferbereitschaft und dem Sieg des Guten über das Böse erzählt? Auch eher rational veranlagte Jugendliche könnten den immer irrealer werdenden Handlungsverlauf und das schwammige Konzept dahinter unbefriedigend und die Schwarz-Weiß-Illustrationen (nur in der deutschen Ausgabe hinzugefügt?) etwas zu plakativ finden.
Auf der vorderen Umschlagseite prangt verkaufsfördernd Daniel Kehlmanns Kompliment »Ein poetisches Juwel, wie man es nicht oft zu lesen bekommt«. Gerade diesen Eindruck hatte ich nicht. Die Seiten dieses Romans sind zwar voll mit den einschlägigen Vokabeln, aber sie zünden nicht. Das Sprachgewebe ist nicht evokativ, es stellt sich kein Zauber ein. Das mag an der etwas hölzernen Übersetzung von Hannes Riffel liegen, die eng an Syntax und Stil des Englischen bleibt, anstatt einen eigenen Fluss zu erschaffen; aber auch das Original (von dem ich jedoch nur einige Passagen im Internet erhaschen konnte) hat wohl nicht die expressive Kraft anderer Bücher dieses Genres.
 · Herkunft:
· Herkunft: