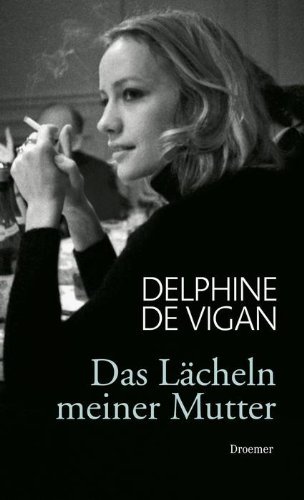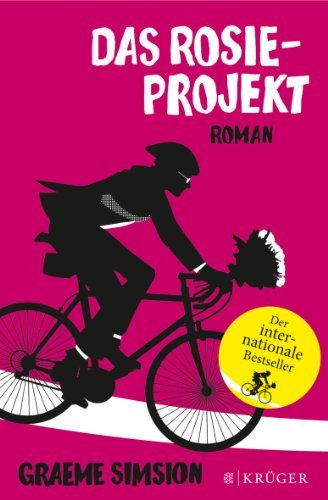
Die ganz Normalen und die anderen Normalen
Warum finden Frauen diesen Mann bloß unattraktiv? Donald Tillman sieht gut aus, er ist 39, durchtrainiert, intelligent und als Assistenzprofessor im Fachgebiet Genetik in gehobener Position mit überdurchschnittlichem Einkommen. Trotz all dem hat Don ein »Partnerin-Problem«. Schon Freundschaften zu schließen fällt ihm schwer. Was für ein persönlicher Mangel auch immer dahintersteckt: »hinsichtlich romantischer Beziehungen« wirkt er sich besonders nachhaltig aus.
Zu Kollege Gene und seiner Frau Claudia, einer klinischen Psychologin, unterhielt Don eine lockere Beziehung, die ihm vollkommen genügte. Sie führten »zahlreiche interessante Gespräche« im Institut, dann folgten Einladungen nach Hause zum Essen und »weitere Rituale der Annäherung«. Damit hatte Don jetzt insgesamt zwei Freunde. Deren Versuch, sein »Ehefrauenproblem« durch das eine oder andere date zu lösen, hat Don freilich schnell beendet: reine Zeitverschwendung, beruhte es doch »auf dem traditionellen Verabredungsparadigma«, dessen »Erfolgswahrscheinlichkeit in keinem Verhältnis zu Aufwand und negativen Erfahrungen stand«.
Dons Alltag ist im Minutentakt durchorganisiert. Verzögerungen in Folge von Unpünktlichkeit oder Unvorhersehbarem muss er durch weitere Optimierung aufholen. Rigide Ordnung beherrscht auch seine Wohnung. Die Speisekammer ist nach einer Standardmenüfolge für jeden Tag der Woche eingeräumt. (Jeden Mittwoch kocht er »Hummer-Mango-Avocado-Salat mit Fliegenfischkaviar in Wasabi, kross geröstetem Seegras und frittierter Lauchgarnierung«.) Sein gesamtes Leben ist zeit- und kosteneffizient optimiert. Bilder an der Wand? Das kann man kostengünstiger haben, wenn man eine Galerie besucht.
Spätestens jetzt ist ein unvorbereiteter Leser befremdet über diesen außergewöhnlichen Menschen, der in mancher Hinsicht anders tickt als Normalsterbliche: Don ist Autist mit Asperger-Syndrom, und Graeme Simsion lässt seinen Protagonisten in freiweg seiner sperrigen Ich-Form erzählen.
Menschen wie er sind insbesondere in ihren sozialen Interaktionen beeinträchtigt. Sie empfinden weder eigene Gefühle noch können sie die der anderen wahrnehmen oder einschätzen. Damit leben sie gewissermaßen hermetisch; sie genügen sich selber, leben in starren Rhythmen, und jegliche Veränderung bringt sie in innere Aufruhr. Schon Berührungen ihres Körpers sind ihnen unangenehm. Viele von ihnen sind überdurchschnittlich intelligent und naturwissenschaftlich begabt.
Don ist sich seiner neurologischen Besonderheit selbst nicht bewusst. Als er in Vertretung für Gene einen Vortrag über das Asperger-Syndrom halten soll und über die Symptome recherchiert, hält er sie für »Variationen der menschlichen Hirnfunktionen«, deren Einstufung als »medizinisch auffällig« ihm nicht einleuchtet: Sie wichen lediglich von gesellschaftlichen Normen ab, die ihrerseits nicht absolut, sondern »kulturell bedingt« seien (»die gängigsten menschlichen Konfigurationen«).
Auch seine eigenen sozialen Interaktionen analysiert er auf einer statistischen, quantifizierenden Basis. Er protokolliert sehr genau, wie andere sein Verhalten wahrnehmen, zergliedert ihre Sicht auf ihn und bemüht sich, erkannten Normen zu entsprechen (»Ich merkte mir einige zwischenmenschliche Verhaltenstechniken für den möglichen späteren Gebrauch.«). Dies gelingt jedoch nicht immer; es verbleiben für ihn unergründliche Spielräume (»Ich war nicht sicher, wie ich ein normales menschliches Wesen imitieren sollte.«). Am Schluss der Romanhandlung fasst er seine Erkenntnisse über sich, etwa einen »Mangel an Empathie«, als »Symptome des Autismus-Spektrums« nüchtern zusammen: »Ich war anders konfiguriert.«
Auf seine wissenschaftliche Weise geht er auch das »Partnerin-Problem« rational und zielorientiert an. Schon im Vorfeld muss herausgefiltert werden, wer nicht in sein Anforderungsraster passt; Ausschlusskriterien sind etwa Unpünktlichkeit, Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum. Er entwickelt einen Fragebogen, der alle relevanten Daten erfasst, und am Ende würde er, als handle es sich um eine Winterreifentest, die ideale Ehefrau finden.
Indes purzelt durch einen Zufall die denkbar inkompatibelste Person in Dons Alltag. Rosie ist einfach »verkorkst«. Sie hat rot gefärbte Haare, kann nicht kochen, raucht, jobbt in einer Schwulenbar, lebt in einer anderen »Zeitzone« (der der Verspätungen) und wirbelt sein aufgeräumtes Leben gründlich durcheinander. Aber sie zeigt Don auch, wie schön und weit die Welt sein kann. Als sie erstmals den »phantastischen Ausblick« von Dons Appartement genießt, gerät sie ins Schwärmen; er selbst hatte den damals beim Kauf »einmal begutachtet«, das genügte.
»The Rosie Project«  (übersetzt von Annette Hahn) ist die zarte Liebesgeschichte zweier maximal ungleicher Menschen. Der Handlungsverlauf ist einfach und vorhersehbar, unerwartete Spannungselemente bleiben aus. Die Sprache ist schlicht, aber der Duktus kann sich stellenweise querstellen, wenn der Autor seinem Ich-Erzähler freies Spiel lässt.
(übersetzt von Annette Hahn) ist die zarte Liebesgeschichte zweier maximal ungleicher Menschen. Der Handlungsverlauf ist einfach und vorhersehbar, unerwartete Spannungselemente bleiben aus. Die Sprache ist schlicht, aber der Duktus kann sich stellenweise querstellen, wenn der Autor seinem Ich-Erzähler freies Spiel lässt.
So passen alle Elemente der Gestaltung perfekt zum Wesen des Protagonisten. Was zunächst spröde, absonderlich (oder – in Rosies Fall – chaotisch) anmutet, wird in zahlreichen kleinen Episoden verständlicher, vertrauter, liebenswert. Der Autor blamiert seine Figur nicht, sondern porträtiert sie auch in peinlichen Situationen behutsam und einfühlsam: »Abendgarderobe« schrieb die Einladung zum Akademikerball vor, und so erscheint Assistenzprofessor Tillman in Frack und Zylinder. Als ihm die entstandene Verlegenheit bewusst wird, löst er sie ganz non-chalant auf, indem er mit großer Geste und Verbeugung den Hut lüpft; so gewinnt er die Herzen aller Anwesenden.
Umgekehrt eröffnet die Erzählperspektive auch uns neue Einblicke in die Welt der ganz Normalen. Was Don beobachtet, vermutet und schlussfolgert, verfremdet unsere gewohnte Sicht auf uns selbst, wie wir sie als selbstverständlich hinnehmen. Dabei erfährt manches Phänomen, in Dons ungewöhnlichen Farben vermittelt, eine verdiente Ernüchterung. Dieser Eindruck entsteht zum Beispiel (ob intendiert oder nicht) bei der Figur Genes. Der führt mit seiner Frau Claudia eine offene Paarbeziehung. Kaschiert mit dem Mäntelchen wissenschaftlicher Experimentalforschung (Fachbereich »Sexualität und Genetik«) schläft er mit jeder Menge Frauen verschiedener Nationalitäten.
»Das Rosie-Projekt« ist ein leiser Roman, der mit Empathie für Menschen, die »anders« sind, und auch zwischen den Zeilen gelesen werden will.
 · Herkunft:
· Herkunft: