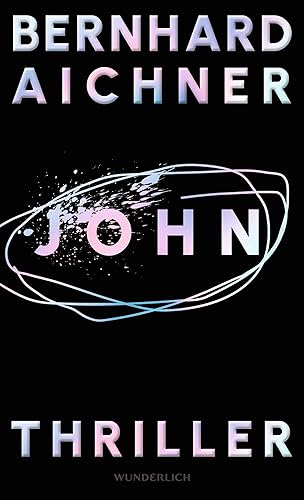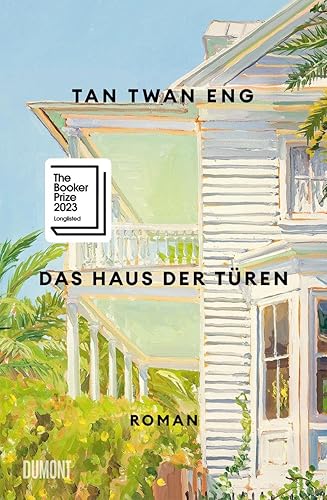Tiefer Winter
von Samuel W. Gailey
Eine ermordete Frau, neben ihrem brutal zugerichteten Körper kniet der verachtete Außenseiter der Kleinstadt. Für den starken Mann im Ort, den Deputy Sheriff Mike Sokowski, liegt der Fall klar, und zu viele seiner Mitbürger lassen sich durch seine Rigorosität mitreißen, um Rache zu üben. Samuel W. Gaileys Debütroman ist ein düsteres, beklemmendes Werk über die Kraft von Vorurteilen, über Verrohung und Gewalt und die Trägheit moralischer Gewissheiten.
Ein Roman wie ein eiskalter Atemhauch im Nacken
Kompakter geht’s kaum. Der Plot von »Deep Winter« umfasst nur eine einzige kalte Winternacht im Jahr 1984 und verrinnt überdies im Fluge, so mitreißend spannend erzählt der amerikanische Autor Samuel W. Gailey die Handlung seines Debütromans. In den USA schon 2014 erschienen, wurde das Buch erst jetzt für den Polar Verlag von Andrea Stumpf ins Deutsche übersetzt. Dabei ist es kein Kriminalroman nach üblichem Schema. Um das Verbrechen und den Täter wird kein Geheimnis gemacht. Stattdessen folgen wir gebannt, wie das Klima einer Kleinstadtgesellschaft von Vorurteilen, Verrohung und dumpfer Gewaltbereitschaft vergiftet und Mitgefühl durch Verachtung und Hass verdrängt werden. Aufgewühlt von einem Mord und aufgestachelt zu einer Art Blutrausch, haben die Menschen Handlungen und Ereignisse zu verantworten, deren Brutalität und Skrupellosigkeit sich bis zu einem kaum vorstellbaren Kulminationspunkt steigern. So markiert das Verbrechen den Tiefpunkt eines latenten, lange gärenden sozialen Zerfalls und gerät zum Auslöser einer beispiellosen Eskalation.
Wyalusing (»Heimat des ehrenhaften Kriegers« in der Sprache des indigenen Tehotitachsae-Volkes) ist eine trostlose Kleinstadt im Nordosten Pennsylvanias. Hier wurde der Autor geboren, und hier verortet er sein Anti-Idyll. Fast alle Einwohner sind hier geboren und groß geworden, es sind weiße, ungebildete, kulturlose Hinterwäldler, hochgerüstet mit legalen Waffen, jeder kennt jeden mit all seinen Sorgen und Problemen in einem Alltag, der durch Tristesse, Alkoholismus und innerfamiliäre Gewalt gezeichnet ist. Die Erzählperspektive wechselt von Kapitel zu Kapitel, nicht aber das Weltbild, das sich in simplen Kategorien verfestigt hat: Wer anders ist, ist gefährlich. Wer schwach ist, ist verdächtig. Und wer sich nicht wehren kann, ist schuldig.
Im Zentrum der Handlung steht Danny Bedford – ein tragischer Antiheld, ein »sanfter Riese« mit der emotionalen Naivität eines Kindes und der körperlichen Präsenz eines Mannes, den man lieber nicht falsch einschätzen möchte. Der merkwürdige Einzelgänger, der den Stimmen in seinem Kopf folgt, wird zur Projektionsfläche für das moralische Versagen seiner Umwelt. Als Kind brach er ins Eis ein, versank für einige Minuten darunter, überlebte das Trauma des Sauerstoffmangels, blieb aber geistig beeinträchtigt. Beim Versuch, ihn zu retten, starben seine Eltern. Sein Onkel Brett nahm ihn bei sich auf, konnte ihm aber weder Liebe schenken noch Kritikfähigkeit vermitteln. Dafür entluden sich seine Frustrationen über seine Fäuste, schon gleich unter Alkoholeinfluss.
Die meisten Menschen im Ort nehmen Danny nicht für voll. In der Schule wird er gemobbt. Allein die auf den Tag gleichaltrige Mindy Knoll, die in der Schule eine Bankreihe hinter ihm sitzt, ist geradlinig und resolut genug, ihn vor seinen Mitschülern zu beschützen, unter denen sich Mike Sokowski und Carl Robinson mit besonders gemeinen Aktionen hervortun.
Auch die Eheleute Bennett sind Danny wohlgesonnen. Nach dem Tod des Onkels bieten sie dem inzwischen erwachsenen jungen Mann an, die Einzimmerwohnung über ihrem Waschsalon zu beziehen. Statt Miete zu zahlen, macht er sich nützlich, wo er kann, kümmert sich um die Maschinen, putzt, schließt morgens den Salon auf und abends ab.
Der harte Kern der Ereignisse nimmt am vierzigsten Geburtstag von Danny und Mindy seinen Lauf. Den ganzen Tag schnitzt Danny an einem kleinen hölzernen Rotkehlchen, das er nach getaner Arbeit seiner immer freundlichen, einfühlsamen Jugendfreundin als Geschenk vorbeibringen will. Am frühen Abend stapft er durch den tiefverschneiten Wald zu dem Trailer, in dem sie wohnt. Dort findet er ihren unbekleideten, brutal zugerichteten, blutüberströmten, leblosen Körper – und verliert jegliche Fassung. Er fällt nieder, redet auf sie ein, tröstet sie, macht ihr Mut, hofft, dass sein Geburtstagsgeschenk ihr gefällt. Und so verzweifelt finden ihn Mike Sokowski, mittlerweile zum Deputy avanciert, und sein ständiger Begleiter Carl Robinson vor.
Von Anbeginn ist jedem Leser klar, wie die Dinge stehen. Selbst Danny konnte Mindys Mörder sehen, wie er den Trailer verließ. Doch er ist wehrlos gegen die Kräfte, die gegen ihn wirken. Denn in der gegebenen augenscheinlichen Konstellation soll der Mord an Mindy ausgerechnet diesem harmlosen Mitmenschen angehängt werden. Um dieses fadenscheinige, abstruse Lügenkonstrukt in die Welt zu setzen und in den Köpfen zu festigen, bedarf es geschickter Überzeugungstaktik, und die gelingt dem Gesetzeshüter mit Bravour. Schließlich bricht eine Horde manipulierter Fanatiker auf zur Jagd, und die eskaliert zu einer kaum mehr zu beherrschenden Spirale blutrünstiger Rachsucht.
Mike Sokowski ist ein widerwärtiges Ekelpaket, cholerisch, unkontrolliert, aggressiv, ständig gewaltbereit, obszön. Frauen gegenüber kennt er keinerlei Respekt und keine Hemmungen. Er nimmt sie sich, wie es ihm beliebt, und behandelt sie wie Dreck. In Carl Robinson (»nicht mehr Verstand als eine Schmeißfliege«) hat er einen willigen Gefolgsmann, ein schattenhaftes Anhängsel, das ihm bedingungslos gehorcht. Obwohl Mike ihn je nach Laune und Alkoholspiegel demütigt, lässt Carl nicht nach, ergeben nach Anerkennung zu suchen. Nicht nur für die beiden ist es äußerst befriedigend, dass es im Kaff jemanden gibt, der als Fußabtreter und Sündenbock für die eigenen Misserfolge im Leben herhalten kann.
In vielerlei Hinsicht steht Samuel W. Gaileys Roman in geläufigen Traditionen der amerikanischen Literatur. Wie die soziale Lage in abgehängten Regionen des Kontinents wie dem Rust Belt oder den öden Weiten des mittleren Westens ist, wie Einzelne und ganze Gemeinschaften daran verzweifeln und verrohen können, haben viele Schriftsteller beschrieben (und dabei auch manches Klischee verfestigt).
»Tiefer Winter« geht noch einen Schritt weiter. Es ist keine einfache Lektüre – und will es auch nicht sein. Der Roman ist durchzogen von sprachlicher Härte, von drastischen Szenen körperlicher wie seelischer Zerstörung, von einem moralischen Vakuum, das sich in Teilen des amerikanischen Hinterlands mit erschütternder Konsequenz manifestiert. Gailey schildert keine Gesellschaft am Rande des Abgrunds – er zeigt eine, die längst hineingefallen ist, ohne noch ein Gespür dafür zu haben.
Was diesen Roman allerdings über das Genre des Noir hinaushebt, ist seine Fähigkeit zur Empathie. Trotz aller Brutalität gibt es in »Tiefer Winter« auch noch zarte, flüchtige Augenblicke der Menschlichkeit. Sie scheinen auf wie das fahle Licht eines entfernten Sterns im Schneegestöber und können niemanden retten, aber das Grauen erträglicher machen. Zusätzliche Tiefe verleiht dem Text, dass der Autor autobiografische Erfahrungen verarbeitet. Er schreibt nicht von außen über eine Welt, die er konstruiert, aber nicht kennt, sondern spricht aus ihr heraus, als einer, der selbst verwundet wurde. Vergleiche mit Steinbeck oder McCarthy mögen hoch gegriffen sein, doch Gaileys Gespür für soziale Mechanismen, seine präzise Beobachtungsgabe und seine lakonische Sprache rechtfertigen den Ruf, den er in der amerikanischen Literaturszene genießt. Trotz der durchweg bitteren Handlung entlässt uns der Autor überraschenderweise nicht mit einer Apokalypse, sondern mit einem geradezu harmonischen Schlussbild des Schauplatzes, das Hoffnung auf eine bessere Zukunft lässt. Bedarf es etwa erst eines Blutbades, um manche Menschen zur Besinnung zu bringen?
 · Herkunft:
· Herkunft: