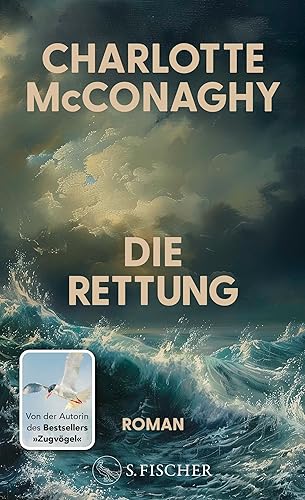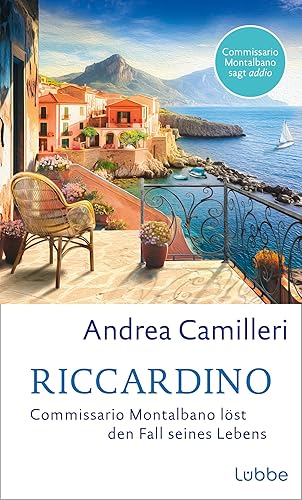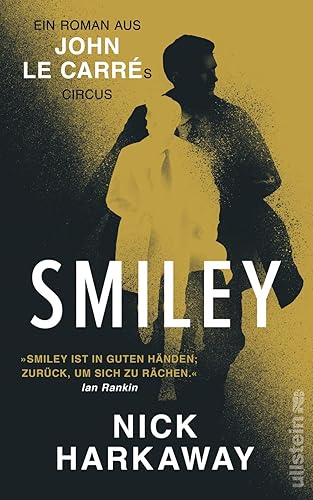
Smiley
von Nick Harkaway
Agenten-Thriller mit Retro-Flair. Britischer Anti-Bond soll obskuren Ungarn aufstöbern. Sorgfältig, detailreich und sogar amüsant erzählte europaweite Jagd, hin und her unter dem Eisernen Vorhang hindurch. John Le Carrés Sohn führt dessen Geschichte vom Spion aus der Kälte auf ebenbürtige Weise fort.
Ein anständiger Spion
Einen Spionageroman zu lesen, der in der Zeit des »Kalten Krieges« spielt, könnte bei etlichen Lesern geradezu wohlige Nostalgiegefühle wecken, wie wenn man in einen ehrwürdigen Oldtimer steigt. Um im Bild zu bleiben: Statt Navi, Sicherheitsassistenten und Touchscreen-Steuerung hatten Autofahrer vor sechzig Jahren ein Lenkrad, drei Pedale und ein paar Knöpfe am Armaturenbrett, um ihr Fahrzeug voranzutreiben, aber das konnte durchaus elegant, sportlich, bewundernswert sein. Der Spion hatte damals allenfalls ein paar handwerkliche Meisterstücke wie winzige Kameras und Tonbandgeräte bei sich, war im Einsatz aber auf sich selbst angewiesen, musste sich geschickt tarnen und bewegen, körperlich auf alles gefasst sein. Heutzutage stehen den Geheimdiensten weltumspannende Netze, Satelliten, Drohnen, Computer, Künstliche Intelligenz und allerlei Cyber-Zauber zur Verfügung, die jeden Flecken der Erde Tag und Nacht im Blick haben und im Home-Office befragt werden können. So ähnlich stellt sich jedenfalls das Bild dar, das uns Normalbürgern in Literatur und Film vermittelt werden sollte bzw. soll. Gleich geblieben ist die Brutalität des Wettkampfes und die Skrupellosigkeit, mit der man in diesem Betätigungsfeld über Leichen geht.
Nun ist 2024 ein britischer Spionageroman erschienen, der an die Glanzzeiten dieses Genres anknüpft, und das sozusagen aus berufener Feder. Sein Autor ist Nick Harkaway, der Sohn von John Le Carré (beides sind Künstlernamen). Letzterer schöpfte für seine Agententhriller aus dem Wissen, das er während seiner jahrelangen Tätigkeit für die britischen Geheimdienste MI5 und MI6 gesammelt hatte, bevor er sich zurückzog. Sein jüngster Sohn, 1972 geboren, verspürte in sich eine Art Vermächtnis, und so entschloss er sich, George Smiley, die Hauptfigur aus »Der Spion, der aus der Kälte kam«, dem wohl bekanntesten Werk seines Vaters, wieder aufleben zu lassen. »Smiley« (Originaltitel »Karla’s Choice«, übersetzt von Peter Torberg) ist aber sicher auch eine liebevolle Hommage an seinen im Dezember 2020 verstorbenen Vater.
»Smiley« beamt uns zurück in die Sechzigerjahre. Die weltpolitische Lage war übersichtlicher als heute. Zwei Lager standen einander unversöhnlich in feindlichem Wettkampf gegenüber: West und Ost, die »freie Welt« und die kommunistischen Diktaturen, getrennt durch den »Eisernen Vorhang«. Der war am sichtbarsten im geteilten Berlin mit seiner Mauer. Wer sie von Osten her zu überwinden versuchte, setzte sein Leben aufs Spiel. Der berühmteste offizielle Durchlass war der mit Schranken, Barrieren und Schützen gesicherte »Checkpoint Charlie«. Hier durften wenige Privilegierte nach strenger Kontrolle in den anderen Teil der Welt passieren.
Wer John Le Carrés Klassiker (oder seine Verfilmung) kennt, ist vertraut mit den Protagonisten wie Haydon und Esterhase, mit dem »Circus«, wie sie den britischen Geheimdienst ironisch bezeichnen, und mit der eisigen Atmosphäre des »Checkpoint Charlie«. Genau hier nahm die letzte Mission der beiden ein tragisches Ende, als ihr Agent Alec Leamas, der im Osten eingesetzt und enttarnt worden war, erschossen wurde.
Die Handlung in Nick Harkaways fiktionaler Fortführung setzt 1963 ein, also zwei Jahre nach »The Spy who came in from the Cold«. Das Desaster um Alec Leamas lastet noch schwer auf »Control«, so der Deckname des Chefs des britischen Auslandsgeheimdienstes, und überdies hat sich George Smiley, sein bester Mann, in den Ruhestand davongemacht. Schon über fünfzig Jahre alt und von nicht sonderlich attraktivem Äußeren, will sich Smiley jetzt noch ein erfülltes Leben einrichten, indem er sich ganz seiner geliebten Ehefrau Lady Ann Sercomb widmet. Leider zeigt sich bald, dass nicht nur sein Chef, sondern auch die lebenslustige Lady Ann und das Schicksal ihm diese Art von Glück nicht vergönnen.
Denn »Control« hat gerade eine harte Nuss zu knacken und traut niemandem anders als Smiley zu, diese Aufgabe zu lösen. Wie noch oft in diesem Roman breitet der Autor einen Nebenhandlungskomplex mit einer ganzen Reihe von Personen aus, ehe er den Haupthandlungsstrang fortsetzen kann.
László Bánáti, ein Jahrzehnt zuvor aus Ungarn entkommen, führt seither einen kleinen Literatur-Verlag in London. Auch seine Mitarbeiterin Susanna Gero, 23, hat sich als Sechzehnjährige auf höchst gefährlichen Wegen zu Fuß über die Grenze von Ungarn nach Österreich durchgeschlagen. In London hat ihr ihr gleichgesinnter Landsmann, der mehr schweigt als redet, beigestanden, Zuflucht gegeben, das verräterische »Z« aus ihrem Taufnamen (»Zsuzsanna«) entfernt.
Eines Tages stand ein eigenartiger Mann vor der Tür des Verlages und stellte sich unter allerlei merkwürdigen Erläuterungen als »Miki« vor. Auf Befehl des Kommitees für Staatssicherheit der UdSSR solle er Mr. Bánáti töten, auf einen Wink Gottes hin wolle er aber kein Mörder mehr sein. Was sollte das, fragte sich Susanna. War das ein Sonderling? Ein russischer Spion? Ein Überläufer? Ein Flüchtling wie sie und Mr. Bánáti? Dieser musste jedoch eine drohende Gefahr geahnt haben, hatte rechtzeitig seine Koffer gepackt und war verschwunden. In ihrer Ratlosigkeit wendet sich Susanna an eine Dame mit Verbindungen zum »Circus«, die ihr in ihrer britischen Anfangszeit geholfen hatte.
Über diesen inhaltlichen Parforceritt (durchaus entspannt erzählt) sind wir endlich ins Zentrum der britischen Spionage gelangt, wo in der Telefonzentrale die Drähte heißlaufen. László Bánáti ist unauffindbar, die Causa Michail Bortnik (»Miki«) schreit nach Aufklärung, Anordnung und Aktion, »Control« ist in Aufruhr und George Smiley außer Dienst.
Nach allem, was man beim »Circus« und beim amerikanischen Bruderdienst weiß, war László Bánáti weder mit Sowjets noch mit Widerständlern in Kontakt, sondern ein unbedeutender, unpolitischer Flüchtling, der einfach sein harmloses privates Leben lebt. Bei den Recherchen stößt man auf uralte Fotos aus dem Moskauer Hotel Turmalin, nach dem zweiten Weltkrieg ein Fluchtort linker Emigranten. Nach ihrer Zeit in dem vermeintlich sicheren Unterschlupf verschwanden sie in Ausbildungslagern, nahmen neue Identitäten an, erfanden sich neue Lebensgeschichten. Und darunter, sieht man jetzt, war auch der Ungar László Bánáti unter seinem ursprünglichen Namen Ferenc Róka. Der hatte sein Leben dem Kampf gewidmet, erst im Spanischen Bürgerkrieg, später gegen ungarische Juden (»Pfeilkreuzler«) in den Straßen von Budapest. »Control« beauftragt Smiley, Róka zu finden, doch der ist nicht willens, dem Folge zu leisten. Denn er hat nicht nur seinen Ruhestand mit der liebreizenden Ann vor Augen, sondern auch das blutige Ende von Alec Leamas noch im Sinn, der in Ost-Berlin Hans Dieter Mundt, den »bissigsten Köter der Stasi«, erledigen sollte und dann von ebendiesem abgefangen und getötet wurde.
Doch zwei Tage später knickt Smiley ein. Es folgt ein aufregendes Hin und Her zwischen den Blöcken nach Berlin, Wien, Budapest, London und Portugal, wobei die Grenzpassagen mit falschen Pässen uns und den Agenten besonderen Thrill im faszinierenden Plot bringen. Sekretärin Susanna ist dabei stets an Smileys Seite.
Nick Harkaways Roman fordert uns Leser in ungewöhnlicher Weise heraus. Der zentrale Plot ist stringent entwickelt, leicht verständlich, plausibel und wendungsreich verfasst, doch wie der Autor ihn mit einem komplexen Geflecht von Handlungssträngen und atmosphärisch dichten Szenen bereichert, ist eine wahre literarische Leistung. Unzählige Figuren mit Tarn- und/oder realen Namen (auch »Karla« aus dem Originaltitel ist ein Deckname), ihre Funktionen als Agenten oder Doppelagenten, ihre Zugehörigkeiten zu diesem oder jenem oder beiden verfeindeten Systemen, der Grad ihrer Solidarität – all das sind Elemente von Harkaways Verrätselung nach dem Motto »Die Operation ist eine Hummerfalle; hinein ist leicht, hinaus nicht«. Insbesondere Susanna beeindruckt durch ihren inneren Zwiespalt zwischen Zweifel und Tatkraft in der Männerdomäne der Spionagewelt. Die Erzählweise besticht unter anderem dadurch, dass sie trotz oft lebensbedrohlicher Risiken im doppelbödigen Katz-und-Maus-Spiel mit pfiffiger Ironie und Komik gespickt ist. Oder ist es die Realität der Agentenwelt selber, die gelegentlich lächerlich bis absurd erscheint? Hat man tatsächlich erörtert, wie Haarschnitt und Kleidung eines Agenten über Erfolg oder Misserfolg einer Aktion entscheiden? Hat es sich wirklich als förderlich erwiesen, sich »wie ein Rüpel« aufzuführen oder besser noch »als grobschlächtiger, langsamer Denker« auszugeben, wenn man in Ungarn als Einheimischer durchgehen muss?.
»Control« schätzt seinen Mitarbeiter George Smiley aus guten Gründen. »Machen Sie es auf Smileys Art … Beweisen Sie allen gegenüber Anstand«, appelliert er an Smiley selber. Und dieser bleibt sich treu. Bedächtig, fast träge geht er seine Operationen an. Er will ein Anständiger, ein Gentleman sein, auch wenn es schier unmöglich ist.
 · Herkunft:
· Herkunft: