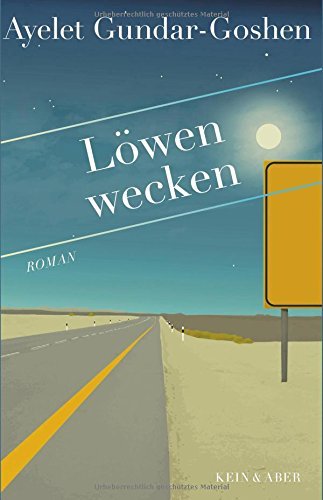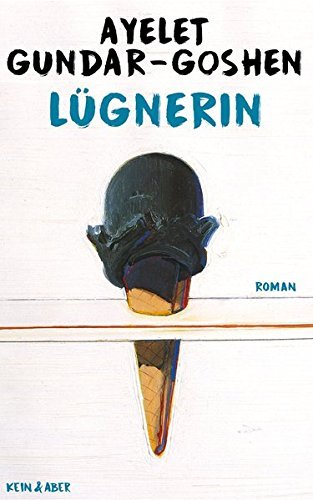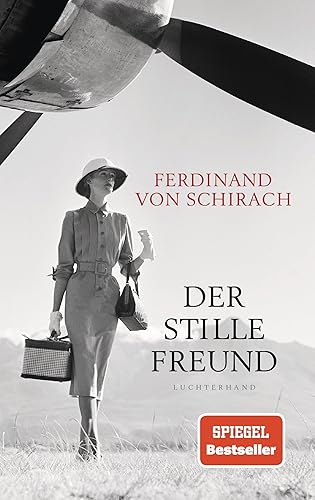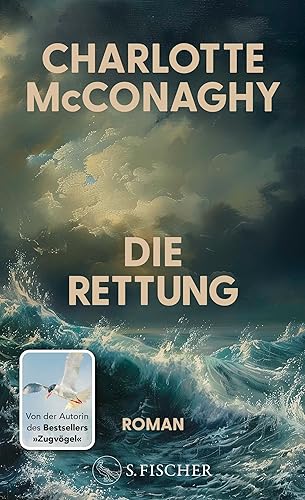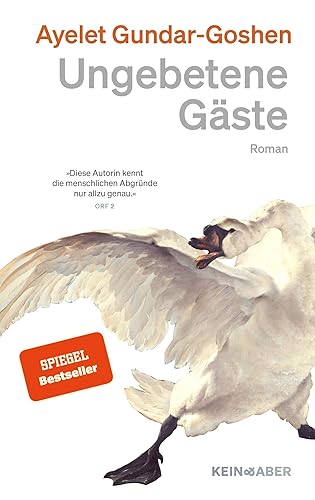
Ungebetene Gäste
von Ayelet Gundar-Goshen
Ein Nachmittag gerät außer Kontrolle: Vom Balkon der jungen Mutter Naomi fällt ein Hammer, ein Mann stirbt, ein Unschuldiger wird festgenommen – weil sie schweigt. Ayelet Gundar-Goshen erzählt ein präzises Moraldrama über Angst, Vorurteil und Verantwortung. Ein späterer Handlungsstrang in Lagos/Nigeria weitet den Rahmen, doch die größte Wucht entfaltet der intime Nahblick auf eine Familie im Ausnahmezustand.
Die Last eines Augenblicks
Seit der Geburt des Söhnchens dreht sich Naomis Leben nur noch um den kleinen, unsäglich anstrengenden Uri, der fortwährend nach Aufmerksamkeit schreit, in der Wohnung umher robbt und alles ergreift, was seine Fingerchen zu fassen bekommen. Wie rücksichtslos von Juval, ihrem Ehemann, ausgerechnet in dieser Zeit einen Handwerker zu bestellen, der die Balkonbrüstung ausbessern soll. Außerdem hat Naomi ein sehr ungutes Gefühl, denn jetzt ist sie mit ihm und dem Baby allein in der Wohnung, und der Arbeiter ist Araber.
Naomi will keine Ressentiments und Ängste aufkommen lassen, zumal der Fremde sich als netter Mann entpuppt, der schnell das Interesse des unruhig quengelnden Uri auf sich zu lenken vermag. Sie stellt ihm Kaffee und ein paar Kekse hin und zieht sich mit dem Baby ins Schlafzimmer zurück, um zu stillen und zu entspannen. Damit ist es schnell vorbei, als der Arbeiter an die Tür klopft: Auf dem Balkon sei sein Farbeimer umgefallen, er benötige einen Lappen. Naomi will ihm die Putzarbeit abnehmen. Wo ist Uri schon wieder? Der Mann bittet, das WC benutzen zu dürfen. Jetzt die unangenehmen Geräusche aus der Toilette, draußen das mühselige Aufwischen der Farbe, drinnen erkunden Uris Händchen die Scherben eines heruntergefallenen Glastellers – Naomis Nerven liegen blank, Überblick und Kontrolle entgleiten ihr … Wie konnte sie nicht bemerken, wie ihr Baby inmitten des Chaos auf den Balkon robbt, sich auf den Blumenkübel hinaufhangelt, dabei den Hammer auf der Brüstung antippt? Uri schreit wie am Spieß, denn erneut ist der Farbeimer umgekippt, und auch von der Straße unten dringt verzweifeltes Geschrei herauf. Dort liegt ein junger Mann auf dem Gehweg, sein Kopf in einer Blutlache.
Schon ist die Polizei vor Ort. Aufgebrachte Passanten berichten aufgeregt: »Araber renovieren im fünften Stock … Man hat ihm einen Hammer an den Kopf geworfen … das ist ein Anschlag!« Der Vater des Toten, ein jüdischer Lebensmittelhändler, lässt seinem tief verwurzelten Hass auf die »arabischen Maniacs« freien Lauf. Derweil sind die Polizisten im fünften Stock und nehmen den ratlosen Araber fest, als er gerade die Toilette verlassen hat. Naomi bringt dazu kein Wort heraus. Sie ringt mit ihrer Überbelastung, ihrer Fahrlässigkeit, den Vorwürfen, die Juval erheben wird.
So beginnt der Roman »Ungebetene Gäste« buchstäblich hammerhart und stürzt seine Protagonisten und uns in ein atemloses Moraldrama, das Privates und Politisches unlösbar verquickt. Im Zentrum steht Naomi, die frischgebackene, unvorbereitete Mutter, erschöpft, überfordert, taumelnd zwischen Fürsorge, Ängsten, Vorurteil und gutem Willen. Sekunden der Unachtsamkeit kosten einen Unbeteiligten das Leben, und ein Unschuldiger wird eines Verbrechens angeklagt. Wider besseres Wissen schweigt Naomi zu allem – der erste Schritt in eine Schuld, die fortan alle Räume ihres Lebens besetzt.
Ayelet Gundar-Goshen nutzt die Enge der Wohnung wie eine Bühne: Hier verdichten sich die Geräusche des Alltags zu einem nervösen Pulsschlag; hier prallen Vorurteil, Hilflosigkeit und Selbstschutz aufeinander. Die Handlung führt vor, wie rasch Sorge in Panik, Verdacht in Gewissheit kippt und wie bequem gängige gesellschaftliche Deutung dem Einzelnen die Eigenverantwortung abnimmt. Zugleich macht uns die Autorin den begrenzten, selektiven Blick Naomis bewusst: Stets fokussiert auf ihr Kind und sich selbst, sieht sie nicht, was ihr Schweigen mit Juval, ihrem Mann, und mit der Familie des zu Unrecht Beschuldigten anrichtet.
Besonders stark ist der Roman, wenn er die Eskalation als soziale Choreographie inszeniert: Der dreizehnjährige Said, der seinem Vater das Essen bringt, gerät in die Hände eines aufgeheizten Mobs, der bei dem Jungen einen Sprengsatz vermutet; erst als aus der vermeintlichen Gefahr eine schlichte Tüte mit Gemüse und Obst wird, bricht die Raserei. Auch Juvals Handeln (teils aus militärischem Instinkt als Soldat, teils aus Fürsorge als Ehemann und Vater) bleibt in den Reflexen eines Landes gefangen, das permanent im Alarmzustand lebt. Gundar-Goshen zeigt überzeugend, wie eine Gesellschaft, die stets mit dem Schlimmsten rechnet, leichtfertig das Schlimmste erzeugt.
Als Naomi sich ihrer Verantwortung nicht mehr entziehen kann, erreicht der Plot einen Wendepunkt und führt in einer zweiten Bewegung hinaus aus Tel Aviv. Juval erhält ein Angebot, als Ausbilder die nigerianische Luftwaffe zu unterstützen. Der Umzug der Familie nach Lagos verspricht Abstand und bringt doch keine Erlösung. Der Ortswechsel vergrößert die Bühne, auf der sich Fragen nach Schuld und Verantwortung verhandeln. Ein umfänglicher politischer Exkurs zur Rolle Israels im nigerianischen Bürgerkrieg um die Region Biafra (1967 bis 1970) erweitert das moralische Panorama, nimmt der zentralen Tel-Aviv-Handlung aber das Tempo. Im privaten Bereich erweist sich ein Handlungsstrang um Naomi, Juval und die Therapeutin Noga in Lagos zwar als dramaturgisch effektvoll, wirkt aber bei kritischer Betrachtung allzu unrealistisch konstruiert. Wo der Roman am stärksten ist – im präzisen Nahblick auf einen Haushalt im Ausnahmezustand –, schwächt ihn zuweilen die Last zusätzlicher Stränge.
Formal schreibt Gundar-Goshen mit psychologischer Zartheit und erzählerischer Härte. Sie formt ihre Figuren nicht entlang von Thesen, sondern als lebende Menschen. Sie lauscht ihren Ängsten, Ausflüchten, Ausreden – und dem hartnäckigen Ticken der Schuldgefühle. Besonders Naomi ist keine Allegorie, sondern eine kluge Frau mitten in ihrem Alltag als Mutter: instinktgesteuert, widersprüchlich, heilfroh, wenn das Baby endlich schläft, und zugleich fähig, die eine Entscheidung zu treffen, die alles verdirbt. Das macht den Roman so unangenehm wahr: Das Ungeheuerliche geschieht nicht gegen Vernunft und Wissen, sondern aus dem Bedürfnis heraus, sich und die Nächsten zu schützen.
Unter der Oberfläche des Thrillers brechen gewichtige Ethikprobleme auf. Was schulden wir der Wahrheit, wenn sie uns selbst bedroht oder gar vernichtet? Macht ein Geständnis frei – oder verschiebt es die Last nur auf andere? Wie viel von dem, was wir »Moral« nennen, ist bloß die Summe unserer Ängste, unserer Milieus, unserer Schlagzeilen? Gundar-Goshen beantwortet nichts endgültig; sie lässt die Figuren mit den Folgen leben. Das ist die reifere, schmerzlichere Gerechtigkeit, die Literatur leisten kann.So bleibt »Ungebetene Gäste« ein Roman über ungebetene Begleiter: Angst, Vorurteil, Zufall und die Schuld, die man aus der Wohnung nicht mehr hinauskomplimentieren kann. Trotz verdünnender Perspektivweitungen überwiegt am Ende die Wucht seiner klugen, beunruhigenden Erzählung darüber, wie schnell in einer zerklüfteten Welt ein Mensch zum Feind erklärt ist – und wie schwer es ist, dann noch Mensch zu bleiben.
 · Herkunft:
· Herkunft: