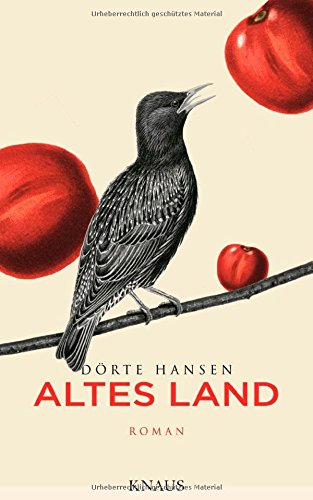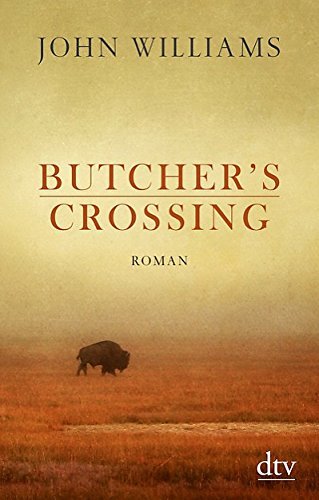Unheimliches Altern
Ruth Field wohnt allein in ihrem Haus am Meer, ein Stück nördlich von Sydney. Früher war es das Ferienhaus der Familie, aber jetzt ist Ruth verwitwet, und die Söhne Jeffrey und Phillip führen weit weg in Neuseeland und Hongkong ihre eigenen Leben. Ruth, 75, schaut Tag für Tag aufs Meer, wie Ebbe und Flut einander abwechseln und Sonne, Wind, Wolken und Regen bringen. Zwei Katzen leisten ihr Gesellschaft.
Eines Nachts nimmt sie Merkwürdiges im Haus wahr: »ein seltsames, ersticktes Fauchen, gefolgt von einem lauteren Schnüffeln«, »begleitet von einem leisen, gutturalen Schnurren, immer wieder unterbrochen von einem kurzen, warnenden Grollen, das sich jeden Augenblick in ein Brüllen verwandeln konnte«. Ruth erinnert sich an einen Zoobesuch – es sind die Geräusche, die ein Tiger verursacht. Ein penetranter Geruch durchzieht zudem das Haus, die Katzen flüchten in hysterischer Panik. Ruth hingegen ist die Ruhe selbst. Sie wählt Jeffreys Nummer und beschreibt ihm, was sie registriert hat. Er besänftigt sie mit wenigen Worten, es werde wohl ein Traum gewesen sein, und schon beginnt sie selbst, die ganze Angelegenheit kritisch zu revidieren. Was für ein Biest hat sich da eingeschlichen?
Der Tiger bleibt bei Ruth, genauer gesagt: in ihr. Wie ihre Überzeugung, die Raubkatze streiche durchs Haus, um den richtigen Moment zum Zuschlagen abzupassen und ihre Beute zu zerreißen, sich festigt und ihr Verstand sich gleichzeitig gegen diese Interpretation wehrt, gerät ihr Selbstbild ins Wanken. Als scharfe Analytikerin – einst eine resolute Sprecherzieherin – entgeht ihr nicht, wie Gewissheiten zu zerbröseln beginnen, Unsicherheiten wachsen, Zweifel überhand nehmen. Ihre Gegenwart steht offenkundig auf tönernen Füßen, die Realitäten der Vergangenheit lösen sich auf; was für eine Zukunft erwartet sie da?
Mit dieser stimmigen Metaphorik hat die junge australische Autorin Fiona McFarlane in ihrem ersten Roman ein sehr persönliches Anliegen überzeugend realisiert: zu erzählen, wie sich Demenz ›anfühlen‹ könnte, wie ein Mensch kaum merklich aus seiner gewohnten lebenslang stabilen Befindlichkeit in die andere hinübergleitet, welche Emotionen ihn dabei begleiten. Es gibt inzwischen zahlreiche Romane zum Thema; McFarlanes innovative Leistung ist der Versuch einer unsentimentalen, ernsthaften, klischeefreien Innensicht. Ihre beiden Großmütter litten an Demenz.
Eine neue Dimension eröffnet sich in Ruths Entwicklung, als Frida Young in ihr Leben tritt. Sie stellt sich als vom Staat beauftragte Betreuerin vor, die täglich eine Stunde nach dem Rechten sehen werde. Ruth ist misstrauisch. Braucht sie denn jemanden? Gefragt hat sie niemand. Wenngleich sie sich eingesteht, dass sie an die »Grenzen ihrer Unabhängigkeit« stößt, manche Dinge »bis zum Mittag völlig vergessen haben würde« und ihre Rückenprobleme chronisch sind, kann sie doch »immer noch selbst über ihr Leben bestimmen«. Sie weiß, »dass sie weder hilflos noch besonders mutig war, sondern irgendwas dazwischen«.
Lauert der Tiger im Verborgenen, so nistet sich Frida ganz unverhohlen ein. Ein goldenes Taxi bringt sie jeden Tag, um Ruth mit immer neuen Frisuren zu überraschen und ihren bislang so geruhsamen Alltag zu stören. Oder ist sie eine Bereicherung? Ruth ist willens zu akzeptieren, dass der Staat, an den Harry sein Leben lang brav Steuern bezahlt hat, sich nun auch um sie kümmert, ihr »diese Frida zur Verfügung stellte«. Wenn sie am Abend wieder davonfährt, versinkt Ruth »in ein Schweigen der Erleichterung und des Bedauerns«.
Auf surrealistische Weise reißt Frida das Regiment an sich. Erst ist es ihr Koffer, »der unverfroren Platz im Esszimmer beanspruchte«, dann zieht Frida selber ein, übernimmt Raum um Raum, gängelt, bevormundet und verunsichert Ruth. Ihre allgegenwärtige Dominanz manifestiert sich körperlich: »Sie war riesig. Sie schien aus dem Ozean aufgetaucht zu sein, aufgebläht von Strömungen und Gezeiten, zornig und blau ... Ihre Haare hatten sich irgendeiner chaotischen Kraft unterworfen ... Sie trugen zum Eindruck göttlichen Zorns bei«.
Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen bleibt vielschichtig. Einerseits verliert sich Ruth in Selbstzweifeln und Ungewissheit, wird immer kleiner, ängstlicher und unscheinbarer, je länger die nächtlichen Geräusche und Fridas Launen zwischen offener Aggression und zärtlicher Hinwendung ihr zu schaffen machen. Da bedauert man sie, wie sie in ihrer Verletzlichkeit Fridas Willkür hilflos ausgeliefert ist. Andererseits weiß sie sich resolut zur Wehr zu setzen, kann sogar ziemlich gemein werden (wie ja auch demente Personen bekanntlich kräftige Hiebe austeilen können).
Außerdem bewahrt Ruth ihre Kreativität. Um dem Tagesablauf feste Strukturen zu geben, erfindet sie originelle Rituale, wie zum Beispiel die erste Treppenstufe immer mit dem linken Fuß zu betreten. Entscheidungen trifft sie nach verqueren Wenn-dann-Konstruktionen: Klingelt der Taxifahrer nicht an ihrer Haustür, darf sie weitere zwei Stunden in ihrem Sessel ruhen.
Im Strom der Erlebnisse mit Frida, die kocht, putzt, Ruths Haare wäscht, ihre Füße trocknet, werden alte Erlebnisse hochgespült. Ruth wuchs auf Fidschi auf, wo ihr Vater als Arzt in einer Krankenstation und als Missionar wirkte. Am Karfreitag wusch er in traditioneller Zeremonie den Patienten, dem Personal, den Hausbediensteten, Mutter und Tochter die Füße. Das war nicht nur Ruth unangenehm. Den jungen Mediziner Richard Porter machte es zornig, dass die Kolonialherren, nachdem sie die Einwohner des Landes zu »Hausboys« degradiert hatten, sich nun auch noch ein »Privileg des Dienens« anmaßten. Derlei ostentative »Selbsterniedrigung, Demut, Hingabe« nach Jesu Vorbild empfand er als scheinheilig und zynisch.
Ruth verliebte sich in den aufrechten Richard, und der Ball der Queen, zu dem sie mit ihm geladen war, blieb mit dem Kuss, den er ihr gab, der Höhepunkt ihrer Zeit auf Fidschi. Doch Richard war bereits einer anderen Frau versprochen. Wie gern würde sie den Mann jetzt wiedersehen. So lädt sie ihn nach fünfzig Jahren einfach zu sich ein und durchlebt mit ihm ein traumhaftes romantisches Wochenende, freilich kritisch von Frida beäugt.
Mit jeder Episode, mit jeder Wendung tauchen für den Leser natürlich neue Fragen auf. Was ist hier eigentlich Realität, was reine Fantasie, was fantasievoll veränderte Realität, was zerfallene Realität, was Zwischenreich? Wieviel Tiger, wieviel Frida lebt tatsächlich im Haus der alten Dame? Dank des sachlichen Erzählstils, mit dem Fiona McFarlane ihre alternde Protagonistin Ruth durch alle Fährnisse steuert, als sei sie eine klar und differenziert denkende Erwachsene, wird der Leser selbst in den Strudel hineingezogen, in dem Ruth sich schließlich verliert. Auch das gehört zu ihrem Konzept: die Zuverlässigkeit der Erzählung selbst schwanken zu lassen, den Leser dadurch dem gleichen Auf und Ab zwischen Sicherheit und Bodenlosigkeit zu unterwerfen, dem Ruth sich ausgesetzt sieht, wenn sie ihre Sinne auf Frida und den Tiger konzentriert.
»The Night Guest«  (von Brigitte Walitzek übersetzt) ist der ungewöhnliche, überzeugende Debütroman einer jungen Autorin, von der man noch viel erhoffen darf.
(von Brigitte Walitzek übersetzt) ist der ungewöhnliche, überzeugende Debütroman einer jungen Autorin, von der man noch viel erhoffen darf.
 · Herkunft:
· Herkunft: