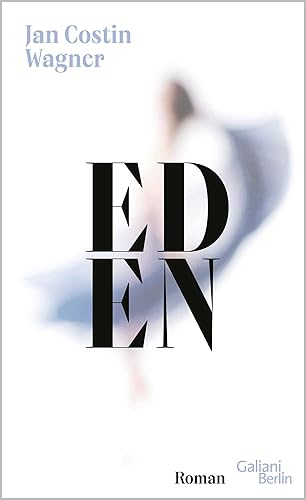Die acht Leben der Frau Mook
von Mirinae Lee
Mirinae Lee erzählt die Geschichte einer Frau, die, um zu überleben, Identitäten zu wechseln lernt, als wären es Sprachen oder Orte. Episodenhaft und perspektivenreich verknüpft der Roman Gewaltgeschichte, Fürsorge und die Ambivalenz des Erinnerns – ein ungeschöntes, bewegendes Porträt des koreanischen 20. Jahrhunderts.
Namen. Rollen. Überleben.
Mirinae Lee ist in Südkorea geboren und aufgewachsen, hat in den USA Englische Literatur studiert und lebt heute in Hongkong. Ihren Debütroman hat sie in englischer Sprache verfasst: »8 Lives of a Century-old Trickster« erschien 2023 in Großbritannien, stand auf der Longlist des Women’s Prize for Fiction und erhielt den William Saroyan International Prize for Writing. Das Buch wurde in etliche Sprachen übersetzt, u.a. durch Karen Gerwig ins Deutsche.
Dieser bemerkenswerte Roman spannt einen Bogen über ein Jahrhundert koreanischer Geschichte. Im Jahr 1910 annektierte Japan das bis dahin eigenständige Reich und betrieb die rigorose Auslöschung der koreanischen Kultur und Sprache. Die Phase der destruktiven Bevormundung, Unterdrückung und Ausbeutung der Bevölkerung endete 1945 mit Japans Kapitulation. Danach übertrugen die Vereinten Nationen der Sowjetunion und den USA die Verwaltung des Landes. Statt zur Schaffung eines koreanischen Staates führte die ideologische Rivalität der beiden Siegermächte zur Teilung des Landes entlang des 38. Breitengrades. 1950 entbrannte zwischen Nord und Süd der Koreakrieg mit ausländischer Beteiligung auf beiden Seiten. Trotz des 1953 geschlossenen Waffenstillstands blieb das Verhältnis zwischen den beiden Landesteilen bis heute gespannt.
Im Zentrum des Erzählens steht Mook Miran, eine schillernde Kunstfigur, deren Biografie als Prisma für die Erfahrungen vieler steht. Sie lebt im Pflegeheim »Golden Sunset« in Seoul. Dort interviewt die Ich-Erzählerin des Prologs die Heimbewohnerinnen, um deren Biografien zu dokumentieren und sie später als Nachruf zu verwenden. Auch Frau Mook beginnt, ihr ihre Lebensgeschichte anzuvertrauen. Obwohl »übermorgen hundert« Jahre alt, erweist sie sich als uneingeschränkte Herrin ihrer Sinne, ihres Geistes und ihrer Erlebnisse und verschlüsselt ihre Vita in acht Etiketten: »Sklavin. Fluchtkünstlerin. Mörderin. Terroristin. Spionin. Geliebte. […] Mutter. […]. Hochstaplerin.«
Die Autorin legt Frau Mooks »acht Leben« nicht chronologisch an. Die Kapitel sind mit Jahreszahlen versehen (1961, 1938, 1950, 1942, 1955, 2005, 2006), jedoch wechseln auch ihre Orte, Themen, Perspektiven und Identitäten. In dieser Montage durchaus eigenständig wirkender Erzählungen mit verwirrenden Zeitsprüngen Orientierung zu gewinnen und zu behalten fordert Mühe, ist aber dank der Zeitmarken und der zentralen Charaktere möglich. Unser Eindruck, es könne sich um mehrere Biografien handeln, die Frau Mook zu ihrer eigenen bündelt, gehört zum Programm: Identität erscheint als etwas, das erzählt, getarnt, getauscht werden kann. Beispielhaft steht dafür der Zweifel eines Ehemannes (1955), der nach Jahren der Trennung die Heimkehrende betrachtet und unsicher wird, ob sie dieselbe Frau ist, die er geheiratet hat. Ein Detail wie ihre entgegen aller Wahrscheinlichkeit verminderte Schuhgröße verdichtet den Verdacht, dass Identität als Strategie benutzt wird.
Was wird erzählt? Über die politischen Entwicklungen gibt es kaum Informationen. Im Mittelpunkt stehen Frauenrollen, Kulturen, Erfahrungen unter Fremdherrschaft, das Alltagsleben einfacher, fremdbestimmter Menschen, von denen Tausende durch Krieg, Unterjochung und Hungersnöte sterben.
Ein thematischer Schwerpunkt des Romans liegt auf der Gewalt gegen Frauen im Krieg und in militärischen Systemen. Schonungslos schildert Lee Zwangsprostitution unter japanischer Besatzung ebenso wie ihre Nachkriegsvarianten. Die Praxis, den Opfern neue Namen zu geben, markiert den ersten Zugriff auf ihre Identität: »Mit ihren Geschichten definierten sie alles neu. Erst änderten sie unsere Namen.« Die Gestaltung der Szenen in den sogenannten »Trosthäusern« vermeidet Sensationalismus, ohne das Grauen zu verdecken. Lee fasst Unzumutbares mit sprachlicher Nüchternheit: »Wenn ich in die Bewusstlosigkeit abglitt, übergossen sie mich mit einem Eimer Eiswasser, damit ich aufwachte und meine Pflicht bis Sonnenuntergang fortsetzte.«
Auch die von Koreanern in Kooperation mit der US-Armee regulierten »Vergnügungsviertel« werden nicht ausgespart. Die Kapitel über das »Monkey House« legen offen, wie Kontrolle, Entmenschlichung und ökonomische Ausbeutung weiblicher Körper unterschiedliche Regimes überdauern. Indem Lee beide Epochen nebeneinander stellt, rückt sie das Leid der Betroffenen in den Vordergrund und entzieht es nationalen Entlastungsnarrativen.
Mooks Überlebenskunst besteht darin, Rollen anzunehmen – aus Zwang, aus Kalkül, aus Fürsorge. Sie bedient sich nicht nur kluger Methoden der Tarnung als Spionin, sondern wagt auch den radikalen Schritt, sich zeitweise als Junge zu geben, um Gewalt zu entkommen. Lee stellt dafür einen interessanten Zusammenhang her: »Letztendlich ist verschiedene Identitäten anzunehmen wie verschiedene Sprachen zu sprechen. Wenn man eine Fremdsprache lernt, […] nimmt man auch ihre Stimmungen und Eigenarten auf und wie sich die Leute normalerweise ausdrücken, wenn sie sprechen, ohne nachzudenken. […] Man kann sich in eine fremde Person verwandeln, einfach indem man die Sprache wechselt. […] Man kann sich in die Geschichte einer anderen Person hineinstehlen, ohne es überhaupt zu merken.« Identität ist hier nicht statische Essenz, sondern wird zu veränderbarer Praxis.
Die andere Seite dieser Beweglichkeit ist Verantwortung. Sie zu erkennen und anzunehmen begleitet Mook schon in ihrem ersten Leben, ihrer Kindheit in einem kleinen Dorf am Rande von Pjöngjang um 1940. Ihre Eltern sind Opfer kommunistischer Zwangsideologie. Die gebildeten Eltern von Mooks Mutter waren wegen kritischer politischer Aktivitäten inhaftiert worden. Um ihre Tochter dem gesellschaftsschädlichen bürgerlichen Einfluss zu entziehen, wurde Mooks Mutter, »eine vollkommene Frau: intelligent, schön, vornehm und liebevoll«, gezwungen, einen nordkoreanischen Proletarier zu heiraten, den Sohn eines Bauern, einen »ungebildeten Fischer« und »Trunkenbold«. Aus der Ehe geht das Mädchen Mook hervor.
Als das Kind den Drang verspürt, »Erde zu essen«, hält der Vater das für das »Werk eines bösen Geistes«, misshandelt seine Tochter und ruft einen Exorzisten zu Hilfe. Wehrlos muss die Mutter die entsetzlichen Grausamkeiten mit ansehen, die dieser ihrem Kind zufügt. Später erzürnt den Vater bis zur Weißglut, dass seine Frau zusammen mit ihrer Tochter bei einem Priester Englischunterricht nimmt. Als er seine Frau dafür verprügelt und bedroht, muss das »Monster« vernichtet werden, und Mook vergiftet ihren Vater aus reiner »Selbstverteidigung«. Im Rückblick bezeichnet sie sich sogar als »Serienmörderin«, denn sie tötete auch drei Soldaten, um »Trostfrauen« zu befreien. Statt ihre Protagonistin zu entlasten, vertraut die Autorin darauf, Mooks moralische Bilanz offen zu lassen.
Sprachlich verbindet Lee Schlichtheit mit anschaulicher Konkretisierung. Die Gewaltmomente sind explizit, aber nicht effekthascherisch. Daneben setzt der Roman ruhigere Szenen mit leisen, oft tröstlichen Tönen, die Wärme ohne Kitsch gewinnen: Anteilnahme, Wahlverwandtschaft, die Möglichkeit, »Mutter« zu werden, indem man handelt. »Die Liebe wächst nach und nach […]. Indem ich mich verhielt wie eine liebende Mutter, wurde ich zur liebenden Mutter.« Solche Passagen erden den Text und verhindern, dass die Episoden zu einer reinen Chronik des Leidens gerinnen. Selbst Täuschung kommt nicht nur als Aggression vor, sondern auch als Schutz einer gemeinsamen Fiktion. Wie das Liebesspiel ist auch Täuschung eine Handlung zweier Parteien und bleibt unvollständig ohne die Person, die getäuscht wird: »Wie sehr er sich sehnte zu glauben – wie bereitwillig, wie verzweifelt. Er weiß, was er tun wird […]: Er wird warten.« Erneut bricht ein Widerspruch auf – zwischen dem universellen Wahrheitsgebot und Frau Mooks Praxis –, ohne dass die Autorin wertet.
Die Rahmenerzählerin – die »Nachruf-Frau« – fungiert als Protokollantin, Spurensammlerin und als zweite Instanz des Deutens. Wenn sie Mook am Ende die »unerschrockenste Lügnerin« nennt, wertet sie damit weder das Gehörte ab noch will sie uns warnen, sondern diagnostiziert Mooks Geschichten als Werkzeuge ihrer Selbstbehauptung gegen die Zumutungen der eigenen Biografie.
Was aber macht dann Identität aus, wenn Namen, Rollen und Zugehörigkeiten wechseln? Wo verläuft die Grenze zwischen Überlebenstaktik und Selbstverlust? Solche Fragen stellen sich uns am Ende des Romans. Antworten verweigert die Autorin, setzt ihm aber einen ruhigen, überzeugenden Schluss, der Mooks Lebenswege topografisch bindet: »Sie war also nicht nur viele verschiedene Personen gewesen, sondern auch genauso viele verschiedene Orte.«
 · Herkunft:
· Herkunft: