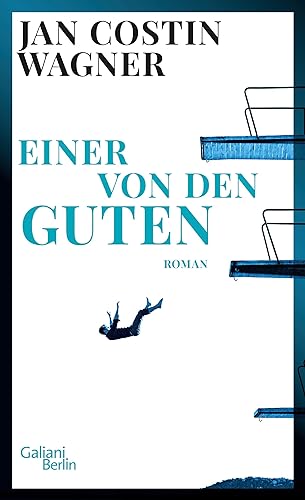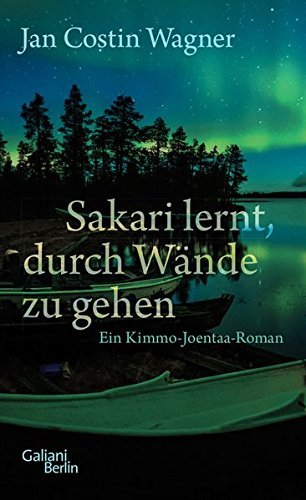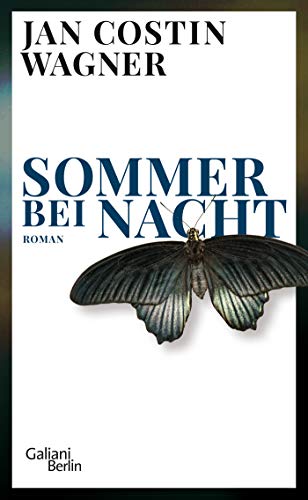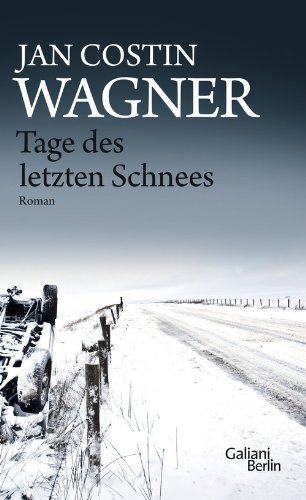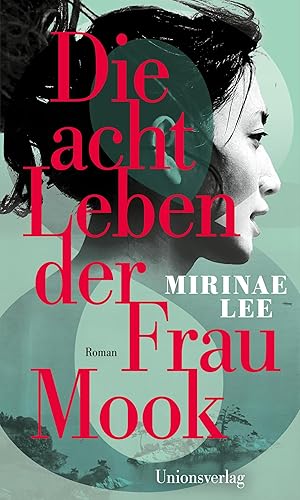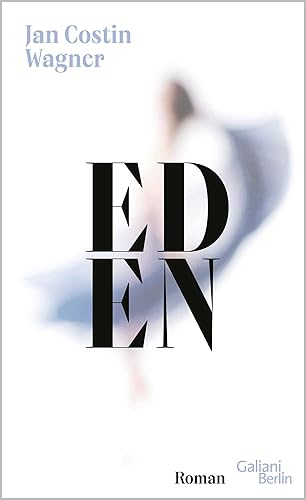
Eden
von Jan Costin Wagner
Als ihre zwölfjährige Tochter bei einem Terroranschlag getötet wird, verlieren ihre Eltern den gemeinsamen Halt. Während sich die Mutter zurückzieht, sucht der Vater die Hintergründe des Ereignisses zu verstehen. Doch die Untat schlägt auch Wellen in der Gesellschaft.
Wege der Trauer
Die Ausgangslage des Plots von Jan Costin Wagners neuem Roman ist ein Zustand nicht allzu häufigen Glücks. Sofie Stenger, zwölf, ist der geliebte Mittelpunkt einer kleinen, verständnisvollen, unbeschwerten und stabilen Familie: Mutter Kerstin, Vater Markus, viel gemeinsamer Alltag, verlässliche Nähe. Als Markus für seine Tochter Karten für das Konzert ihrer Lieblingssängerin besorgt, scheint das ein Geschenk, das noch Jahre nachleuchten wird. Sofie ist überglücklich.
Der Abend endet in einer Katastrophe. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich im Foyer in die Luft. Unter den vielen Toten ist auch Sofie.
Wagners Roman folgt nicht den Ermittlungen der Polizei, sondern in erster Linie der Trauer der Hinterbliebenen und in zweiter Linie den Wellen, die die Tat im Land schlägt.
Markus und Kerstin reagieren gegensätzlich. Markus sucht Halt in Handlung. Er will verstehen, wie es zu der Tat kommen konnte; er liest, fragt nach, fährt hin. Er nimmt Kontakt zur Familie des Täters auf, spricht mit Eltern und Bruder, tastet sich an deren Alltag heran. Er sitzt in einer Talkshow und versucht, dem reflexhaften Zorn nicht zu folgen. Später mietet er – als hilfloser Versuch, der Leere etwas entgegenzusetzen – die freigegebene Wohnung des Attentäters und richtet sie als künftige Studentenwohnung für Sofie ein. Das ist verstörend und, ja, schwer zu glauben. Aber als Bild für den Wunsch, das Unfassbare in ein vertrautes Gefüge zu zwingen, ist es stark.
Kerstin zieht sich zurück. Ihre Mutter Margot lebt mit Demenz im Pflegeheim. Markus will, dass sie glücklich bleiben darf in der Illusion, die Enkelin tanze noch. Kerstin erträgt diese Schonung kaum. Sie bricht den Alltag ab, sucht Ruhe, Abstand und Halt in einer Kurklinik, kommt zu Geburtstagen und Feiertagen zurück und geht wieder fort. Die Sätze des Trostes, die gern bemüht werden – »dass Sofie gewollt hätte, dass wir leben, dass wir glücklich sind« –, stützen sie nicht. Der Roman zeigt diesen Stillstand nüchtern und genau, ohne Kerstin als absonderlich oder depressiv abzustempeln. Trauer ist keine gerade Linie.
Parallel legt Wagner dünne Fäden in die Umgebung. Tobias, Sofies Freund aus der Schule, hat sie stets um das warme Klima ihres Zuhauses beneidet – bei seiner Familie ist Anspannung der Normalzustand. Sein Vater hat sich in einer digitalen Echokammer eingerichtet, scrollt durch Schlagworte und virtuelle Erregung: Corona-»Aufarbeitung«, »Remigration«, die nächste Empörung. Ein TV-Gesicht mit deutlich erkennbaren Zügen Alice Weidels gibt den Ton vor. Der Roman zeigt in diesen Szenen, wie einfach sich individuelles Leid an große Erzählungen andocken lässt und als Material für die unterschiedlichsten politischen Richtungen instrumentalisiert werden kann.
Den Täter selbst konturiert Wagner nur knapp. Ayoub Issah ist kein geborenes Monster, hat keine Entschuldigung. Er ist ein junger Mann mit dem Gefühl, nicht zu genügen. Obwohl ein guter Boxer, wird er ohne Erklärung aus dem Verein geworfen. Immer stärker schlägt ihn die Idee in den Bann, sich durch eine letzte Tat fortdauernde Bedeutung zu verschaffen. Sein Motiv bleibt fragmentarisch. Das ist konsequent, denn die eigentliche Bewegung des Romans liegt in der Frage, was die Tat mit den anderen macht.
»Eden« ist multiperspektivisch gebaut. Der Fokus liegt auf Markus und Kerstin, aber auch Nebenfiguren bekommen Stimmen, die mehr sind als bloßes Beiwerk zur Bereicherung eines Bildes. Die Dialoge wirken unangestrengt; sie vermeiden große Gesten und setzen auf kleine Zeichen – ein Zögern, ein Ausweichen, ein Wiederholen. Viele Szenen bleiben still: ein Warten im Café; ein Gang durch die Wohnung des Täters; ein letzter Satz der Großmutter, der eine tröstliche, aber falsche Welt noch einmal festhält: »Sofie tanzt.«
In Wagners Werk steht der Roman an einer klaren Naht. Aus seinen bekannten Kriminalromanen bringt er die Fähigkeit mit, Situationen auf ihren Kern zu reduzieren; zugleich entfernt er sich vom Genre und folgt seinem Interesse an den inneren Prozessen seiner Protagonisten. Auch diese Entwicklung zeugt von Konsequenz: psychologisches Erzählen statt kriminalistischer Logik. Immer wieder zeigt sich bei seinen Charakteren, wie unterschiedlich Menschen einen Bruch verarbeiten – aktiv, passiv, nach außen, nach innen, fliehend oder suchend. Dass diese Wege ein Paar nicht zusammen-, sondern auseinanderführen, macht »Eden« schmerzhaft deutlich.
Nicht alles überzeugt. Markus’ Entschluss, die Familie des Attentäters aufzusuchen, und seine späteren Verdächtigungen gegen den Bruder berühren die Grenze der Plausibilität. Die Einbindung gesellschaftlicher Reizthemen – Corona, AfD, das gerade umstrittene Schlagwort »Remigration« – wirkt streckenweise zu absichtsvoll, als müsse die tagesaktuelle Note noch ›dazu‹ zur Bewältigung privaten Leids. Wo der Roman jedoch bei seinen Kernfiguren bleibt, ist er stark. Dann fügen sich die Motive: die Versuchung der Instrumentalisierung; die Anständigkeit, die im Lärm mühsam ihre Stimme sucht; der Wunsch, einer Persönlichkeit gerecht zu werden, ohne die Tat zu relativieren.
Stilistisch setzt Wagner auf Zurückhaltung. Die Sprache ist schlicht, die Sätze sind klar, das Tempo ist ruhig. Der Text erklärt nicht, er zeigt. Dadurch entstehen Räume, in denen Leserinnen und Leser ihre eigenen Deutungen prüfen können. Einfache Antworten verweigert der Roman nachdrücklich; er notiert, was geschieht, wenn eine Familie vom Rand her erodiert. In dieser Weigerung liegt seine Ehrlichkeit.
Auf einer zweiten Ebene spiegelt »Eden« bekannte Muster unserer Gegenwart: die schnelle Besetzung von Ereignissen durch Politik und Medien, die Konkurrenz von Deutungen, der Sog der Talkshows, Foren, Social-Media-Apps. Markus’ Auftritt im Studio gehört zu den stärkeren Passagen, weil er mechanische Empörungstheatralik nicht bedient und damit beinahe sprachlos bleibt. Der Roman gibt dieser Sprachlosigkeit Raum – und findet in ihr dennoch einen Satz, der trägt: weiter fragen, weiter sprechen, nicht aufhören, den anderen als Menschen zu sehen.
Am Ende steht kein Trost, der das Geschehene klein macht. »Eden« zeigt, dass Versöhnung – wenn sie überhaupt eine Option ist – nicht in die Vergangenheit reicht. Der Roman setzt auf das, was Sofie zu Lebzeiten verkörperte: soziale Lebenskraft, Zuwendung, das Beharren auf Gespräch. Das ist wenig und viel zugleich. Es rettet niemanden; aber es verhindert, dass der Bruch das letzte Wort bekommt.
»Eden« ist damit kein Krimi über einen Anschlag, sondern ein Roman über Trauerarbeit in einer polarisierten Gesellschaft. Er erzählt von Eltern, die ihre Sprache verlieren, und von einer Öffentlichkeit, die zu laut ist, um ihnen zuzuhören. Wo der Text sich auf das Konkrete beschränkt, überzeugt er durch Genauigkeit und Takt. Wo er das Zeitgeschehen anheftet, bleibt er an wenigen Stellen erklärend. Insgesamt aber ist »Eden« ein stilles, ernstes Buch, das den Leser nicht entlässt mit ›Lebensregeln‹, sondern mit der schwereren Aufgabe, den Ambivalenzen standzuhalten – im Privaten wie im Öffentlichen.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Herbst 2025 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: