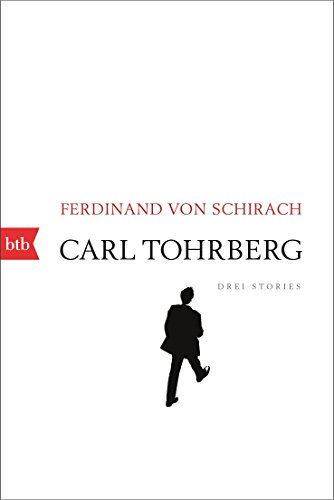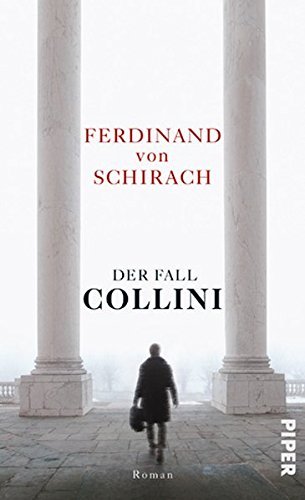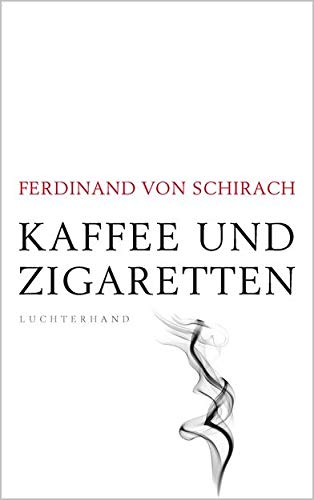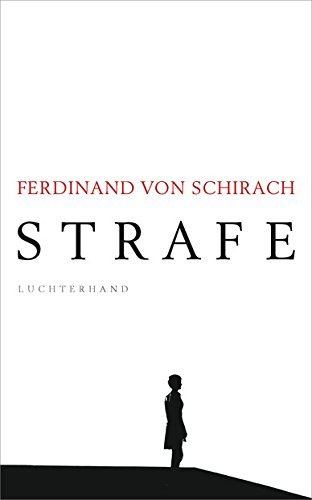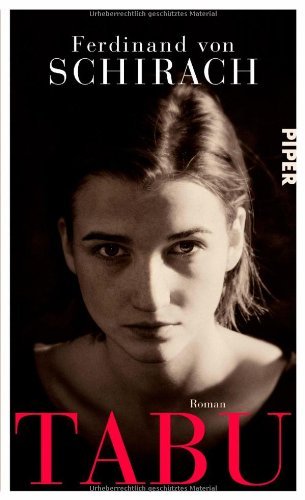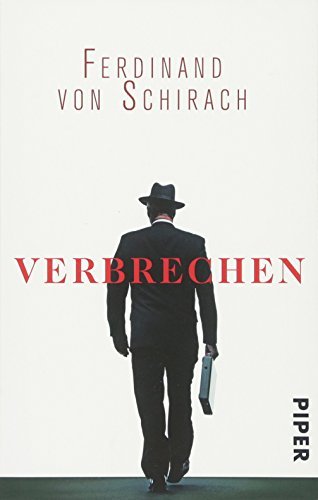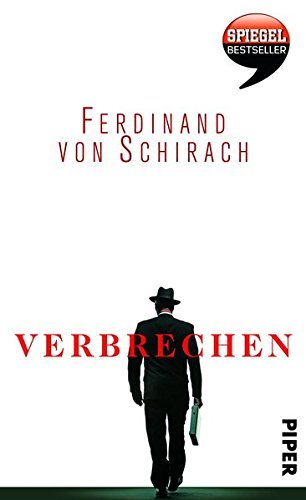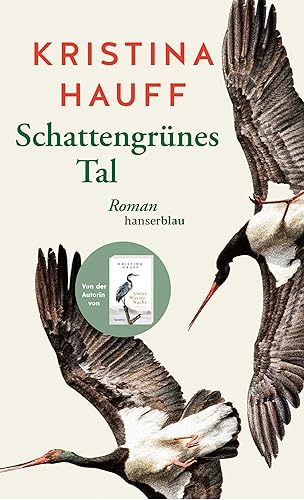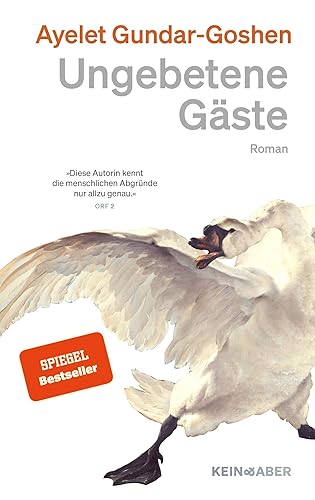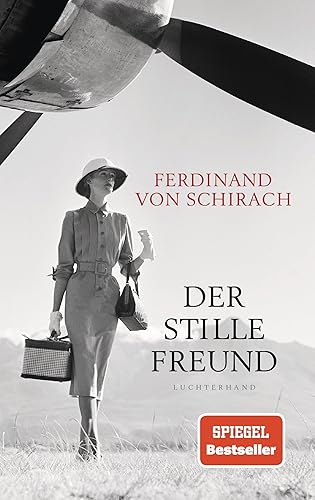
Der stille Freund
von Ferdinand von Schirach
Ferdinand von Schirachs neuer Band fasziniert mit prägnanten Erzählungen, Skizzen und Essays: starke Figuren, harte Konflikte, pointierte Schlüsse. Ein distanziert beobachtendes Ich berichtet im präzisen Minimalstil – ohne Urteil, ohne Lebensregeln. Die Ambivalenzen bleiben offen; genau daraus bezieht das Buch seine Wirkung.
Kleine Formen, große Fragen
Vierzehn Texte, ein Band: Ferdinand von Schirach versammelt in »Der stille Freund« kurze Erzählungen, Miniaturen und knappe Betrachtungen. Die Ereignisse tragen sich in unterschiedlichen Jahrzehnten und an sehr verschiedenen Orten zu, und doch wirkt das Buch keineswegs zersplittert. Der rote Faden ist der Blick eines Ich-Erzählers, der erzählt, ohne zu dozieren, der Fragen stellt, ohne sie zur Prüfung zu stellen. Er hört zu, protokolliert, ordnet sparsam – und überlässt dem Leser die letzte Deutung.
Auffällig ist das Personal. Viele Figuren stammen aus gebildeten, souveränen, weltläufigen Milieus; sie bewegen sich selbstverständlich zwischen Hotels, Museen, Villen, Konzertsälen, Clubs und guten Restaurants. Dieses Umfeld schafft einen kühlen, kontrollierten Abstand, als schaue man aus einem hellen Salon auf die Zumutungen der Welt. Mitunter gerät das ins Zurschaustellen: ein Grundrauschen von Namen und Orten, das nichts erklärt und doch immer ein erlesenes Hintergrundsäuseln bereitstellt. (Da Schirach durchgängig aus der Ich-Perspektive schreibt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie viel Autobiografie im Erzähler steckt – und wie viel bewusst gesetzte Rolle. Letztlich ist sie irrelevant.) Gleichzeitig ist gerade dieses Setting der ideale Resonanzraum für plötzliche Risse – für das Moment, in dem eine Biografie kippt.
Schirach erzählt in seiner bekannten Prägnanz: Sätze, die nicht schwingen wollen, sondern passgenau sitzen. Szenen, die mit zwei, drei Strichen ein Set vors Auge rufen, auf dem sofort gedreht werden könnte. Ein Rückraum aus juristischer Präzision und literarischer Ökonomie. Darum reichen ihm 100 bis 200 Seiten, um ganze Lebensläufe anzureißen und explosionsartig Konflikte unterschiedlichster Kategorien freizulegen. Man liest schnell – und trotzdem verweilt man immer wieder.
Die Bandbreite der Stoffe ist groß: Schuld, Recht und Strafe; Gewalt in vielen Facetten; Verrat und Loyalität; die leisen Zonen von Freundschaft, Sehnsucht, Hoffnung. Neben Gegenwartsszenen stehen historische Miniaturen. Schirach zeichnet etwa ein knappes, zugleich emphatisches Porträt des österreichischen Literaten, Journalisten, Kulturphilosophen und Theatermannes Egon Friedell (1878-1938); er betreibt forensische Annäherung an den Wiener Architekten Adolf Loos (1870-1933), einen Wegbereiter der modernen Architektur, und andere Künstler, deren sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen bekannt sind – und interessiert sich nicht für den skandalträchtigen Aspekt ihres Handelns, sondern für die weit umfassendere Frage, ob und wie das Werk eines Künstlers durch sein fragwürdiges oder verbrecherisches Handeln belastet ist. Das alte Thema »Werk und Autor« bekommt hier einen konkreten Fall, der die bequemen Antworten brüchig macht. In einer anderen Geschichte wird der Tennisspieler Gottfried von Cramm (1909-1976) mit einem Akt des Fair Play zu einer Figur, an der die Möglichkeit des Anstands vermessen wird: kein Heldenkitsch, aber eine Erinnerung daran, dass konsequentes Handeln gegen alle Bedrohung möglich ist.
Politische Aktualität tritt nur in einigen Texten in Erscheinung – am deutlichsten der 7. Oktober 2023 mit den sich anschließenden Propaganda- und Verschwörungswellen. Schirach stellt hier eine ganze Serie von Ereignissen zusammen, garniert sie mit eigenen Beobachtungen und sparsamen Kommentaren – und George Orwell als Referenz (»Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, so stellen Sie sich einen Stiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt – unaufhörlich.«). Ganz ungewöhnlich endet dieser Essay in einer eindeutigen, drastischen Schlussfolgerung: »Diese Stiefel sind heute die sozialen Medien.«
Die stärksten Erzählungen sind die, in denen ein klarer Konflikt auf engstem Raum steht. So beginnt ein Stück (»Fehler«) als psychologischer Fall und wechselt abrupt die Richtung, ohne den Plot-Twist auszukosten: Der Effekt entsteht nicht durch die Volte, sondern durch die Erkenntnis, wie dünn unsere Erklärungen werden, sobald ein Detail nicht mehr passt. Eine weitere kurze Geschichte erzählt eine Koinzidenz, die nach tiefer Ordnung riecht: Ein Mann, der im Leben vieles falsch gemacht hat, kommt ausgerechnet dann ums Leben, als er einmal richtig handelt. Der Text lockt uns zur moralischen Deutung eines verdienten Schicksals – und verweigert sie im letzten Moment. Der Erzähler berichtet lediglich einen bemerkenswerten Fall, ohne daraus eine Lehre ziehen zu wollen oder zu können: Das Leben lässt sich nicht systematisieren. Die titelgebende (und umfangreichste) Erzählung geht auf einen alten Freund zurück. Sie zeigt einen Mann auf lebenslanger Sinnsuche: vom Glauben zur Philosophie, von dort zu den Naturwissenschaften – und schließlich zu einer einfachen, seltsamen Evidenz, die sich nicht mehr in Theorien fassen lässt: dem gelebten Augenblick als einem Platz, zu dem man zurückkehren kann, um Frieden zu finden.
Über diese Spannweite hinaus mischt der Band Formen. Neben Erzählungen stehen knappe Feuilletons, daneben reine Skizzen. Alle Texte sind für sich lesbar, das Buch muss nicht der Reihe nach konsumiert werden. Das macht die Lektüre abwechslungsreich und leicht portionierbar. Man hält hier und da kürzer inne, anderswo länger; manche Stücke tragen als »Fälle« weiter, andere wirken wie vorsatzzentrierte Konstrukte, die man zustimmend registriert, um dann weiterzuziehen. Dass nicht jede Miniatur denselben Nachhall hat, gehört zu diesem Format.
Stilistisch bleibt Schirach sich treu: kein Schmuck, keine Hektik, sondern Kürze, Genauigkeit, Zurückhaltung. Der Ton ist undramatisch, bisweilen tatsächlich medizinisch analytisch – selbst dort, wo es wehtut. Die Bilder sind klar, die Details gewählt: eine Handbewegung, ein Satz, der zu groß oder zu klein ist für die Situation. Mehr braucht es oft nicht, damit ein Lebenslauf ins Stolpern gerät. Wer verfilmte Umsetzungen seiner Texte kennt, wundert sich darüber nicht: Sie scheinen bereits mit Kameraachsen im Kopf geschrieben.
Hinter all dem steht ein Grundmotiv, das erst am Ende richtig sichtbar wird. Der Band bietet keine Regeln an, kein Geländer für die ganz großen Fragen. Stattdessen spricht jede Geschichte für sich – und erlaubt doch am Schluss die selben, schlichten Rückfragen: Was ist das Leben? Warum glückt ein Leben, während ein anderes scheitert? Gibt es für Schuld und Gnade so etwas wie Waagschalen – oder nur Augenblicke, die wir kaum fassen können? Schirach liefert keine Antworten, die man an die Wand hängen könnte. Er zeigt uns Menschen in Entscheidungsmomenten, und er zeigt, wie dünn die Begriffe werden, wenn wir uns strikt auf das Konkrete, Sichtbare beschränken.
Übrig bleibt ein Buch, das man in zwei Abenden lesen kann und das länger nacharbeitet, als seine Seitenzahl vermuten lässt. »Der stille Freund« zeigt den Autor als konzentrierten Erzähler, der mit knappen Mitteln ganze Lebensräume öffnet; als Beobachter, der dem Leben Texte ablauscht; als Suchenden, der sich nicht hinter Thesen versteckt. Die stärksten Stücke tragen den Band mühelos. Und auch dort, wo die Form ins Essayistische kippt oder das Milieu ein wenig zu sehr glitzert, bleibt genug Substanz: Fragen, die man nicht abschließt, und Figuren, die man nicht so schnell vergisst.
 · Herkunft:
· Herkunft: