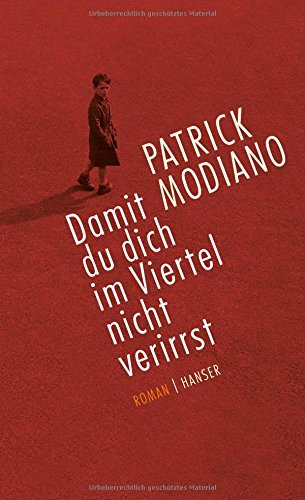Ausgegrabene Lebenswege
»Alain! Was suchst du denn? Ich kann es nicht leiden, wenn du meine Sachen anfasst!« Die mahnende Stimme der Mutter vernimmt der längst erwachsene Sohn noch zehn Jahre nach ihrem Tod, als ihn auf einmal der Drang überkommt, die elterliche Wohnung aufzuräumen.
Im Keller findet er Kartons voller Papiere, Briefe in Jiddisch und Polnisch, ein paar Fotos – allesamt »einzigartige Dokumente«, aber doch nur Bruchstücke von Lebenswegen. Er beschließt, die ganz persönliche Geschichte seiner Eltern und Vorfahren aufzuschreiben, so lückenhaft sie bleiben muss. Entstanden ist eine sehr späte Hommage, die auch eine Suche nach der eigenen Identität des Autors darstellt, schwebt über allem doch die Frage, wieviel von den alten Traditionen, Denkweisen, der Kultur und Religion auch in ihm steckt. Und obwohl der Autor vorausschickt, dass er sein bescheidenes Material mit »Mutmaßungen« anreichern müsste, wollte er »den großen europäischen Roman« schreiben, und sich lieber auf »eine vage Skizze« beschränken will, hat die Familienchronik des Alain Berenboom natürlich auch repräsentative Relevanz für die »Geschichte des 20. Jahrhunderts«.
Die Wurzeln der Familie liegen in Osteuropa. Chaïm Berenbaum kommt 1907 in Maków, Polen, auf die Welt. Nach Schule und Wehrdienst verlässt er 1928 seine Heimat, um an der Universität Lüttich Pharmazie zu studieren. In seine Apotheke in Brüssel tritt eines Tages die »schönste Frau der Welt«, in die er sich auf den ersten Blick verliebt. Rebecca wurde 1915 im russischen Wilna geboren. Weil ihr als Jüdin nach dem Abitur ein Universitätsstudium verwehrt wurde, ging auch sie ins Ausland. 1940 heiraten die beiden.
Im Gegensatz zu vielen Juden und auch dem größten Teil der engsten Familienangehörigen überlebt das junge Paar die Zeit der deutschen Besetzung. Als Ende Oktober 1940 die Anordnung ergeht, dass sich alle Juden melden müssen, lässt sich Chaïm noch »eilfertig in dieses verdammte Register eintragen«, obwohl er, »der Atheist, der Linke, der Kosmopolit«, der »seit seinem Weggang aus Polen nie mehr in einer Synagoge war«, doch von den Schikanen gegen die jüdische Bevölkerung in Hitler-Deutschland wusste. Erst später versucht er sich der Überwachung zu entziehen, spielt Katz und Maus mit den Behörden, wechselt mit Rebecca ständig die Wohnung, sie nehmen neue Namen und Identitäten an, geben sich wie typische Belgier. Chaïm engagiert sich in der belgischen Résistance, beschafft gefälschte Papiere für Flüchtlinge, gibt militärische Informationen weiter und hält Kontakt zur Organisation Pol, der Groupe Général de Sabotage. Dass er diesen lebensgefährlichen Tanz auf des Messers Schneide riskiert, rechtfertigt den Spitznamen, den ihm einmal ein Freund gab und den sein Sohn zum Titel seines Buches machte: »Monsieur Optimist«. Angesichts der ständig perfektionierten Verfolgungsmechanismen der Besatzer, denen er rein zufällig immer wieder entkommt, könnte man ihn allerdings auch als naiven Glückspilz ansehen ...
Nach dem Ende des Krieges, 1947, wird Alain, das einzige Kind der Berenbooms, geboren. Wohlbehütet wächst er in der kleinen Familie auf. Was Vater und Mutter während des Krieges durchmachten, wie die Verwandten in Polen gelebt hatten, darüber sprechen die Eltern nicht. »Die Kriegsjahre? Ausradiert, wie mit Chlorbleiche entfernt.« Die Vergangenheit bleibt ein vor dem Jungen wohlgehütetes Geheimnis; sie interessiert den Heranwachsenden auch nicht sonderlich. Sein Vater Chaïm stirbt im Januar 1979 an einer Herzattacke, Mutter Rebecca folgt ihm erst im Jahre 2001.
Die fragmentarische Eigenart von Ausgangsmaterial und seiner Verarbeitung schlägt sich in der zwanglos-leichten Form der Chronik nieder. Der Autor erfasst in kurzen Kapiteln von wenigen Seiten in beschaulichem Plauderton, was er erkundet hat. Manche kurze Episoden gestaltet er szenisch aus, andere Phasen fasst er berichtend zusammen, bindet seine eigenen Erlebnisse und Erinnerungen ein. Immer bewahrt er kritische Distanz zu seinem Stoff, den er freimütig kommentiert und dabei mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. In innigem Dialog mit dem Leser (»können Sie mir folgen?«) regt er immer wieder durch Fragen zum Nachdenken an – über das Verhalten seiner Familienmitglieder, belgische Kollaborateure (»Vogel-Strauß-Politik«), die politische Entwicklung, seine eigene Position. Darf er sich das Recht herausnehmen, über Menschen in Situationen zu urteilen, die er selber nie erlebt hat? Seine Eltern, deren Geschwister und Großeltern durchlitten »am eigenen Leib ... den Hass der Deutschen wie den der Polen und der Russen.« »Habe ich das Recht ..., über Gut und Böse zu entscheiden, so undifferenziert, wie mein Vater und meine Mutter es taten?«
Der Autor macht im Ton kaum einen Unterschied, ob er Alltagsroutine, Privates oder Todernstes referiert. Die Kapitelchen tragen harmlose, teilweise wunderliche Überschriften, die wenig erkennen lassen, was für Inhalte damit bezeichnet werden: »Das ungelöste Rätsel der zersägten Frau«, »Das letzte Phantom«, »Ein Bürgermeister vermisst seinen Kanal«. Manche augenzwinkernd gemeinte Darstellung mag sogar befremden (»Wenn die Deutschen [anstatt aller Personen jüdischer Rasse], sagen wir mal, alle Kurzsichtigen, Kropfigen, Einbeinigen, Stotterer oder Tollpatsche verpflichtet hätten, sich einzutragen, ob sie wohl auch alle gehorcht hätten?«)
Dass die erzählten Schicksale den Leser tief berühren, ist also nicht der Gestaltung geschuldet. Der Autor verzichtet auf jegliche Dramatisierung. Es ist das einfache, karge Leben dieser Menschen in einer uns in vieler Hinsicht fernen, kaum verständlichen Zeit, das uns nicht gleichgültig lässt. Großmutter Frania etwa wurde, wie damals üblich, von ihren Eltern verheiratet. Ihr Leben im Maków der Vorkriegsjahre ist von eisigen Wintern, Geldsorgen und Repressionen geprägt. Ihr Mann Aba, der einen Krämerladen betreibt, führt ein unnachgiebiges Regiment, ausgerichtet an den strengen Regeln des orthodoxen Judentums. Er ist bigott, konservativ und starrsinnig. Das Paar hat zwei Söhne (Chaïm und seinen Bruder) und zwei Töchter, Esther und Sara. Chaïm und Esther flüchten aus der Enge ihres Zuhauses ins Ausland. Zeitweise lebt auch Sara in Brüssel, bis der Vater sie zurück nach Polen beordert. Die gehorsame Tochter folgt dem Ruf. Der Zeitpunkt ihrer Heimkehr ist allerdings denkbar schlecht, denn Deutschland hat soeben Polen besetzt. Saras letzter Brief, den Alain in den Kisten im Keller findet, stammt aus Warschau, vom 29. Juli 1942 ...
Alain Berenboom ist Professor für Urheberrecht an der Universität Brüssel. 1990 veröffentlichte er seinen ersten Roman, »La Position du missionnaire roux«. »Monsieur Optimiste« (2013), mit dem belgischen Literaturpreis Prix Victor Rossel ausgezeichnet und von Tanja Graf und Helmut Moysich als erstes seiner Werke ins Deutsche übersetzt, ist eines von vielen Zeitdokumenten, die Familienangehörige nach Kriegsende erschlossen und veröffentlicht haben. Jedes für sich stellt ein bereicherndes Puzzleteilchen der dunkelsten Zeit unserer Historie bereit. Alain Berenboom hat aus den wenigen persönlichen Hinterlassenschaften, die er vorfand, seine Familie auf eine besonders individuelle Weise geehrt.
 · Herkunft:
· Herkunft: