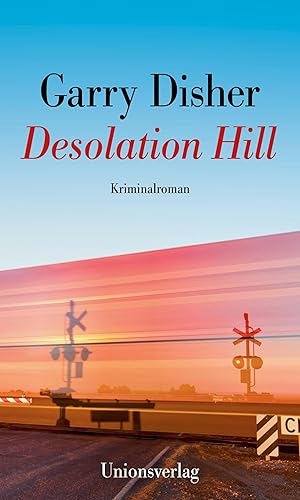Der Gott des Waldes
von Liz Moore
Eine Dreizehnjährige verschwindet spurlos aus einem Sommercamp in den Wäldern Neuenglands. Die Versuche, das Rätsel zu lösen und sie wiederzufinden, sind ebenso faszinierend wie das, was wir über ihre Familie, das Leben und die Menschen im Camp und die amerikanische Gesellschaft erfahren.
Die kleine Punkerin aus bestem Hause
Die Adirondack Mountains im Nordosten des Bundesstaats New York sind ein nahezu kreisförmiges Gebirge von über hundert Gipfeln. Das Massiv mit seinen Wäldern, unzähligen Seen und Flüssen ist ein riesiges Naturreservat. Amerikaner, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder während der Ferienzeit gern zu summer camps in solch zivilisationsfernen Gegenden. Dort sind die Tage streng durchstrukturiert, die Kinder und Jugendlichen werden kernig erzogen, lernen Gemeinschaftssinn in kleinen und großen Gruppen und viel über die Natur, bis hin zu Regeln, wie man darin überlebt. Auch im Camp Emerson, dem Schauplatz der Handlung von Liz Moores Roman »Der Gott des Waldes«, sind sie überall im Lager aufgehängt, damit sie in Fleisch und Blut übergehen, und am Ende der Zeit steht, sozusagen als Bewährungsprobe oder Abschlussprüfung, ein »Survival Trip«.
Wie man in den wilden Weiten Amerikas überlebt, kennen auch wir Europäer aus einschlägigen Büchern und Filmen. Eine Grundregel dafür besagt, niemals in Panik zu geraten, also niemals Pan, dem griechischen »Gott des Waldes« zu verfallen. Im Klartext bedeutet das zum Beispiel: »Wenn du dich verläufst: setz dich hin und schrei!« Damit bekommt man einen klaren Kopf.
Camp Emerson gehört mitsamt den umliegenden Wäldern und Ländereien der Bankiersfamilie Van Laar aus Albany, die im Sommer etwas abseits in einem riesigen Haus residiert. Wie der Olymp thront es auf einem Hügel und ist beeindruckender Rahmen für rauschende Feste, zu denen reiche Bekannte und Geschäftspartner in ihren Nobelkarossen anreisen. Am anderen Ende der Luxus-Messlatte rangiert das Jugendlager, das die Familie vor etlichen Jahren mit Hilfe eines Wildhüters angelegt hat und wo ihre Angestellten seither jeden Sommer gut besuchte Kurse veranstalten.
Im Jahr 1975 ist es nichts Besonderes, dass auch Barbara, das dreizehnjährige Töchterchen der Eigentümer, den Sommer im Camp verbringt. Jedoch ist es eine Katastrophe, dass sie eines Morgens nicht mehr aufzufinden ist. Selbstverständlich werden sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie aufzuspüren, doch vergebens.
Bitterer Zufall oder zynische Absicht eines eiskalten Verbrechers? Auf den Tag genau vierzehn Jahre zuvor, am 10. Juli 1961, ist Peter, der damals achtjährige Erstgeborene der Van Laars, ebenfalls aus dem Ferienlager verschwunden. Dass das Kind trotz groß angelegter Suchaktion nie gefunden, die Umstände seines Verschwindens nie aufgeklärt wurden, hat die Eltern und Großeltern schwer belastet, bis sich ein dunkler Schatten des Schweigens über den Schicksalsschlag ausbreitete. Und nun trifft sie, noch immer in tiefem Leid gefangen, das gleiche Verhängnis ein zweites Mal mit ihrem Mädchen.
»Der Gott des Waldes« (»The God of the Woods«, übersetzt von Cornelius Hartz) ist von Anfang an ein packender Thriller, und der Plot ist raffiniert genug, um die Spannung bis zum erlösenden Ende aufrechtzuerhalten. Auf fast 600 Seiten entfaltet Liz Moore eine komplexe Handlung mit einer Vielzahl von Personen, die wechselnde Perspektiven und verschiedene Zeitebenen einbringen. Trotzdem werden wir von einem Sog erfasst, der uns, immer wieder aufgefrischt durch geschickt gesetzte Cliffhanger und durch keine sprachlichen Ansprüche gemindert, über die Zeilen hinwegfliegen lässt.
Bemerkenswert ist, wie der Roman an Tiefgang gewinnt, je weiter die Handlung fortschreitet, je genauer wir die Charaktere und ihre Beziehungen kennenlernen. Vielleicht ist dies das zusätzliche Etwas, das Barack Obama veranlasst hat, diesen Roman in seine Lektüreliste 2024 aufzunehmen.
So ist das Verhältnis zwischen Barbaras Eltern nur noch eine traurige Formsache. Peter Van Laar hatte die bezaubernde Alice Ward 1950 auf einem Debütantinnenball kennengelernt und sogleich seiner Familie vorgestellt. Nachdem die Siebzehnjährige dort, so schien es ihr, als »Konsumgut« taxiert worden war, fand zwei Monate später die Hochzeit statt, und neun Monate danach kam Peter IV, der Stammhalter, auf die Welt. Klein, pummelig und mit Flaum auf dem Kopf nannten ihn alle »Bear«.
Damit hat Alice erfüllt, was die Familie von ihr erwartet hat: Die Liebes-»Investition« hat sie mit einer »Gegenleistung« amortisiert und ist damit eigentlich überflüssig geworden. Ehemann Peter III betrachtet sie ohnehin als dümmliches Wesen, das er erst noch aufwändig optimieren muss, bis sie bei seinesgleichen durchgehen kann. Manches Mal, wenn er in den ersten Ehejahren seine Hand über ihren Kopf streichen ließ, bedachte er ihren »Mangel an gesundem Menschenverstand«, und ein Seufzer begleitete die liebevolle Geste. Später machten ihn ihre Fehler wütend. Er brüllte sie an, mäkelte an ihr herum, dass sie beispielsweise bei Partys »langweilig« herüberkomme, und empfahl ihr als Hilfsmittel, um sich zu lockern, ein paar Drinks zu konsumieren. Ein Ratschlag mit fatalen Konsequenzen.
So führt Alice ein einsames Leben ohne Anerkennung, ohne Liebe, ohne Vertraute. Aber in Bear findet sie ihr großes Glück, zumal sie auch Peter durch die engagierte Art, wie er den Jungen erzieht, mehr zu schätzen lernt. Bears Verschwinden entzieht ihr den Boden unter den Füßen.
Mit Barbara, ihrem zweiten Kind, erhofft sich Alice eine zweite Chance. Doch das Mädchen ist eigenwillig, widerspenstig, schwer zu handhaben. Sie wendet sich gegen alle Konventionen, liebt Punk, kleidet sich ganz in Schwarz. Peter, immer auf sein gesellschaftliches Image und das der Familie bedacht, gerät über die Provokationen in Rage, und Alice kann sie weder vor dem herrschsüchtigen Vater schützen noch ihr die notwendige Liebe schenken.
Nachdem nun auch ihr zweites Kind spurlos aus Camp Emerson verschwunden ist, sind die Eltern entschlossen, alle Register zu ziehen, um den Fall aufzuklären. Da mag Judyta Luptak, die zuständige lokale Polizistin, eine noch so herausragende Karriere vorweisen können, die Van Laars sind nicht geneigt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Vielmehr schalten sie ihren persönlichen Anwalt ein, und bald reist der geschätzte Captain LaRochelle aus Albany an, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sein Augenmerk richtet sich auf den »Schlitzer«, einen kürzlich aus der Haft entflohenen Mörder. Und was hat es mit den Geschichten auf sich, die seit Jahren im Sommerlager kursieren? In den Wäldern spuke ein weiblicher Geist (»Scary Mary«) herum …
Liz Moores spannendes Familiendrama erstreckt sich über mehrere Zeitebenen zwischen 1950 und 1975 und lässt dabei kein gutes Haar an den Menschen aus der Oberschicht. Schon die Urgroßeltern Van Laar waren vermögend und sicherten Teile des Naturparks exklusiv für sich. So nutzen nun seit vier Generationen egozentrische, rücksichtslose, arrogante und unsympathische Individuen die Segnungen der Natur, um ausschweifende Partys zu feiern, zu protzen und Macht und Einfluss zu festigen. Ihre Angestellten lassen sie deutlich spüren, wohin sie gehören und wozu sie nützlich sind. Nicht nur Besitz, sondern auch Recht und Freiheit sind in der Zweiklassengesellschaft im Ungleichgewicht.
Am Beispiel von Alice führt die Autorin außerdem die Rolle der Frauen vor Augen. Ihr liebloser Mann betrachtet sie respekt- und verständnislos als peinliche Versagerin und Fehlgriff; mit seiner Kaltherzigkeit und seinen Demütigungen treibt er sie in die Verzweiflung.
Auf der anderen Seite erkämpft sich die Polizistin Judyta Luptak entschlossen, aber mühsam ihre Anerkennung. Die stärkste weibliche Person ist sicher Barbara, die Jüngste in der Van-Laar-Dynastie. Schon äußerlich widersetzt sie sich als Punk allem, was die Familientradition fordert, und ist eine lebende Herausforderung gegenüber ihrem Vater. Im Camp Emerson nimmt sie sich (wenn auch im Verborgenen) jedes Recht heraus – und würde das wohl auch tun, wenn sie nicht in so privilegierter Position wäre.
Das beschriebene Gesellschaftsbild ist natürlich ein Stereotyp, und Liz Moore beliefert uns nur mit altbekannten Klischees und Pauschalurteilen. Da es sich aber um einen gut erzählten Unterhaltungsroman handelt, der in erster Linie von den dramatischen Erlebnissen und bewegenden Erfahrungen seiner Charaktere lebt, lässt man sich gern mitreißen und hängt den Wert der flachen sozialpolitischen Aussage nicht zu hoch.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2025 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: