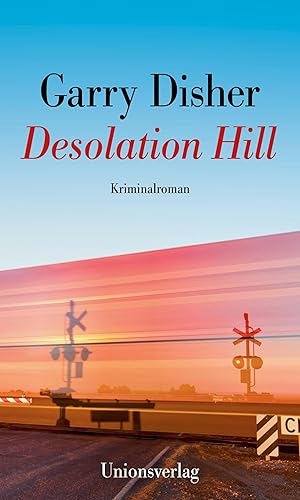Keine Kleinigkeit
von Camilla Barnes
Fünfzig Ehejahre haben „Mum und Dad" ge- und verformt. Sie sind an Körper und Geist noch einigermaßen fit, gebildet, exzentrisch und darin bisweilen amüsant, aber ihre vergifteten Kämpfe bringen Tochter Miranda zur Verzweiflung. Nach und nach muss sie ergründen, was für Ereignisse in der Vergangenheit bedeutsam waren – eine mühselige und schmerzvolle Arbeit, die Überraschungen birgt und Tragisches offenlegt.
Kalaschnikow ja, Uzi nein
In jungen Jahren schon ist Miranda, inzwischen bald fünfzig Jahre alt, aus England nach Paris gezogen. Getrieben hat sie der Wunsch, dort Schauspielerin zu werden, aber es war auch ein Versuch, ihren diffizilen Eltern zu entfliehen. Unerwarteterweise verabschiedete sich zehn Jahre nach Mirandas Exodus ihr Vater, Philosophieprofessor in Oxford, frustriert in den Vorruhestand, und auch die Eltern ließen sich in Frankreich nieder. Sie kauften ein heruntergekommenes altes »Manoir« in der Provinz und widmeten sich dem einfachen Landleben. Dad, mittlerweile Ende 70, kümmert sich um seine Katzen, Enten, Hühner und ein Lama-Pärchen. Mum, etwas jünger, hat den Haushalt im Griff und wacht penibel darüber, dass ihr engmaschiges Regelwerk nicht missachtet wird.
Alle paar Wochen besucht Miranda mit ihrer Tochter Alice, knapp 20 und angehende Chemie-Studentin in Paris, die (Groß-)Eltern auf dem Lande. Mit Wehmut beobachtet Miranda, die Ich-Erzählerin, wie die Eltern in eingefahrenen Verhaltensritualen erstarren und gefangen sind, und sie verzweifelt an ihrer eigenen Hilflosigkeit gegenüber dieser Entwicklung. In manchen Situationen ist die Zwietracht nicht auszuhalten, doch Miranda sieht sich zu diesen Besuchen verpflichtet, »schon um mich zu vergewissern, dass keiner den anderen umgebracht hat«.
In letzter Zeit hat Mum ziemlich abgebaut. Sie kann sich auf ihre Erinnerungen nicht mehr so verlassen wie einst. Damit entspannt umzugehen fällt ihr schwer, vor allem bei Auseinandersetzungen mit ihrem Mann. Wenn sie sich einen Irrtum eingestehen muss, empfindet sie das als Niederlage und versucht, sie durch abrupten Themawechsel, plumpes Beharren oder Lavieren wegzudrücken. Auch ihre Schmerzen verdrängt sie lieber schweigend, als sich der Wahrheit zu stellen. Jammern und sich beklagen ist nicht ihre Art – lieber präsentiert sie sich still leidend in einem »Schaumartyrium«.
Körperlich hat Dad nicht minder abgebaut, wenngleich er sich noch immer zutraut, Holz zu hacken und Brombeersträucher auszugraben (»Gandalf in Gummistiefeln«). Doch wildwuchernde Kletterpflanzen, Staubmäuse, tote Insekten, vergammelte Lebensmittel, fleckige Kleidung, vernachlässigte Hygiene und ignorierte Krankheitssignale belegen, dass Alltag und Anwesen die beiden überfordern. Hoffnungslos verfahren sind die Probleme um Dads nachlassendes Hörvermögen. Wenn er die Zurufe seiner Frau von irgendwoher nicht versteht, macht sie ihm wenig hilfreiche Vorwürfe, denn sie ist fest davon überzeugt, dass er alles hört und seine Schwerhörigkeit nichts anderes ist als »ein Mangel an Bemühen«. Tatsächlich kann Dad seinen Defekt durchaus taktisch einsetzen. Wenn das kommunikative Terrain schwierig wird, bleibt das Hörgerät liegen.
Seine geistigen und verbalen Fähigkeiten hat Dad jedoch kein bisschen verloren. Schlagfertigkeit, Präzision und rhetorische Modulation seines Ausdrucks sind messerscharf wie eh und je. Wenn er Mums begriffliche Unschärfen auseinandernimmt, seinen intellektuellen Paraden und logischen Spitzfindigkeiten freien Lauf lässt und der einzigartige britische Humor zwischen Anspielungen und Zynismus zuschlägt, verschaffen die Schlagabtausche uns Lesern großes Vergnügen, und auch Miranda findet Spaß darin und kann ihm durchaus Paroli bieten – bis sie sich wieder besinnt, was hinter den Worten abgeht. Die Gefechte werden nicht mit blanken Messern bis zum totalen Zusammenbruch ausgetragen wie einst bei »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?«, doch das kommunikative Gemetzel um Worte, Fakten, Sichtweisen, Missverständnisse, Angewohnheiten und Eigenschaften des Partners zermürbt beide. Der Ausgang ist immer der gleiche: Mum hat keinerlei Zweifel an ihrem Sieg, und Dad, der mit seinen Mitteln der Ratio nie gegen sie ankommt, resigniert. Dass er den Machtkampf längst aufgegeben hat und nichts mehr will als in Frieden gelassen zu werden, ärgert Miranda, und er, der früher oft wütend auf andere Menschen war, ist es jetzt auf sich selbst.
Mums Herrschaft über den Rest der Familie hat sie nur ihrer eigenwilligen Weltinterpretation zu verdanken, an der Fakten und Logik chancenlos abperlen. Ihre eigenen Argumentationsketten sind von logischen Kapriolen, Willkür, Unwahrheiten und Gedächtnislücken beschädigt. Wenn etwas schiefläuft, sagt sie »Ich hab’s ja gesagt.«, als wäre das ein Beweis für ihre Überlegenheit, und Dad kontert »Davon bin ich überzeugt. Aber was?«. Wenn sie ein Gerät nicht richtig bedienen kann, sagt sie, es sei »kaputt«, und was »kaputt« ist, hat Dad kaputtgemacht.
Was einzig zählt, ist, dass sie recht hat und behält. Da kann Dad behaupten, was er will: Sie »weiß« besser als er selbst, was ihm gefällt und schmeckt und was nicht. Sie gewinnt alle Spiele, da sie die Regeln eigenwillig auslegt. Selbst gesicherte Tatsachen (wie das Jahr der Mondlandung) streitet sie ohne einen Anflug von Selbstzweifel ab, sofern sie von anderen vorgebracht werden. Die nehmen ihre schlichten Absurditäten fassungslos zur Kenntnis und wissen aus Erfahrung, dass Dagegenhalten sinnlos ist. Dad räumt sogar nie begangenes Fehlverhalten ein und »lässt sich von ihr herumkommandieren, weil ihm Gegenwehr zu mühsam ist«. Dass Mums Dominanz so unangefochten ist, gibt ihrem selbstgerechten Egozentrismus Auftrieb, doch folgenlos bleibt all das nicht: Hinter Mums Rücken sprechen die anderen Strategien ab, um sie zu halsstarrig verweigerten Notwendigkeiten wie einer Hüftoperation zu verleiten oder vor grausamen Wahrheiten zu schützen. Und manch einen Stoßseufzer in tiefster Verzweiflung (»Ich könnte sie umbringen!«) können wir nachvollziehen.
»The Usual Desire to Kill« – so der Originaltitel – war zunächst als Bühnenstück konzipiert. Dann hat die Autorin den Stoff aber zu einem Roman geformt und einen unterhaltsamen Textsortenmix geschaffen. Vom Drama-Entwurf hat er viele kurze Dialogpassagen und die Gliederung behalten (Prolog, Epilog, fünf Szenen), während die Prosa neben Erzähl- und Reflexionsabschnitten auch Briefe und E-Mails bietet. Darin berichtet Miranda ihrer etwas älteren Schwester Charlotte (die allein in England lebt und nur einmal im Jahr zu Besuch kommt) offenherzig, was sie mit den unverbesserlichen Alten durchmacht.
Ganz ungefiltert, als säßen wir selber dabei, lässt uns die Autorin vielen Wortwechseln aus dem Manoir lauschen. Oft drehen sie sich um – in unseren Augen belanglose – Kleinigkeiten (wessen Teller, dessen Brokkoli?). Derlei aufgebauschtes Gezänk und seine mit Sticheleien und Witz gespickten Ausformulierungen lösen unweigerlich einen Lachreiz aus, doch der weicht zunehmend Mitgefühl und Mitleid angesichts verhärteter Sturheit, Unversöhnlichkeit und Rechthaberei. Auf der Beziehungsebene scheint die Konstellation der Partner irreversibel und traurig: Wo körperlicher und geistiger Verfall zu viele Frustrationen eingefahren hat, sind Erfolge, die das Selbstbewusstsein wieder aufrichten könnten, kaum noch herauszuholen. In der Not bietet sich an, Fiesigkeiten und Machtmittel als Kompensation auszuspielen. Sogar Dads Tiere können ein Lied von den biestig-witzigen Ideen der beiden singen. Mum lässt den Lama-Mann kastrieren, um Dads Zuchtideen zu durchkreuzen, und Dad öffnet ihm das Gemüsegartentor, damit er den verhassten Rosenkohl vernichtet. All das ist dann »keine Kleinigkeit« mehr. (In diesem Zusammenhang ist Dirk van Gunsterens Übersetzung zu loben: Er hat alle Nuancen erfasst.)
Lange Zeit bleibt die Personenkonstellation rätselhaft. Jedenfalls war Miranda wohl das »Lieblingskind« und ihre Schwester (und Rivalin) Charlotte ein »Unfall«. Dann gibt es Tagebucheintragungen aus den frühen Sechzigerjahren an eine »Liebe Kitty«, widersprüchliche Legenden über Großväter und einen »H H« sowie zurechtgeschnittene Schwarzweißfotos. Die Männer aus Mirandas und Charlottes Vergangenheit sind allesamt im »Familiengefrierschrank« weggesperrt, wie auch ein gewisser »James«, der Mum offensichtlich bis heute viel bedeutet, und ein mysteriöser »Vorfall«. Bis all die kleinen und großen Geheimnisse daraus befreit und eisern behauptete, jedoch konfus anmutende Wahrheiten aufgedröselt sind, müssen wir uns gedulden.
Camilla Barnes hat die fiktionale Geschichte einer Ehe zwischen zwei starken Charakteren auf raffinierte und facettenreiche Weise gestaltet. Die Entwicklung zieht sich kaum merklich über Jahrzehnte hin, so dass weder die beiden Partner noch ihnen Nahestehende einzelne Stufen oder Anlässe identifizieren oder zuschreiben können. Es ist ihre Tochter, die erschrickt und leidet, als ihr der fortgeschrittene Verfall in seinem ganzen Ausmaß und in seiner Unveränderlichkeit deutlich wird. Die Kunst der Autorin (deren Onkel, Julian Barnes, ebenfalls Schriftsteller ist) erweist sich darin, wie sie die komplizierte Familiengeschichte eingängig aufbereitet, wie sie dem noch immer erkennbaren Potenzial der Protagonisten gerecht wird, wie sie die komischen Aspekte mit leichter Hand präsentiert, ohne die beiden gereiften Personen der Lächerlichkeit preiszugeben, und wie sie gleichzeitig die Tragik ihrer Entwicklung und ihrer bitteren Gegenwart vorführt, ohne in Pathos zu verfallen.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2025 aufgenommen.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: