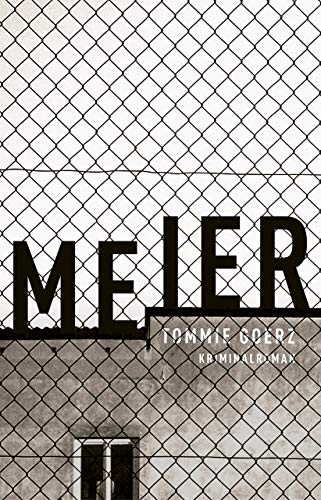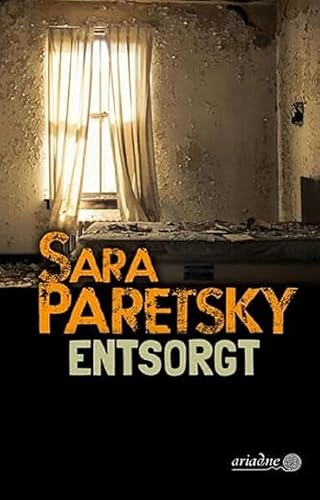Im Schnee
von Tommie Goerz
Ein abgelegenes Dorf im Fichtelgebirge. Schnee fällt. Max, 80, ist nachdenklich. Sein Freund seit Kindertagen ist in der Nacht gestorben, sein Begräbnis wird vorbereitet. Bei den alten Ritualen erzählt man sich von all den Menschen und Ereignissen, die das Leben im Dorf bestimmt haben, von Freuden, Gewissheiten, Glück, Unglück und offenen Fragen. Max wird bewusst, dass dieses Leben jetzt vorüber und er selbst ganz allein ist.
Leben und Sterben im Dorf
»Im Schnee«, der neueste Roman des fränkischen Autors Tommie Goerz, ist (wie etliche seiner Vorgänger) ein Buch von ganz eigener Art, an das man sich herantasten, auf das man sich einlassen muss. Wer sich von seiner gedämpften Winterstimmung, seinem friedlichen Ton, dem bedächtigen Gang der kleinen Handlung einfangen lässt, entdeckt unter der bisweilen spröde wirkenden Oberfläche mit merkwürdigen Charakteren und einer entrückten Lebensweise, hinter Andeutungen, unvollständigen Sätzen und dialektalen Geheimnissen eine ungeahnt reiche Welt an Gefühlen, komplizierten Beziehungen, Weisheiten, Trost, Frieden, beglückender Ruhe.
Keine Sorge: Goerz ist kein Autor, der verharmlost, vortäuscht, einlullt. Sein Roman ist im Fichtelgebirge, einer kargen nordbayrischen Gegend angesiedelt, die noch niemals etwas durchlebt hat, das ihre Bewohner als »gute alte Zeit« verklären könnten. Er spielt in unserer schwierigen Gegenwart, deren Probleme sich auch hier niederschlagen, und außerdem schleppen die Protagonisten (alle im reifen Alter) einen Berg von Erinnerungen und Erfahrungen (schönen und verstörend abgründigen) mit sich, die sie immer wieder einholen und zu Exkursionen in ihre Vergangenheit verlocken. Daran dürfen wir teilnehmen – und werden reich belohnt mit einem sanften, tiefgründigen, zutiefst menschlichen Buch über Lebensläufe und Entwicklungen in einer Dorfgemeinschaft.
»Unter den Apfelbäumen lag Schnee«, so anheimelnd beginnt der überschaubare, atmosphärisch dichte Roman. Max Malter, ehemals Bauer und mit über 80 immer noch rüstig, lebt im alten Teil des Dorfes, gleich hinterm Bahnhof. Er steht am Fenster, sieht still den herniedertänzelnden Schneeflocken zu und schaut auf die alten Bäume in seinem Garten. Der Herd ist geschürt, der Kaffee gemacht, »es hätte ein so schöner Tag werden können«. Aber in der Nacht ist der Schorsch gestorben. (Eigentlich hieß er Georg Wenzel, aber hier wird jeder mit dem dialektal eingefärbten Vornamen plus Artikel benannt. Bei Bedarf tritt noch ein unterscheidendes Merkmal dazu wie der Familienname oder eine Abstammungsbezeichnung – maximal also »der Wenzels Schorsch«.) Ob der ein Vertrauter, ein Gefährte oder ein Freund war, solch subtile Überlegungen huschen schon durch Max’ Gedanken, aber sie sind nicht wichtig. Der Schorsch war halt schon immer da; »fast wie Geschwister« haben sie alles zusammen gemacht, und wenn er zum Max kam, hat der immer geschmunzelt, »so für sich, wie von innen«. Letzthin konnte er sich kaum noch bücken, jetzt ist er tot, und Max ist klar, was das für ihn selber bedeutet: Nun ist »nichts mehr zu tun« für ihn, »und niemand wartete auf ihn«.
Wenn hier einer stirbt, dann löst das uralte Rituale aus. Sie gliedern den Roman und den Ablauf von Max’ Tag. »Der Tod« muss erst Einzug halten in seinem Bewusstsein. Am Abend treffen sich die Männer und halten »Die Wacht«, plaudern über Gott, den Verstorbenen und die Welt, trinken und essen zusammen, bis um Mitternacht die Frauen übernehmen und »Die Nacht« beginnt. Sie machen den leblosen Körper für die anstehenden Zeremonien fein, singen schöne Lieder und tauschen sich ebenfalls über alles aus, was sie, das Dorf und den Toten bewegt hat. »Der Tag« darauf bringt den Gottesdienst und die Beerdigung. Am Ende begleiten wir Max »Im Schnee« und »Am Grab«, wobei diese Ortsangaben nur Türen sind zu den Gedankenwelten, die wir mit dem Protagonisten durchschreiten.
Eben dies ist das Meisterhafte, Zauberhafte, Anrührende an diesem unscheinbaren Büchlein: Seitenlang vertieft man sich in das Leben der Dorfbewohner, das so still und friedlich erscheint wie ein dunkler Waldsee. Sie kommen mit wenigen Worten und über die Jahrzehnte eingespielten Verhaltensweisen miteinander aus, weil man anders nicht einvernehmlich zusammen leben kann in einer so kleinen Welt. Einen Vorschuss an Respekt bekommt erst einmal jeder – jedes Kind, jeder Fremde, auch die Flüchtlinge, die vielleicht bald eintreffen –, aber dann ist an ihnen, sich Anerkennung zu verdienen.
Ein unausgesprochenes Regelwerk von Ritualen, Weisheiten und Sprachgebräuchen bietet Sicherheit und schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und des Geborgenseins. Lesend verstehen wir, was stadtflüchtige Neubürger gern lernen möchten, aber niemand ihnen erklären kann noch will. Man bekommt es im Aufwachsen einfach mit – ›Das macht man halt so‹. Wenn die Kinder etwas Schwerwiegendes falsch machen, setzt es grausame Prügel, aber dann haben sie ihre Lektion gelernt.
Materielle Werte scheinen hier irrelevant. Wer viel Geld verdient, dem sei’s gegönnt. Wer sich aber damit abheben will, der wird gern belächelt oder im Wirtshausgespräch verspottet.
Frauen leben in einer anderen Welt als die Männer. Manche führen das Regiment im Haus, manche sind gleichberechtigte und gleichwertige Partner, wenige werden verprügelt.
Der Wandel der Weltanschauungen geht an diesem Dorf ohne tiefgreifende Effekte vorüber, nicht aber der der Wirtschaft und der Infrastruktur. Man muss sich ohne Bäcker, ohne Metzger, ohne Schuster, ohne Schule und mit stark reduziertem Zugbetrieb arrangieren, aber all dem haben sich die Einheimischen ergeben.
Der Malters Max ist ein seltenes Exemplar einer aussterbenden Spezies: physisch wie verhaltensmäßig bestens angepasst in seinem rauen Habitat, als soziales Wesen integriert und zugleich selbstverwirklicht – als Vertreter klarer Verhältnisse, harmoniebedürftiger Versteher und Vermittler, , als anerkannter Fachmann für so unterschiedliche Bereiche wie Motoren, Getriebe, Apfelsorten, Tees und alle Kräuter, die am Wegesrand wachsen. Genügsam lebt er in seiner Wohnung, deren Einrichtung einschließlich Holzofen seit Jahrzehnten nicht verändert wurde.
Wenn Max in seinen Erinnerungen die Individuen in den Sinn kommen, die zu sehr gegen das Übliche verstoßen, sich abgesondert, provoziert oder gar Unsägliches getan haben, tun sich ihm und uns Abgründe im schwarzen Wasser auf. Nur die Schlimmsten finden gar kein Verständnis; aber einfach abgeschrieben wird keiner. Die dunkelsten Geschichten gibt es hier wie überall, und jeder bekommt ein bisschen was davon mit, schweigt aber lieber, weil nichts Genaues weiß man ja nicht, und man will keinen aus der Gemeinschaft an den Pranger stellen. Auch Schicksalsschläge wie Unfälle oder Krankheit und die Not in »schlechten Zeiten« hängt keiner an die große Glocke, sondern versucht sein Leid erst einmal selbst zu bewältigen. Man redet sowieso nur das »Nötigste, wenn überhaupt«.
Ach wie einfach ist es, all dies als spießig abzutun, wie es die ›Fortschrittlichen‹ seit jeher getan haben und wie es die Städter tun, die an den Wochenenden vorbeikommen, einen Blick werfen und von hoher moralischer Warte herab alles besser wissen. Dabei kennen die meisten nicht einmal das kleine Einmaleins, das menschliches Zusammenleben im Innersten zusammenhält.
Tommie Goerz eröffnet eine Welt, die von der unseren unfassbar weit entfernt scheint. Man liest das Buch staunend, geradezu andächtig. Das literarische Können des Autors erweist sich in seinen kompakten, unemotionalen Beschreibungen der Natur, der Örtlichkeiten, der Charaktere. Sie zielen durchweg auf Anschaulichkeit, sprechen all unsere Sinne an, sparen Drastik nicht aus und rufen gleichwohl unterschiedliche Stimmungen hervor. Das gelegentlich einfließende fränkische Wortgut (an den Zähnen »zuzeln«, einen »Batzen« ausspeiben) schafft Authentizität, ohne es der Lächerlichkeit preiszugeben. Eigenartig und meisterlich, wie aus dem schlichten Erzählstil – einfaches Vokabular, kein Wort zuviel, klare Aussagesätze – eine gewisse Feierlichkeit des Tons erwachsen kann, ohne den geringsten Anklang von Rührseligkeit.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2025 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: