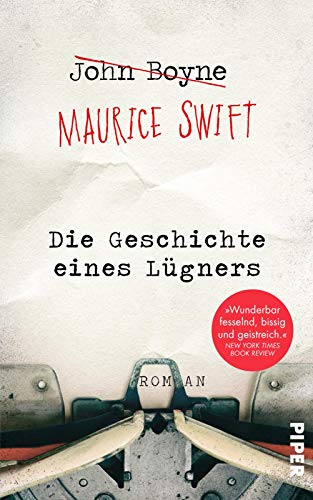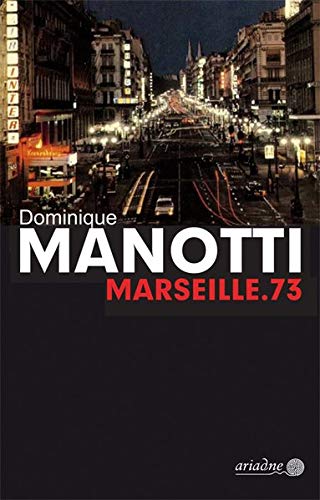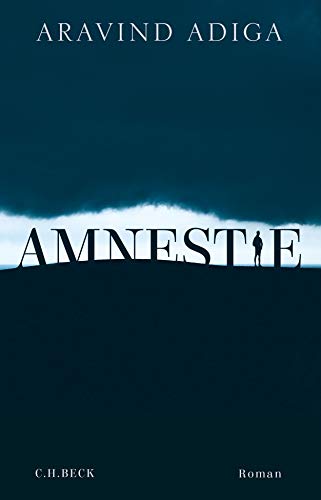
Amnestie
von Aravind Adiga
In Sidney geraten ein tüchtiger illegaler Billigarbeiter und ein Mörder in eine Zwickmühle gegenseitiger Abhängigkeit. Doch was hat den jungen Tamilen überhaupt nach Australien verschlagen?
Leben in der Unsichtbarkeit
Nur einen einzigen Tag seines Lebens erzählt uns Danny. An seinem Ende haben wir mit ihm nicht nur sein aktuelles persönliches Dilemma durchlitten, sein Schicksal durch Naturkatastrophe, Bürgerkrieg und Flucht nachvollzogen, seine Nöte in der Illegalität miterlebt, sondern auch hautnahen Einblick bekommen in die gewaltigen Mechanismen, die die Globalisierung in Gang gesetzt hat.
Danny heißt richtig Dhananjaya Rajaratnam, und er wurde 1990 als Tamile in Sri Lanka geboren. Damit hatte er kein Glückslos gezogen. Schon seit 1983 hatten sich Singhalesen und Tamilen einen grausamen Bürgerkrieg geliefert, der trotz einer Waffenstillstandsvereinbarung im Jahr 2009 mit unverminderter Brutalität weiter tobte. Als wäre »ein Fluch über ein Land« noch nicht genug, traf 2004 ein Tsunami auf Sri Lanka, kostete Tausende Menschenleben und brachte unsägliches Leid. Dhananjaya hilft, wo er kann, sieht das Elend mit eigenen Augen, erlebt neue Ungerechtigkeiten und Demütigungen, bis er innerlich »die verdammte Pflicht abzuhauen« verspürt. In seinem zerrissenen, zerstörten Heimatland sieht er keine Chance auf Glück.
Gescheit, ehrlich und tüchtig, wie er ist, plant er einen Neuanfang in Australien. Dazu gibt er sich zunächst einmal einen handlicheren Namen und kauft sich ein Studentenvisum. Ein Zwischenaufenthalt in Dubai soll »Danny« Geld bringen, endet aber in einem Verhör mit Folterung, weil er für einen Terroristen gehalten wird. In Sydney lehnen die Behörden sein Asylgesuch dennoch ab. Weder die frischen Wundmale der Folter noch Dannys Armutsbehauptung können sie überzeugen. So taucht er in die Illegalität ab und schlägt sich vier Jahre lang in Sydney durch.
Das Studium hat Danny schnell geschmissen, als ihm klar wurde, wie bedeutungslos es für ihn ist, denn einer wie er bekommt auch mit Collegeabschluss keinen Arbeitsplatz. Er muss Geld verdienen. Bald erringt er sich einen guten Ruf als stets gut gelaunter »legendärer Putzmann«, und im Supermarkt eines eingebürgerten Griechen kann er Regale bestücken und den Laden sauberhalten. Am Abend hält der griechische Ausbeuter die Hand auf und kassiert seinen Anteil an Dannys steuerfreien Einnahmen. Eine Hand wäscht die andere – zum Dank darf Danny im Lagerraum schlafen.
Dann bricht der Tag an, an dem sich alles entscheiden soll, und in Minutentaktung wird nachvollzogen, wie unser armer Held in eine Mordermittlung hineingezogen wird. Wie jeden Morgen macht er sich auf den Weg zu seinen Stammkunden, auf dem Rücken sein Turbo-Staubsauger wie ein Astronauten-Jet-Pack, in der Hand ein Beutel voller Arbeitsutensilien.
Um 8.57 Uhr legt er im Apartment des Anwalts Daryl los, steckt nach wie stets gewissenhaft getaner Arbeit die für ihn bereitgelegten Geldscheine ein und will gerade die Wohnung verlassen, als ihn ein Polizist anranzt, ob er hier wohne. Gegenüber sei »was los«. Erleichtert, dass es nicht um ihn geht , zieht sich der Putzmann in das sichere Apartment zurück. Lauschend erfährt er, dass im Gebäude gegenüber eine verheiratete Frau getötet wurde, und nun saugt ein gefährlicher Strudel ihn ins Verderben.
Denn Danny hat seit ein paar Monaten auch bei der Ermordeten geputzt und war für sie eine Art Maskottchen geworden. Wenn Radha Thomas mit ihrem Lover, dem arbeitslosen Arzt Dr. Prakash, die Abende in Spielhöllen verbrachte, nahm sie Danny (Spitzname »Nelson Mandela«) zur Unterhaltung mit. Für Danny scheint die Sache klar: Er hielt Dr. Prakash, einen Inder, schon immer für verrückt, und nun wird er wohl gewalttätig geworden sein. Doch was soll er tun? Wenn er seine Vermutung der Polizei meldet, gerät er leicht selbst unter Verdacht, fliegt als Illegaler auf, wird ins grausame Internierungslager gesteckt und abgeschoben.
Dummerweise meldet er sich ziemlich ungeschickt bei Dr. Prakash, der kein Problem hat, eins und eins zusammenzuzählen. Nun haben sich auch diese beiden – der Illegale und der Mordverdächtige – gegenseitig in der Hand. Es beginnt ein psychologisches Taktieren der beiden Männer, ein telefonisches Hin und Her, das uns über viele Romanseiten beschäftigt und Danny zermürbt. Wer sich zuerst bewegt, zieht den anderen mit in den Abgrund. Dannys Gedanken kreisen ständig um Asyl, um Recht und Gesetz, um Armut und Reichtum, und wie nebenbei erfahren wir alles aus seiner Vergangenheit und seiner Jetztzeit.
Der Mordfall liefert im Vordergrund den spannenden Handlungsfaden, der den Protagonisten bis zum erlösenden Ende vorantreibt. Wie die Sache ausgeht, ist den Medien nicht mehr wert als eine unscheinbare Kurzmeldung, die wir am Ende des Romans lesen dürfen. Was sie nicht berichten, ist das weite Feld, in dem sich Dannys Schicksal entwickelt. Auf bestechende Weise breitet es der indische Schriftsteller Aravind Adiga durch die individuelle Perspektive seines intelligenten Erzählers aus. Es ist ein Mix aus feinen, pointierten Beobachtungen der Umwelt, der bunt durchmischten Bevölkerung – japanische Brasilianer, indische Australier –, aus Erzählungen über seine Herkunft und seinen Alltag, aus permanentem Reflektieren, Hadern, Abwägen, Entscheiden, Verwerfen und optimistischem Neubeginn. Trotz der eigentlich tragischen Grundsituation bewahrt sich unser moralisch aufrechter Held eine selbstbewusste, humorvolle Konstitution.
Ein maßgebliches Anliegen des Autors ist, den Lesern Mechanismen der Globalisierung und deren Konsequenzen für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern offenzulegen. So sieht sich sein kluger Danny als Teilnehmer an »großen internationalen Weltmeisterschaften«. Bei diesen absurd anmutenden »Spielen« »rannten Menschen aus Ländern, die brannten, in Länder, die noch nicht brannten […], während eine andere Gruppe von Menschen versuchte, sie aufzuhalten, hinzuhalten, zu fangen oder zurückzuschicken«. Lokal betrachtet, halten Illegale die Wirtschaft des australischen Kontinents am Laufen und sorgen für erhöhte Gewinnmargen. Global betrachtet, sind sie Aufsteiger auf einer Art Rolltreppe des Wohlstands. Beispielsweise ernten Mittelschichtler aus Malaysia (Journalisten und Architekten etwa) Obst und Gemüse in Australiens Sonnenglut, weil sie damit mehr Geld verdienen als in ihren Berufen in der Heimat. (Weil sie sich dafür schämen, behaupten sie zu Hause, im Urlaub gewesen zu sein.) Gleichzeitig rücken aus Bangladesch bitterarme Wanderarbeiter nach, um illegale Billigarbeit in Malaysia zu verrichten. Wenngleich solche Exkurse den Unterhaltungsaspekt des Krimi-Plots schwächen und für Nachdenklichkeit sorgen, ist es legitim, bei Belletristik-Lesern das Bewusstsein dafür zu wecken oder zu schärfen, was die Globalisierung, die wir Europäer aus dem Lager der Profiteure betrachten können, mit den Menschen anderswo anrichtet.
In der snobistischen, oberflächlichen Wohlstandsgesellschaft Sydneys hat sich Danny, wie es scheint, perfekt unauffällig eingerichtet. Er weiß, wodurch Ausländer oft anecken, und bemüht sich deshalb, alle Regeln peinlichst genau einzuhalten. Er achtet auf seine Körperhaltung, er spricht nahezu akzentfrei. Verleugnen will er sich aber nicht. Vielmehr feilt er gezielt an seinem Image. Er möchte als »selbstbewusst schräg« wahrgenommen werden, denn Australier gieren nach solchen Typen. Obwohl er zu einer wenig geschätzten Minderheit gehört, wird er gern akzeptiert, »weil du nicht so warst wie alle anderen«.
Um zu überleben, darf Danny bei seinen Jobs nicht wählerisch sein. Die billige Konkurrenz anderer illegaler Migranten wie Chinesen und Nepalesen schläft nicht. »Vier Männer zum Preis von einem«, jeder kämpft gegen jeden. Eingebürgerten Migranten sollte man allerdings aus dem Weg gehen, lernt er: »Ein Kinderspiel, unsichtbar für die Weißen zu werden, die einen sowieso nicht ansehen, aber richtig schwierig, unsichtbar für die braunen Menschen zu werden, die dich immer sehen, egal, was du machst.«
Mit »Amnesty«, einer Art Globalisierungsthriller also, den Ulrike Wasel und Klaus Timmermanns pfiffig übersetzt haben, folgt Aravind Adiga, 1974 geboren, dem Erfolgsrezept seines Debütromans. In »The White Tiger« (»Der weiße Tiger«) schuf er ein quirliges, ungeschöntes, vielschichtiges Porträt des modernen Indien, abseits jeder romantischen Exotik, geschildert von einem komplexen Charakter in witzigem, fesselndem und intelligentem Ton, und erhielt dafür 2008 den Booker Prize. »Amnestie« lässt einen ebenso agilen und klugen Protagonisten aufbrechen, um sein Glück im Ausland zu suchen, und auch seine Erlebnisse werden auf literarisch ungewöhnliche, oft sehr komische Weise präsentiert.
 · Herkunft:
· Herkunft: