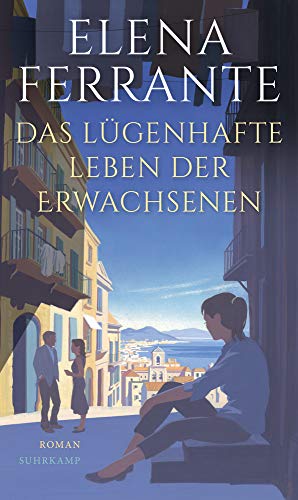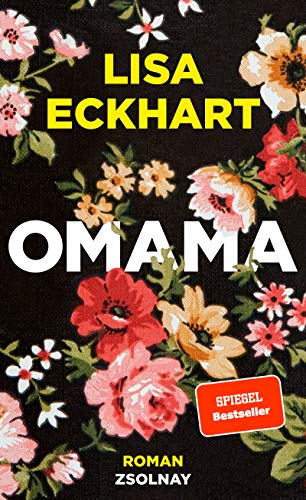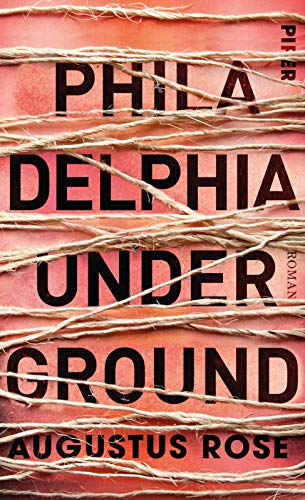
Philadelphia Underground
von Augustus Rose
Vor dem Hintergrund des Kunstbegriffs und des Schaffens von Marcel Duchamp entwickelt Augustus Rose eine Art Mystery-Thriller.
Ein ambitionierter Kunstgriff
Kennen Sie Marcel Duchamp? Der französisch-amerikanische Wegbereiter des Dadaismus und Surrealismus (1887-1968) hat den bis zum Ersten Weltkrieg gängigen Kunstbegriff revolutioniert, indem er industriell gefertigte Alltagsgegenstände (»Readymade«) als Kunst deklarierte. Sein 1917 auf einem Sockel präsentiertes Urinal (»Fountain«) löste einen Skandal und eine Kontroverse aus. Nicht der unmittelbare Sinneseindruck der Skulptur, eines Gemäldes o.ä., sondern das theoretische Konzept dahinter entscheide über den Status eines Kunstwerks (»Konzeptkunst«). So sei bereits die Auswahl eines Gegenstandes ein künstlerischer Akt.
Mit Duchamp und seinen in weiten Teilen schwer zugänglichen Theorien und Werken hat sich der Amerikaner Augustus Rose intensiv befasst und kam auf die aparte Idee, seine Erkenntnisse in einen kreativen, innovativen Thriller einfließen zu lassen. Mit seinem Debütroman »The Readymade Thief«  (2017) ist sozusagen ein Stück Konzept-Literatur entstanden, das Werner Löcher-Lawrence jetzt ins Deutsche übersetzt hat. Mögen Kunstkundige im Originaltitel schon einen Hinweis auf Duchamps Gedankenwelt erspähen, so weckt der deutsche Titel eher Erwartungen auf einen kernigen Thriller aus der finsteren Unterwelt einer amerikanischen Metropole.
(2017) ist sozusagen ein Stück Konzept-Literatur entstanden, das Werner Löcher-Lawrence jetzt ins Deutsche übersetzt hat. Mögen Kunstkundige im Originaltitel schon einen Hinweis auf Duchamps Gedankenwelt erspähen, so weckt der deutsche Titel eher Erwartungen auf einen kernigen Thriller aus der finsteren Unterwelt einer amerikanischen Metropole.
Folgen wir zunächst dieser Verheißung. Die Handlung wird in einer Struktur auf zwei Ebenen erzählt: Neun Bücher, deren Überschriften auf Titel von Duchamp-Werken anspielen, und 21 Kapitel überlappen sich. Bereits im Prolog lernen wir die Protagonistin Lee Cuddy kennen, die mit siebzehn in einer verzweifelten Lage steckt. Sie ist schwanger, auf der Flucht, sitzt am Ufer des Delaware River und überlegt, wie sie ihren Freund Tomi in dem verfallenen DePaul-Aquarium auf der Insel Petty Island treffen kann.
Ab Buch I erfahren wir, wie es dazu kam. In Lees Elternhaus bestimmte Streit den Alltag. Mutter Julia verdiente als Krankenschwester den Lebensunterhalt, während der Vater Röntgengeräte in Krankenhäusern reparierte, lieber aber an alten Autos herumbastelte oder seiner Leidenschaft als Musiker frönte. Als Lee sieben Jahre alt war, verließ er die Familie. Ein paar Jahre später holte sich Julia einen neuen Lover ins Haus. Mit seiner Meditationsecke, Räucherstäbchen und einer kruden Philosophie blieb er dem Mädchen fremd. Die entdeckt derweil die Vorzüge der Kleinkriminalität (Verhökern geklauter Kleidung, Urkundenfälschung, Drogendealerei) und schafft sich, unbemerkt von ihrer Mutter, die finanzielle Basis für ein eigenständiges Leben. Mit sechzehn wird sie von der Polizei erwischt. Jugendhaft bleibt ihr dank vehementen mütterlichen Einsatzes erspart, und sie kommt mit einer nächtlichen Sperrstunde davon.
Eine Zeitlang verzichtet Lee auf Eskapaden, spielt aber im Kreis der Mitschülerinnen keine Rolle mehr. Ihre einzige Vertrauensperson ist Edie, Tochter eines angesehenen Anwalts, die jedoch ihrerseits schlechten Umgang pflegt und Rave Partys einer obskuren »Société Anonyme« besucht. Als ihr die Polizei auf den Pelz rückt, zieht sie sich aus der Affäre, indem sie ihre Freundin ausliefert. Lee landet im Jugendgefängnis, in Einzelhaft, später in einer Psychiatrie-Abteilung. Nach siebzehn furchtbaren Monaten gelingt ihr die Flucht.
Mittellos und polizeilich gesucht kann sie nur in den Untergrund abtauchen. Sie findet Unterschlupf in der »Kristallburg«, einem seltsamen Schloss, in dem sich ein »Stationsvorsteher« um gestrandete Jugendliche kümmert und ein merkwürdiger »Priester« herumgeistert. Sie findet ein Notizbuch, dessen letzter Eintrag sie beunruhigt: »Heute ist er gekommen. Es ist Zeit. Ich schließe die Augen und sehe es.« Bei einem heimlichen Streifzug durch das Gebäude entdeckt sie offensichtlich gefangen gehaltene Jugendliche und flieht erneut. Da sie dabei einen Teil eines Duchamp-Werks aus dem Büro des »Stationsvorstehers« mitgehen lässt, natürlich ohne es als Kunstwerk zu erkennen, wird sie fortan zur doppelt Gejagten.
Bald lernt Lee einen Jungen namens Tomi kennen, dessen Hobby »urbane Erkundungen« sie anzieht, auch wenn sie sein »endloses Gerede, sein Umsichwerfen mit den Namen obskurer Kunstbewegungen (Fluxus und Lettrismus, Paraphysik und Situationistische Psychogeografie)« manchmal unerträglich findet. Mit ihm streunt sie durch verlassene Orte wie das DePaul-Aquarium oder ein Museum, und in dieser Situation haben wir sie im Prolog kennengelernt.
Während wir also noch gespannt den Abenteuern, Rätseln und Mysterien von Lees gefährlicher Flucht folgen, hat der Autor bereits zahlreiche Begriffe und Personen eingeführt, die, ohne dass wir dessen als System gewahr wurden, auf den Künstler Marcel Duchamp hindeuten. So verweist die »Société Anonyme« auf eine 1920 gegründete Künstlerorganisation, zu der neben Marcel Duchamp auch Man Ray und Katherine Sophie Dreier gehörten. Der »Stationsvorsteher« und der »Priester« aus der »Kristallburg« sind Figuren aus dem Duchamp-Kunstwerk »Die Braut wird von ihren Junggesellen entkleidet, sogar (oder: Großes Glas)«, einem ohne Erläuterung des theoretischen Hintergrundes unverständlichen Objekts, das »eine ›Vermählung von geistigen und visuellen Reaktionen‹ hervorrufen, zugleich Darstellung und Idee sein« soll (aus dem Wikipedia-Artikel über »Das Große Glas«). Derlei kommt nun in äußerst komplexer Form im weiteren Handlungsverlauf auf den Leser zu, indem der Experte Augustus Rose Duchamps Schaffen, Werke, Metaphysik, Alchemie und Visionen mit dem Plot verwebt. Leider wird das interessante Konzept damit ziemlich kopflastig realisiert – um den Preis, dass die Ausführungen über den Dadaisten und Surrealisten Schwung und Spannung des Krimiplots bremsen und am Ende Ungereimtheiten, ungelöste Rätsel und Frustration hinterlassen.
Augustus Rose hat sich mit seinem Kunstwerk »Philadelphia Underground« viel vorgenommen. Der Spagat, eine hochabstrakte Kunsttheorie, die bereits in zahlreichen Fachbüchern erklärt und veranschaulicht worden ist, ausgerechnet mit dem Thriller-Format zu verquicken, das darauf beruht, alle Sinne in Erregung zu versetzen, ist wohl doch eine zu eigenwillige Kontorsion, als dass sie gelingen könnte.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: