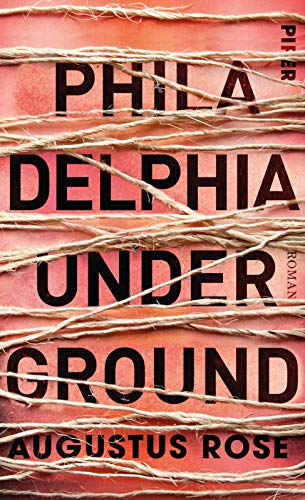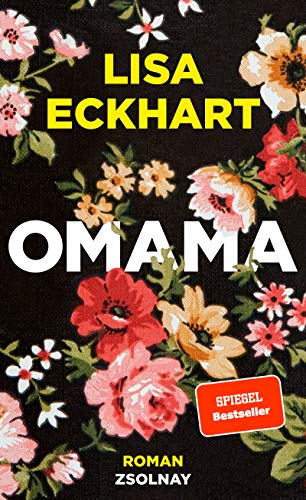
Omama
von Lisa Eckhart
Entlang einem lockeren Handlungsfaden aus dem Leben der Großmutter serviert die sprachbegnadete Satirikerin ein buntes Panoptikum an scharfen Beobachtungen, klugen Überlegungen, bissigen Kommentaren, angerichtet in ausgefuchster Rhetorik und einer Extraportion Drastik, garniert mit nur scheinbar anheimelndem Dialekt.
Lisas Welt
Seit Ende 2015 steht Frau Lasselsberger auf Bühnen in Österreich und Deutschland, seit 2017 haben Auftritte im Fernsehen sie richtig bekannt gemacht. Mit messerscharf kalkulierten Inhalten und ausgefeilter Sprache (Intonation und österreichische Einsprengsel eingeschlossen), die sie in streng durchgestyltem Äußeren und theatralisch-artifiziellen Gesten präsentiert, hat die Perfektionistin es geschafft, ihre Kunstfigur »Lisa Eckhart« als Marke von höchstem Wiedererkennungswert zu etablieren.
Solche Kunstfiguren haben eine Tradition von Jahrhunderten. Hofnarren, Pulcinella, Eulenspiegel, Harlekin und Gangsta-Rapper sind unter ihren Kostümen womöglich brave Bürger, und jeder weiß, dass die Frechheiten, die ihre Masken dem Publikum an den Kopf werfen, nur Provokationen sind, die unterhalten und nachdenklich machen sollen. Man sieht ihnen nach, dass sie mit dem Feuer spielen, an Tabus rühren, Gefühle verletzen, wie es auch der Satire erlaubt ist.
In moralisch rigiden Zeiten kommt solch freizügiger Schalk freilich schlecht an. So ist auch Lisa Eckhart nach ihrem raschen Karriereaufschwung bei den puritanischen Hütern der political correctness in Ungnade gefallen (siehe Wikipedia-Artikel über »Lisa Eckhart«) und bekommt neuerdings das Etikett »umstritten« angeheftet, wie auch ihr Förderer und Fürsprecher Dieter Nuhr. Wie lange wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen den beiden per shitstorm waidwund geschossenen Stars noch Sendezeit einräumen?
Während Nuhr als Sprachrohr gesunden Menschenverstandes von einer breiten bürgerlichen Mitte geschätzt und gestützt wird, reizt Lisa Eckharts diffizile Bühnenshow diverse Grenzen bis ins kaum noch Erträgliche aus. Einerseits gibt sie sich ästhetisch elitär (als Design-Kunstwerk, mit exaltierter Artikulation und würdevoller Gestik, mit akribischer Wortwahl, die souverän auf der Klaviatur kühner Breitseiten und gewagter Mehrdeutigkeiten spielt), andererseits kann sie unsäglich ordinäre Dinge auswalzen und mit den brisantesten Tabus zündeln. Ihre Auftritte sind Ritte auf der Rasierklinge, die gleichzeitig intellektuelle Hellhörigkeit und, wenn es wieder einmal weit unter die Gürtellinie des guten Geschmacks geht, ein dickes Fell erfordern.
Nun hat Lisa Eckhart ihren Debütroman veröffentlicht. Hält er, was die ambitionierte Bühnenperformance verspricht? Auf der Bühne reißt uns der Sog ihrer gemessen vorgetragenen Zuckerln und Zumutungen mit, beim Lesen aber können wir innehalten, nachschmecken, runterschlucken oder ausspeiben.
Passt scho, könnte man erst einmal konstatieren. Kaum ausblendbar läuft beim Lesen vor dem inneren Auge das Videobild der Autorin, wie sie sozusagen die Hörbuchversion deklamiert – und das klingt eins zu eins authentisch. Eine putzige Familienaufstellung mit Fensterl in Lisa Eckharts Privatleben wird kein Kenner erwarten, aber wie sie gleich im ausgiebigen Prolog klarstellt, ist ihr Buch nicht einmal die übliche Eloge auf vom Leben geprüfte, weise, gütige Ahnen, die den Enkeln die Welt erklären. Nein, sie selbst, das Enkerl, werde dem Leser die Welt erklären, und das »anhand des Lebens meiner Großmutter«. Die drei Hauptteile des Romans erzählen denn auch Episoden aus der Vita von »Omama« Helga und ihrer zwei Jahre älteren Schwester Inge von 1945 bis in die Neunzigerjahre oder länger. Nüchtern betrachtet verläuft ihr Leben recht hausbacken und unspektakulär, bietet der Enkelin aber reichlich Anlässe für drastisch zugespitzte Schilderungen und welterklärende Exkurse aller Art, wobei die Erzählerin hauptsächlich Watschn austeilt, an Männer und Frauen, Jung und Alt, Verwandte und Fremde, vor allem aber Österreicher. Ob »diese Biografie als Hommage oder als Rufmord« zu verstehen ist, soll jeder Leser selbst entscheiden, und er mag seine Antwort gleichermaßen auf die »Omama« und auf die Alpenrepublik beziehen.
Denn was hier abgeht, ist schon deftig. Der erste Teil stochert in gleich mehrere Wespennester. Als 1945 »der Russe« in die Steiermark einmarschiert, geht ihm der Ruf unsäglicher Schandtaten voraus. Um das hübsche Schmuckstück Inge für bessere Partien in Friedenszeiten zu schützen, versteckt man sie unter dem Bett und bietet den »Barbaren« obendrauf die unattraktive Helga feil. (Darf Satire junge Frauen derart sexistisch auf ihre körperliche Verwertbarkeit reduzieren?) Die Besatzer des Dorfes Mautern zeigen jedoch weder an der einen noch der anderen Interesse und erweisen sich gar als anständige Menschen. (Darf Satire ein düsteres Kapitel der Geschichte derart klittern?) Im Übrigen lernen wir den elterlichen Erziehungsstil (bevorzugt Watschen) und seine Wirkung (keine) auf das Wesen der beiden pubertierenden Mädchen kennen. Während die geistig schlichte Inge (Darf Satire derart platte Klischees über Frauen warmhalten?) sich gern von »allen dreckigen Bauernknechten … auf den Heuböden … umfassend ausgreifen ließ«, hält Helga ihr den Rücken frei, wenn die Mutter spät nachts nach ihrem Verbleib fragt, und entwickelt dabei eine Missgunst und Boshaftigkeit, die das schwesterliche Verhältnis fürs Leben prägt.
Teil Zwei schildert das Treiben im sozialen Gefüge von Mautern Mitte der Fünfzigerjahre. Das Wirtshaus mit griffiger Wirtin ist sein Zentrum, das Saufgelage einer Hochzeit sein höchstes Fest, die freiwillige Feuerwehr der Gipfel des Klischees (der Hauptmann ist pyroman, seine Mannen dauerbesoffen). Trinker, Dorfdepp, -schönling und -matratze sind »die vierfältige Einfältigkeit«, die »sakralen Säulen« der Gemeinschaft. Was die Männer und Frauen verbindet, verrät schon das dialektale Vokabular: Der »Haberer« wird komplett von seinem »Zumpferl« gesteuert, patscht jedem »Flitscherl« ans »Popscherl«, und jede »Trutschn« lässt sich »ausgreifen«, bis »die Tuttln owigschmirgelt« sind. Die so gewiefte wie fühllose Mutter entlässt ihre Töchter schließlich hinaus in die Welt, wo sich ihre Wege trennen. Inge landet als »Kindsfrau« bei einem Wiener Professor, Helga als »Kinderfrau« bei einem Doktor in Gmunden. Die Helga »hilft dem Doktor in den Mantel, die Inge dem Professor heraus«. Am Ende kehrt Helga in die Steiermark zurück, arbeitet bei einem einarmigen Wirt und heiratet dessen Sohn. Im dritten Hauptteil erweist sich Helga als gewitzte Unternehmerin, indem sie Schmuggelfahrten mit debilen Senioren ins nahe Ungarn organisiert und später wundersame Heilsalben vertickert. Mit Familienausflügen und einer kruden Kreuzfahrt mit der 1992 geborenen Enkelin Lisa klingt die turbulente Achterbahnfahrt aus.
Zwar folgt die Ich-Erzählerin den Fährnissen im Leben der Großmutter im Grunde chronologisch, lässt sich jedoch beständig fortreißen zu spontanen Ausflügen. Dann schlägt sie mitunter weite Bögen in Raum und Zeit bis ins Heute und reflektiert oder spöttelt über wunderliche Charaktertypen, psychische Eigentümlichkeiten, körperliche und verhaltensmäßige Ausprägungen von Frauen und Männern aller Altersstufen, regionale und nationale Besonderheiten.
Das wahrhaft Herausragende an diesem Buch ist allerdings seine brillante sprachliche Gestaltung. Lisa Eckhart ist kein Comedy-Leichtgewicht der oberflächlichen Gags. Die studierte Germanistin (Paris, FU Berlin) weiß ihre Worte wie Waffen zu wählen und Effekte auf des Messers Schneide zu lancieren. Ihr Vortrag ist ein Staccato aus kurzen Hauptsätzen, eine unerschöpfliche Kaskade ziselierter Wortspiele, sei es mit dem Klang, sei es mit den Bedeutungen der Wörter. Rhetorische Figuren von der Alliteration bis zum Zeugma pflastern den Weg wie originelle, spaßige Belege für ein Lehrbuch, darunter auffällig häufig die seit mindestens einhundert Jahren aus der Mode gekommene Ellipse, dazu exotische Wortgemmen (»Riposte«), kühne Metaphern und gewagte Vergleiche. Einzelbeispiele zu zitieren wäre kontraproduktiv, denn Eckharts Sprache wirkt als fließendes Ensemble. Im zügigen Vorbeirauschen fügt sich alles zu einem bunten Satirebild.
Dass die Autorin einen deutlichen Akzent auf sexuelle und verdauungsbezogene Themen setzt, stößt manchem nachvollziehbarerweise auf. Was früher als fortschrittliches Brechen von Tabus gegolten haben mag, ist heutzutage halt nur noch abgeschmackt. Anders als im Volkstheater bremst hier keinerlei Gschamigkeit die Drastik des Gebotenen. Die Wort- und Bildwahl ist deftig ordinär – und doch wegen der maßlos übertreibenden Zuspitzung und des ungehemmten Spiels mit Tabus irgendwie witzig. Auch das zumindest in Deutschland wohl als anheimelnd-harmlos empfundene dialektale Konfekt vermag inhaltliche Tiefschläge ein wenig zu versüßen. Das Österreichische verfügt offenbar über ungezählte Vokabeln für die entsprechenden Körperteile, -öffnungen, -betätigungen, und allein »vierzig fürs Brunzen«.
Und doch sind gelegentlich befremdliche Brüche zu beklagen, wenn der durchaus gehobene Text zwischen der intellektuell-analytischen und der provokant-tabuanrührenden Seite wechselt, manchmal wie obsessiv. Sprachlich frappiert das dann, aber die inhaltliche Brücke trägt nicht immer. Beispielsweise kommentiert die Autorin ironisch die »intrinsische« Beziehung zwischen Mutter und Kind (»Die Mutter würde ihrem Kind wohl auch den Muttermord verzeihen, wäre sie dazu noch imstande.«), um dann die »zwanghafte Treue der Mutter, deren Arme nur das Kind umschließen«, von der »zwanghaften Treulosigkeit einer Dirne, deren Beine jedem offenstehen«, abzusetzen. So stehen Handlung und Inhalt doch ein wenig im Schatten der sprachlichen Pracht und Überfülle.
Ein bisserl schmerzt mich übrigens, dass die so umwerfend sprachsensible Lisa durchgehend das neumodische »Nichtsdestotrotz« verwendet. Wem stünde es besser an als ihr (die ihr Opus mit einem Mephisto-Zitat schließt), dem in sich schlüssigen »Nichtsdestoweniger« die Stange zu halten, anstatt einer groben Grammatikvergewaltigung aufzusitzen?
 · Herkunft:
· Herkunft: