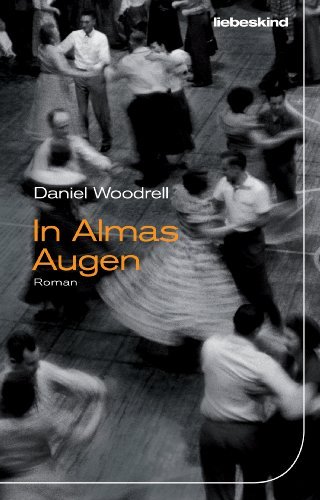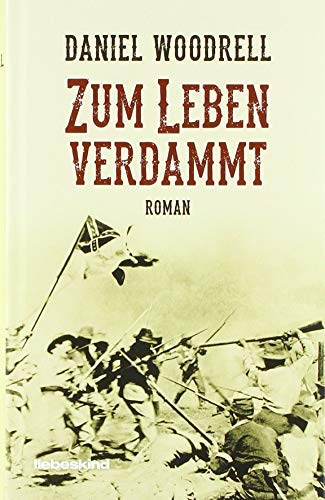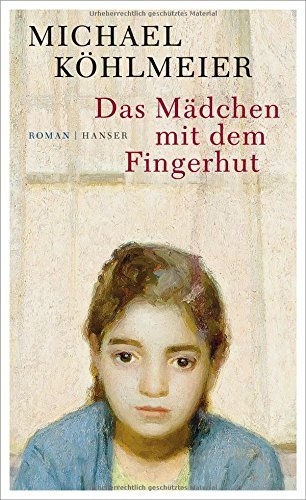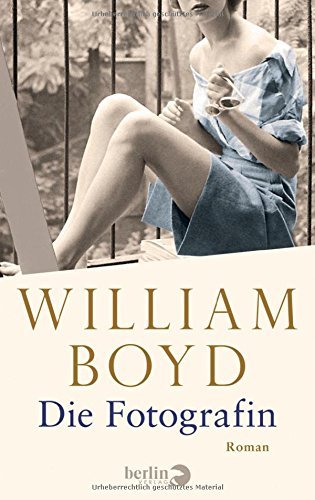Bleibt bloß, wo ihr seid
Schade – wenn du in den Ozarks geboren wurdest, hast du Pech gehabt. Die riesige hügelige Hochplateauregion im ländlichen Mittleren Westen der USA, die weite Teile der Bundesstaaten Missouri und Arkansas ausmachen und sich bis nach Oklahoma und Kansas erstrecken, ist eine sehr, sehr konservative Gegend. Reich bleibt reich, und arm bleibt arm. Und wer in Venus Holler, einem zwielichtigen Ortsteil mittendrin geboren wurde, hat besonders schlechte Karten, dass jemals etwas Besseres aus ihm wird.
Aber Jamalee Merridew will es wissen. Sie ist neunzehn und hat nur ein Bestreben: raus hier. Dass sie Wut im Bauch und Rebellion im Blut hat, signalisieren weithin sichtbar ihre tomatenroten Haare. Mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Jason könnte sie den Ausbruch aus ihrer underdog-Existenz schaffen. Jason sieht so umwerfend aus, dass ihm alle weiblichen Wesen sogleich verfallen. Deswegen ist er der einzige in der Familie, der tatsächlich Geld nach Hause bringt. Alle Kundinnen des lokalen Friseurladens wollen von ihm bedient werden. Mit dieser Attraktion einen eigenen Laden aufziehen, natürlich »in einer betuchten Gegend, wo die Leute ihr Geld nur deswegen ausgeben, damit sie es nicht mit sich rumschleppen müssen«, das ist Jamalees Geschäftsidee.
Die Sache hat freilich einen Haken. Der schöne Jason ist schwul. Unter den Hillbillies in den abgelegenen Tälern der Ozarks ist das eine verdammt gefährliche Veranlagung.
Noch einer, der ziemlich verzweifelt kämpft, um etwas aus seinem elenden Dasein zu machen, Hauptsache es geht ein bisschen nach oben, ist Sammy Barlach, 24, der Ich-Erzähler. Bisher ist ihm allerdings noch nicht viel gelungen im Leben. Er hat ein Gefängnis von innen gesehen, zieht nun herum und ist im öden West Table (zu dem der Ortsteil Venus Holler gehört) hängen geblieben. Da hat er einen Job in einer Hundefutterfabrik gefunden, haust mit lauter Pennern in einer Wohnwagensiedlung und schlägt seine freie Zeit mit Bier, Tequila und Crank tot. Außerdem ist er auf das Mädchen mit den Mausezähnchen scharf. Die hat eine tolle Idee: Da steht eine edle Villa leer und lädt ihn geradezu ein, dass er einbricht, während die stinkereichen Besitzer verreist sind.
Nur wer wagt, kann gewinnen, und nebenbei hofft Sammy, dass ihn seine neuen Freunde ganz toll finden, wenn er den keineswegs risikofreien Job erledigt. Durch ein kleines Fensterchen von »netterweise« minderer Qualität landet er hart in einer völlig anderen Welt. Wie er so staunend durch das noble Ambiente streift, eingehüllt in wohlige Düfte, fällt sein Blick auf nie zuvor gesehene Objekte, die er nicht einmal mit Namen bezeichnen könnte – Möbel, Accessoires, Mitbringsel aus aller Welt. »Mein Verstand ... stolperte zwei, drei Schritt hinter meinem Körper her«, und er gerät ins Philosophieren: »Ein Ort von diesem Kaliber entlarvt dich als Versager und bringt dich dazu, dass du dich selbst diskriminieren willst als winziges Staubkörnchen Nichts, das nur den Planeten durcheinanderbringt, auf dem diese würdigen Vertreter so prachtvoll leben und sich wünschen, sie könnten dich und deinesgleichen fernhalten«.
Die Rolle, die diese Situation ihm zuweist, ist ihm bewusst: »Abschaum«. Sie anzunehmen, einer drängenden Wut nachzugeben und alles kurz und klein zu schlagen ist eine Versuchung, der Sammy widersteht. Nicht aus Einsicht in die betonharte Unabänderlichkeit der Verhältnisse in den Ozarks, sondern weil ihn das Crank benebelt. Lieber bedient er sich in der weitläufigen Küche an Wodka und Käse und lässt sich in einen geruhsamen Schlaf gleiten.
Am Morgen weckt ihn ein durchgestyltes junges Pärchen. Sie führen ihn durch das ganze Haus in all seiner Pracht, erzählen dies und das von ihren Reisen durch die Welt, fragen ihn ein wenig aus, als gehe es um eine Bewerbung, schlagen schließlich vor, ihn als »Security« für das Anwesen der Familie anzuheuern, und zeigen ihm sein neues Zimmer. »Verflucht klasse« findet Sammy das. Merkwürdig nur, dass sich die beiden auf ein Zeichen des Jungen hin zügig aus dem Staub machen. Als die Bullen anrücken, dämmert es Sammy, dass er sich als »zugedröhnter Volltrottel« blamiert hat und die beiden auch nur Einbrecher waren, wenn auch deutlich cleverer als er. So haben Jamalee, Jason und Sammy einander gefunden und bleiben als Trio zusammen. Wer weiß, kalkuliert Jamalee, ob der Mann ihr und ihrem Bruder nicht nützlich sein kann für ihren Ausbruch aus Venus Holler und ihren Aufstieg in der Welt.
»Du kannst bei uns unterkriechen.« Der Einladung der beiden Geschwister folgt Sammy nur zu gerne, so sehr sehnt er sich nach Freundschaft und Familienanschluss. In Gestalt von Mutter Bev wird ihm beides und noch mehr zuteil. Die Vierzigjährige (»eine Barbie, die mit Truckstop-Whiskey und frittiertem Hühnchen aus dem Leim gegangen war«) arbeitet als Gelegenheitsprostituierte, bereitet unter anderen dem Ortscop ab und zu ein paar fröhliche Stunden und schließt nun auch Sammy in ihr voluminöses Herz.
Leider finden Jamalees Pläne bald ein jähes Ende. Jason wird tot in einem sumpfigen Tümpel aufgefunden. Obwohl das Gewässer so flach ist, »dass man hier schon Hilfe braucht, um zu ertrinken«, macht die Polizei kein großes Gedöns und hakt den Fall flott als Unfall ab.
Daniel Woodrells Sozialkrimi malt ein deprimierendes, hoffnungsloses Bild von einer erstarrten Gesellschaft, die schlicht nach arm und reich sortiert ist und wo sich jetzt und in Zukunft nichts bewegen soll. Jedenfalls nach Ansicht derer, die das Sagen haben. Die »niedrigen Elemente« können deshalb noch soviel kläffen und um sich beißen, sie sind »nur weicher, lehmiger Dreck, über den alle jederzeit hinwegtrampeln können«. Die drei Helden geben sich alle Mühe, mit einem alten »Benimmbuch« ihr »gesellschaftliches Kostüm, das unsere niedrige Herkunft auf den ersten Blick verriet«, abzulegen. »Wir sind einfach nicht mit anständigen Werten aufgewachsen. Wir werden sie auswendig lernen müssen«, treibt Jamalee ihre Jungs an. Aber ihre Transformationsbemühungen haben keine Chance. Vergeblich wird Sammy schließlich seine Zähne zeigen, den »Helden« spielen, eine brutale Bluttat begehen. Sie hat weder Sinn noch System und noch nicht einmal einen Zusammenhang mit dem, was ihm wichtig wurde, aber immerhin ist sie ein Grund, dass er uns seine Geschichte erzählt. »Jetzt wisst ihr alles«, lautet sein Fazit.
Die sogenannte bessere Gesellschaft kommt auch vor, disqualifiziert sich jedoch aufs Übelste. Bereits mit der Geburt werden den Herrschaften alle Vorteile und Aufstiegschancen verbrieft. Was sie dann von den Habenichtsen unterscheidet (und was diese für so erstrebenswert halten, dass sie bereit sind, sich dazu radikal zu verformen), sind hohle Äußerlichkeiten – Goldklunker, Schuhe, »die so hässlich waren, dass sie ein Vermögen gekostet haben mussten«, protzig durchgestylte Villen, feines Getue, snobistisch-arrogante Phrasen. Hinter der Glitzerfassade verbirgt sich ein Sumpf an Immoral.
Mit diesem schlichten Schwarz-Weiß-Gesellschaftsbild bedient der Autor natürlich immer wieder gern gelesene Klischees, doch sie sind wunderbar verpackt. Gänzlich ungetrübtes Vergnügen bereitet Daniel Woodrells Erzählstil. Er ist ein Meister der Sprache, und sein Übersetzer, der unermüdliche Peter Torberg, ist ihm ebenbürtig, indem er die Vorlage in der deutschen Sprache noch einmal erschafft mit all ihren ungewöhnlichen, expressiven, hammerharten, groben, derben, poetischen Sätzen. Des Autors Hobby, scheint es, ist die Personifizierung. Er liefert sie uns als kleine Perlen (»Da kommt der Schinken mit Bev.«), breitet aber auch gern ganze Motivteppiche aus (»Ein Güterzug war unterwegs und beschimpfte mit seiner lautstarken Hupe an jedem Bahnübergang den Straßenverkehr, eine Beschimpfung, die man meilenweit hören konnte.« – »Ich konnte das Unheil, das mir immer auf den Fersen war, schon am Rand des Lagerfeuers hocken sehen, es gähnte, pulte in den Zähnen, lauerte.«). Die Poesie seiner ungeschminkten Bilder ist oft befremdlich, zugleich schön und furchterregend, voller Verständnis und voller Abscheu (Venus Holler war »eine Senke voll kleiner eckiger Häuser, die sich ein wenig zur Seite neigten wie ein Haufen Trinker, die nicht mehr so gut hören.«). Eine dichte local-color-Atmosphäre in bester amerikanischer Erzähltradition saugt den Leser auf.
Daniel Woodrell hat »Tomato Red«  schon 1998 veröffentlicht. 1999 erhielt er dafür den PEN West Award. Zwei Jahre später brachte Rowohlt eine deutsche Taschenbuchausgabe heraus, die jedoch kaum wahrgenommen wurde. Einen gewaltigen Popularitätsschub erlebte Daniel Woodrell durch seinen Roman »Winter's Bone«
schon 1998 veröffentlicht. 1999 erhielt er dafür den PEN West Award. Zwei Jahre später brachte Rowohlt eine deutsche Taschenbuchausgabe heraus, die jedoch kaum wahrgenommen wurde. Einen gewaltigen Popularitätsschub erlebte Daniel Woodrell durch seinen Roman »Winter's Bone«  (2006, deutsch »Winters Knochen«
(2006, deutsch »Winters Knochen«  , ebenfalls von Peter Torberg übersetzt), dessen Verfilmung (»Winter's Bone«
, ebenfalls von Peter Torberg übersetzt), dessen Verfilmung (»Winter's Bone«  ) im Jahr 2010 viel Aufsehen erregte und eine ganze Reihe von Preisen erhielt (dazu vier Oscar-Nominierungen). Das wird dem Liebeskind-Verlag Mut gemacht haben, den packenden, düsteren Roman über den Loser Sammy Barlach und die tomatenrotschopfige Möchtegernaufsteigerin Jam von Peter Torberg neu übersetzen zu lassen und auf den Markt zu bringen.
) im Jahr 2010 viel Aufsehen erregte und eine ganze Reihe von Preisen erhielt (dazu vier Oscar-Nominierungen). Das wird dem Liebeskind-Verlag Mut gemacht haben, den packenden, düsteren Roman über den Loser Sammy Barlach und die tomatenrotschopfige Möchtegernaufsteigerin Jam von Peter Torberg neu übersetzen zu lassen und auf den Markt zu bringen.
 · Herkunft:
· Herkunft: