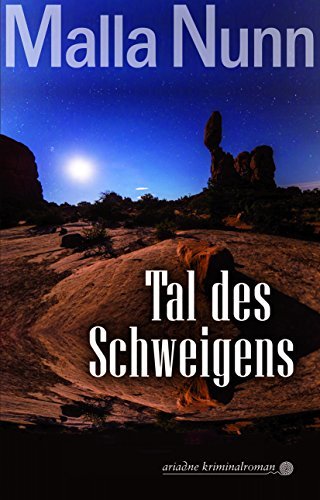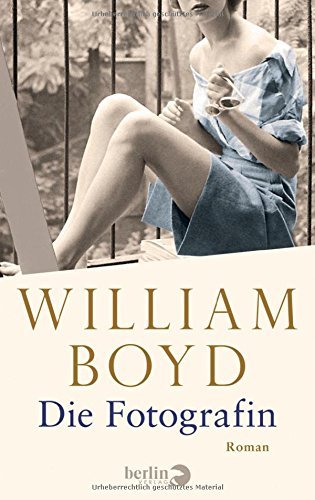
Nicht wahr, aber gut erfunden
Amory Clay (1908-1983), englische Pionierin der Reportage- und Kriegsfotografie. Eine gefeierte Vorreiterin in einer von Männern dominierten Berufswelt. Doch weder Google noch Wikipedia liefert auch nur einen Eintrag über diese Persönlichkeit. Kein Wunder – sie lebt(e) nur in William Boyds neuestem Buch. Nun sind fiktionale Figuren ja geradezu ein definierendes Merkmal von Romanen. Was also ist Besonderes an Amory Clay?
Mit allen Tricks seines Handwerks täuscht Boyd eine Autobiografie vor. Er verquickt Amory Clays Leben, das sie selbst hübsch der Reihe nach erzählt, mit unzähligen Personen und Ereignissen der Zeitgeschichte und garniert es, quasi als dokumentarische Belege der behaupteten Vita und des fingierten Werkes, mit einer Menge (leicht unscharfer) Schwarz-Weiß-Fotos aus ihrem Familienalbum und ihrem Œuvre. Selbst Quellennachweise nach wissenschaftlichen Gepflogenheiten fälscht der Autor unverfroren (»Der Eintrag über ihn im Oxford Companion to English Literature (dritte Auflage) lautet wie folgt: ...«). Kein Wunder, dass wir Leser dem spannenden Lebenslauf fasziniert folgen und kein Härchen finden, das uns auch nur den geringsten Zweifel am Realitätsgehalt des Gelesenen zu hegen veranlasst.
Wer ›war‹ Amory Clay? Bei ihrer Geburt, am 7. März 1908 in London, war sie eine Enttäuschung. Ihr Vater, Beverley Vernon Clay, hatte innigst gehofft, sein erstgeborenes Kind »möge kein Mädchen sein«. Die unangenehme Wahrheit drängt er nach Kräften beiseite. Der Säugling erhält den »androgynen Namen« Amory, und die Geburtsanzeige in der Times verkündet dreist: »ein Sohn«. Der erste »Fehler« in ihrem Leben, wie Amory Clay fast siebzig Jahre später in ihrer Rückschau konstatiert, und ihm werden, wie sollte es anders erfunden werden, weitere folgen.
Zwei Jahre später zieht die Familie in ein kleines Cottage nach Beckburrow, East Sussex. Dort wird 1914 Schwester Peggy geboren. Aus dem »Wunderkind am Klavier« wird einmal eine berühmte Konzertpianistin, geehrt mit dem Verdienstorden des British Empire. Mutter Wilfredas drittes Kind ist endlich ein Junge. Alexander, Jahrgang 1916, von allen nur Xan genannt, ist ein in seiner Welt verschlossener, genügsamer und einfältiger Junge. Das Schicksal wird sein Leben keine dreißig Jahre später auf zynische Weise beenden. Der Bomberpilot überlebt den Absturz seiner Maschine in der Normandie, wird dann aber neben seiner Maschine von deutschen Soldaten erschossen.
Sofern Wilfreda Clay überhaupt Mutterliebe empfindet, kann sie diese glänzend verbergen. Hat der Nachwuchs Kummer, bügelt sie ihn mit stets passenden Sprüchen ab. »So ist es nun mal, ob's dir passt oder nicht.« »Mach kein Theater, ich kann Theater nicht ausstehen.« – solche Ermahnungen, kein Aufhebens um unveränderbare Dinge zu machen (und sie nicht damit zu behelligen), bleiben Amory zeitlebens präsent. Dank eines finanziellen Erbes kann die Erstgeborene in einem Internat untergebracht werden. Dort fühlt sie sich erst recht von der Familie ausgestoßen.
Das wichtigste Ereignis in Amorys unspektakulärer Schulzeit ist ein frühes Geschenk. Ihr geliebter Onkel Greville, Fotograf der upper classes überrascht sie zu ihrem siebten Geburtstag mit einer Kodak Brownie und löst damit eine Initialzündung aus, die die Weichen für ihre Zukunft stellt: Mit einem »Klick ... den Augenblick einfangen ... für alle Zeit fixieren«. Amory spürt mit dem »Wunderapparat« eine »Macht« in ihren Händen, aus der eine große Leidenschaft erwächst.
Onkel Greville ist allerdings auch mitverantwortlich für ein erstes grandioses Scheitern seiner Nichte. Indem sie ihn zu Hochzeiten und Gesellschaften begleitet, erlernt sie die »Alchemie« der Fotografie. Um jedoch als Frau auf eigenen Füßen stehen zu können, muss sie schon Aufsehenerregendes leisten. Er rät, sie solle einen »Skandal kreieren«. Dazu reist Amory nach Berlin, sucht in der verruchten Halbwelt der Bars und Bordelle der Metropole bislang nie öffentlich gehandelte Motive und fotografiert sie »authentisch«. Von der Presse befeuert, ereifert sich die britische Öffentlichkeit über die Widerwärtigkeiten und Obszönitäten, und so gelangt Amory zu trauriger Berühmtheit und zu einem Strafverfahren am Halse. Die Skandalfotos werden vernichtet, und ihre Schöpferin kehrt nach London zurück.
Dort hat das »verkommene Subjekt« keine Chance auf eine Anstellung. Aber das Schicksal ist nachsichtig und schickt ihr Rettung in Gestalt des Amerikaners Cleve, zwei Jahre jünger als ihr Vater. Er verschafft ihr einen gut bezahlten Job bei einem New Yorker Fotojournal. Das Liebesverhältnis zwischen den beiden hält viele Jahre an, doch seine Ehe möchte Cleve nicht dafür aufgeben.
Im Auftrag der amerikanischen Zeitschrift geht Amory als Bildreporterin und Kriegsfotografin nach Paris und Deutschland. Die Eindrücke, zum Beispiel in Wesel, erschüttern und ernüchtern sie. Erst ein Vierteljahrhundert später zieht es sie noch einmal zu einem Krisenherd – nach Vietnam. Dazwischen liegt eine Auszeit als Berufsfotografin: Sie heiratet Lord Farr of Glencrossan und bringt Zwillinge zur Welt – ein weiteres der »vielen Leben der Amory Clay«.
Ende der Siebzigerjahre verbringt Amory Clay ihre letzte Lebensphase zurückgezogen in einem Landhaus auf der Hebrideninsel Barrandale. Eine schleichende Krankheit hat sie befallen. Sie führt ihren Hund spazieren, trinkt mittags Gin, abends Whisky und schweift mit ihren Gedanken weit in die Vergangenheit zurück. Wenn sie ab und zu in ihre Tagebücher schreibt, erzählt sie detailreich und abgeklärt von ihrem bewegten Leben, ihrem steten Kampf, sich als Frau in ihrem Job an diversen Kriegsschauplätzen der Welt zu behaupten, und von mehreren Liebesbeziehungen. Sie reflektiert über ihre ups and downs, die guten und die schlechten Zeiten. Wie jeder Mensch hat sie Fehler gemacht, und oft haben sie sich erst im Nachhinein als solche erwiesen. Sie stellt verwundert fest, dass es zu ›Fehler‹ kein Antonym gibt.
Die Abgründe ihres Lebens hat sie in den Kriegen durchschritten, und noch in Friedenszeiten ziehen die Kriegserlebnisse eine breite Spur nach sich. Sie steckte hautnah mittendrin im Kampfgemetzel, wurde selbst verletzt, verbrachte Wochen in einer Klinik auf dem Land, wo sie von der militärisch-politischen Entwicklung abgeschottet war. Nur mit nach vorne gerichtetem Blick konnte sie solchen Lagen entkommen.
Männer blieben ihr im Wesen rätselhaft. Obwohl sie Seite an Seite mit ihnen arbeitete und lebte, lernte sie sie und ihre alltäglichen Verhaltensweisen nicht zu verstehen. Männer teilen sich nicht mit, leben ihre Belastungen anders aus. Manche ertränken sie heimlich in Alkohol oder anderen Süchten, wie ihr verstorbener Ehemann Lord Farr, der Haus und Hof nahezu restlos verspielte.
Was der Krieg anrichtet, erlebte Amory auch an ihrem Vater. Beverley Vernon Clay, Schriftsteller und Verlagslektor, war ein fröhlicher, liebevoller Mann und immer zu einem Ulk aufgelegt. Die Kinder waren sprachlos, wenn er einen Handstand machte und sie im Scherz bedauerte als »arme irregeleitete Seelen [...], weil wir eine Welt bewohnten, die auf dem Kopf stand«. Aus dem I. Weltkrieg kehrt der Vater völlig verändert zurück. Er spricht wenig, bringt kaum etwas zu Papier. Eines Tages lenkt er sein Auto – mit Amory auf dem Beifahrersitz – in einen See. Er wollte »nicht allein sterben«. »Du solltest mitkommen.« Die entsetzliche Gewalttat, die verstörenden Sätze entrücken den Vater dem jungen Mädchen. Lange scheut sie sich, ihn in der privaten Nervenklinik zu besuchen, wo er mit der Diagnose »Wahnsinn« untergebracht wird. Ihr gesamtes späteres Gefühlsleben wird beeinträchtigt. Niemals wird sie es schaffen, einem Mann wirklich zu vertrauen, selbst wenn sie ihn aufrichtig liebt, und nur sich selber, ihrer inneren Stimme wird sie zuhören. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Amory Clay zu der selbstsicheren, nicht unterzukriegenden, zähen und unnahbaren Frau, als die sie (angeblich) noch heute berühmt ist.
Als Amorys fünfundsiebzigster Geburtstag bevorsteht, hat sie alles fertig geordnet und inventarisiert. Wer, wie sie, zu erkennen vermag, »wann das Leben nicht mehr lebenswert ist [...], kann getrost sterben«. Sie beendet ihr Leben »durch eigene Hand«, in Würde.
»Sweet Caress«  , übersetzt von Patricia Klobusiczky und Ulrike Thiesmeyer, ist nicht nur ein clever konzipiertes und überzeugend realisiertes Spiel mit der Wirklichkeit, sondern auch stilistisch vielfältig. Besonders die packenden Reportagen, etwa aus Vietnam (Hubschrauberflug zum Dorf »Pluto«), belegen William Boyds schriftstellerische Meisterschaft. Satte fünfhundertfünfzig Seiten gut gemachter, spannender und zeitgeschichtlich aufschlussreicher Unterhaltung, ein brillanter Tanz in einem Spiegelsaal.
, übersetzt von Patricia Klobusiczky und Ulrike Thiesmeyer, ist nicht nur ein clever konzipiertes und überzeugend realisiertes Spiel mit der Wirklichkeit, sondern auch stilistisch vielfältig. Besonders die packenden Reportagen, etwa aus Vietnam (Hubschrauberflug zum Dorf »Pluto«), belegen William Boyds schriftstellerische Meisterschaft. Satte fünfhundertfünfzig Seiten gut gemachter, spannender und zeitgeschichtlich aufschlussreicher Unterhaltung, ein brillanter Tanz in einem Spiegelsaal.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Frühjahr 2016 aufgenommen.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: