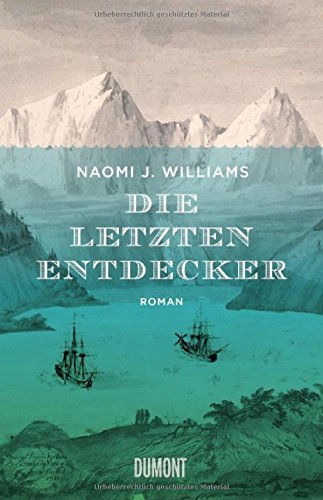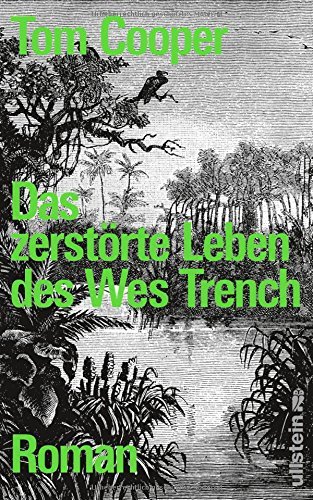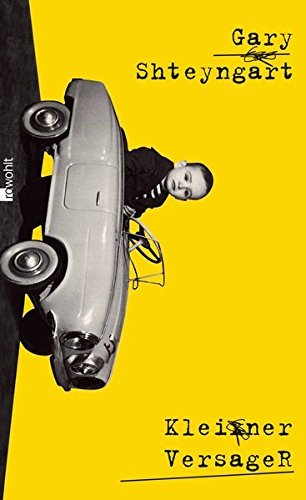
Zum Schreien komisch. Zum Weglaufen traurig.
Mit zehn Jahren tippt Gary Shteyngart einen Sainz-Fiktschn-Roman (fünfzig Seiten abseits jeder Orthografie) in die Kugelkopf-Schreibmaschine seines Vaters. Noch keine dreizehn ist er, als er die Thora satirisch neu erfindet und (zum authentischen Aufrollen) auf Endlospapier ausdruckt. Gerade mal vierzig ist er, als er seine Autobiografie verfasst. Ein »Versager«?
Das kommt auf die Perspektive an. Seine Eltern – Antipoden der heutigen ›Helikoptereltern‹ – machen von Anfang an kein Hehl daraus, was sie von ihrem ersten (und einzigen) Kind halten. Es kommt am 5. Juli 1972 im Leningrader Otto-Geburtshaus zur Welt, mit einem »Riesenschädel« als »Dackel in Menschengestalt«, und erhält den Namen Igor. Traditionsgemäß wird der Neugeborene stramm in Tücher gewickelt – zu eng für Igor. Fast stranguliert erreicht er die elterliche Wohnung und bedarf eines notärztlichen Hausbesuchs, um sich nicht gleich wieder zu verabschieden.
Die nächsten dreizehn Jahre hat das unerwartet »schlecht funktionierende Lebewesen« mit dem asthmatischen Schleim seiner Lungen zu kämpfen, wird »in eine Festung aus Kissen und Bettdecken« versenkt, von den Eltern liebevoll, verängstigt, traurig, wütend und enttäuscht versorgt. »Ach, du Rotznase«, seufzt Vater Semjon, wenn er das »kaputte Kind« in seinen Armen hält, während Mutter es guten Mutes »Solnyschko« (kleiner Sonnenschein) benennt. Im Sommer entflieht die Familie der schädlichen Luft Leningrads zu einem Urlaub auf der Krim.
Igors Eltern streiten, dass die Fetzen fliegen. Sie sind »zu verschieden für eine glückliche Ehe«. Die Mutter entstammt altem »Petersburger Bildungsbürgertum« und blickt verächtlich herab auf die schwierigen dörflichen Wurzeln des Vaters (»primitiv und provinziell«), während dieser die andere Seite für »hochnäsig und verlogen« hält. Aber beide sind intelligent, kulturell ambitioniert und leistungsfähig. Der Vater baut große Teleskope in einer Fabrik, er hat eine blühende Fantasie und schriftstellerisches Talent.
Zu seinem Söhnchen aber ist er unnachgiebig streng. Aus dem Kind soll mal etwas werden, zum Beispiel ein Kosmonaut, Traumberuf aller russischen Jungs. Aus seinem Heimatdorf kennt Semjon die dort seit Langem bewährten drastischen Maßnahmen zur Formung des Nachwuchses. »Wenn du jemanden dazu bringen willst, dich zu lieben, zum Beispiel ein Kind, solltest du es ordentlich verdreschen.« Solange Igor dem Vater nur auf die Nerven geht, kommt er mit einem harmlosen »Nackenklatscher« davon; schlimmer sind die »schwindelerregenden Schläge«, die eine »unverbrüchliche Verbindung zum Kind« herstellen sollen. Nur zum Wohle des Knaben zwingt Semjon ihn, eine extra in der Wohnung montierte Sprossenwand emporzuhangeln. Das soll ihm seine unüberwindliche Höhenangst austreiben und den Weg in den Weltraum ebnen.
De facto erzeugt Semjon mit seinen rustikalen Abhärtungsmethoden eine Fülle neuer Ängste. Angst vorm Absturz, Angst, der Vater werde ihm noch mehr zusetzen, ihn erschrecken, von der Sprossenwand schubsen. Angst, der Vater könne ihn beim Versteckspiel nicht finden, sei gar nicht ehrlich besorgt, wenn er jammert: »Ich habe meinen Sohn verloren!« Angst vorm Ein- und Ausatmen. Nichts wird ihm geschenkt. Nach dem Versteckspiel unter der alles überragenden Lenin-Statue auf dem Moskauer Platz hat sich das fragile Kind erkältet, heftige Asthmaattacken und die schmerzhafte Therapie mit feuerheißen Schröpfgläsern malträtieren ihn.
Igors Mutter wendet subtilere Strategien an. Sie ist eine »Expertin für die Schweigebestrafung« und kann das Söhnchen tagelang ignorieren. Sein Schreien und Flehen beeindrucken sie nicht. Die verzweifelte Androhung »Wenn du nicht mehr mit mir sprichst, will ich nicht mehr leben« ist ihr nichts als Stoff für theatralisches Nachspielen der Episode zwecks Belustigung der Kaffeerunde.
Nicht nur Igors Psyche und schwächlicher Körper leiden unter diesen Bedingungen, sondern auch seine Sozialisierung. Erst mit fünf Jahren schließt er eine Freundschaft. Wladimir, Schwimmer und Schlittschuhläufer, ist Bolschewik und verehrt Lenin.
Mit fünf beschließt Igor, Schriftsteller zu werden, und seine Großmutter Galja, Journalistin bei der Leningrader Abendzeitung, ermuntert und unterstützt ihn auf kindgerechte, fantasievolle Art. Eine abgedrehte kleine Geschichte über »Lenin und seine magische Gans« (nach Nils-Holgersson-Motiven) ist sein erstes Produkt, und es ist noch nach vielen Jahren vorlesbar.
Zwei Jahre später emigrieren die Shteyngarts mit den Großeltern väterlicherseits nach Amerika. Dort genießen sie Freiheit, Fortschritt und Asthmaspray, aber sie bleiben vorerst arm, isoliert und als »Kommunisten« unwillkommen. Obwohl aus Igor (»so heißt Frankensteins Gehilfe«) jetzt Gary (wie Filmstar Cooper) wird, erwartet ihn auch hier kein Zuckerschlecken. Wegen unzureichender Sprachkenntnisse wird er in der jüdischen Tagesschule zurückgestuft, als »vermaledeite Rote Rennmaus, ein Kommi« verlacht. Um in seiner Außenseiterrolle zu überleben, kultiviert er mit der Zeit seine Liebe zum »Witzigen«, wählt den »Humor« und das Schreiben als Zufluchtsorte. Seine erste englische Geschichte handelt von Flyboy, einem Weltraum-Kampfpiloten mit eigenwilliger Aussprache, sie heißt »Die Prüfunk« [sic!] und trieft vor Hass auf sich selbst und auf alle Menschen, die auf ihn einschlagen. Auf einer Frühform von Computertastatur schreibt er seine eigene Thora, nennt sie »Gnorah«, verschmilzt als Person mit seiner ausufernden Satire und erntet als »Gary Gnu der Dritte« tobendes Gelächter und endlich etwas positive Aufmerksamkeit. Zwar wird der Jungautor noch lange nicht geliebt, so wie er es sich ersehnt, doch immerhin avanciert er vom »nicht gesellschaftsfähigen Spinner zum geduldeten Exzentriker«.
Bei seinen Eltern kann er auf diesem Weg natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Für sie bleibt er »ein grottenschlechter Schüler«, der sich seine Zukunft versaut. In einem Mischmasch aus Englisch und Russisch nennt die hartherzige Mutter ihren Sohn »failurtschka«, kleiner Versager. Bis Gary die Schmähung adelt, indem er seinen sarkastischen autobiografischen Roman damit betitelt (»Little Failure. A Memoir«  , übersetzt von Mayela Gerhardt) und diesen seinen Schmähern widmet, müssen weitere leidvolle Jahre vergehen. Zwölf davon sind von psychoanalytischer Behandlung begleitet. Sie gibt ihm Rückhalt, trotz seiner Eltern zu wachsen, hält ihn davon ab, sich Selbstmordgedanken zu ergeben, und setzt ihn am Ende in die Lage, den Satz über seine Lippen zu bringen, den ihm der Psychiater als Gegengift gegen alle herabsetzenden Anfeindungen der Eltern eingetrichtert hat: »Ich bin kein schlechter Sohn.«
, übersetzt von Mayela Gerhardt) und diesen seinen Schmähern widmet, müssen weitere leidvolle Jahre vergehen. Zwölf davon sind von psychoanalytischer Behandlung begleitet. Sie gibt ihm Rückhalt, trotz seiner Eltern zu wachsen, hält ihn davon ab, sich Selbstmordgedanken zu ergeben, und setzt ihn am Ende in die Lage, den Satz über seine Lippen zu bringen, den ihm der Psychiater als Gegengift gegen alle herabsetzenden Anfeindungen der Eltern eingetrichtert hat: »Ich bin kein schlechter Sohn.«
Im Juni 2011 reist Gary mit seinen Eltern nach Russland, um die Orte ihres früheren Lebens zu besuchen, darunter Semjons Heimatdorf. Dort enthüllt der Vater endlich ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit. Der mittlerweile in der Psychoanalyse erfahrene Sohn kann danach manches »verstehen«, nicht aber verzeihen oder lieben. Immerhin versöhnen sich Vater und Sohn, begegnen einander auf Augenhöhe. Gary kann seine Vergangenheit zusammenfalten, nach vorne blicken, und »die zweite Hälfte meines Lebens beginnt«.
Zur ersten Hälfte hat Gary Shteyngart inzwischen hinreichende Distanz gefunden, um sie auf unterhaltsame, unverkrampfte Weise zu erzählen. Er plaudert im Prinzip chronologisch voran, aber Zukünftiges und Vergangenes lassen sich nicht bändigen. Erlebnisse und Erinnerungen sprudeln reichhaltig, und er garniert sie mit scharfen Beobachtungen, intelligenten Reflexionen sowie mit Bemerkungen, die das ganze Spektrum zwischen Witz, Ironie, Sarkasmus, Zynismus und tieferer Bedeutung ausschöpfen. Jede Menge Seitenhiebe erhalten die Politik und die jüdische, amerikanische und russische Kultur, wie sie der Familie auf den Stationen ihres Lebenswegs von Leningrad über Berlin-Schönefeld, Wien, Rom, New York und die amerikanische Provinz begegnen. Sich selbst nimmt der Autor verständnisvoll, mit viel Ironie, aber zum Glück niemals larmoyant aufs Korn. Eine wichtige Rolle übernehmen die vielen Schwarz-Weiß-Fotos direkt aus dem Familienalbum. Den meisten haftet eine eigenartig melancholische Aura an, die durch die ironisch-witzigen Bildunterschriften eher noch verstärkt wird.
Ein »Versager«? Keine Spur.
 · Herkunft:
· Herkunft: