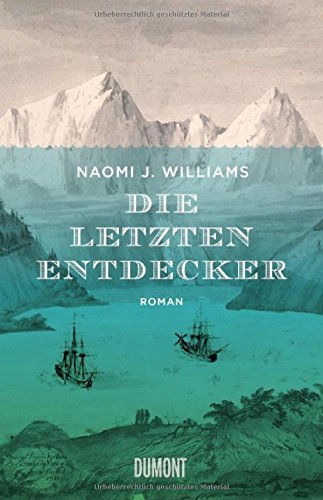
Weltreisende mit offenen Augen und Ohren
Als der erfahrene französische Kapitän Jean-François de Galaup de Lapérouse 1785 in See stach, hatte er ein paar Jahrzehnte Verspätung. Frankreich war auf den Meeren der Welt ins Hintertreffen geraten. Ob die Briten nun schneller, draufgängerischer oder geschickter organisiert waren, sie hatten seit über zweihundert Jahren den Union Jack rund um den Globus auf jedem Strand gehisst, an dem eines ihrer Schiffe angelandet war. Kaufleute hatten Handelsstationen gegründet, Wissenschaftler den Ort vermessen, das Terrain sondiert, Flora und Fauna beschrieben und gezeichnet. Auch Portugiesen, Spanier und Niederländer waren längst global unterwegs.
Dennoch gibt der französische König Ludwig XVI. Lapérouse den kostspieligen Auftrag, mit zwei hochmodern ausgestatteten und hochqualifiziert besetzten Schiffen, der Boussole und der Astrolabe, den Pazifik in der nördlichen und südlichen Hemisphäre zu erkunden. Ein ambitioniertes, mehrjähriges Unternehmen, das Frankreich Prestige und einen größeren Happen der weltweiten Handelsmöglichkeiten verschaffen soll.
Doch welchen Ruhm gibt es noch zu erringen, wo die Ozeane längst von lukrativen Handelsrouten durchzogen, alle bekannten Inseln in Besitz genommen und verwaltet, Häfen und Untiefen auf den Seekarten verzeichnet sind? Es gibt kaum einen Bereich zwischen Nord- und Südpol, dem Bau raffinierter Navigationsinstrumente und medizinischem Wissen (etwa um Skorbut), in dem nicht Briten als Wegbereiter und Experten gelten. Über allen thront James Cook, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten drei ungemein ertragreiche Weltreisen unternommen hatte und bei seiner letzten zu Tode gekommen war. Das ist erst sechs Jahre her. Eine Marmorbüste des Unerreichbaren steht auf dem Schreibtisch in Lapérouse' Kajüte.
Daneben begleitet den Kommandanten noch eine zweite programmatische Büste. Jean-Jacques Rousseau (sieben Jahre zuvor verstorben) steht für die aufgeklärte, rationale Haltung, mit der die Franzosen der pazifischen Welt zu begegnen beabsichtigen, als Reisende mit offenen Augen und Ohren. Krämerkleingeist, Unterjochung, Ausbeutung, Missionierung und Intoleranz sollen ein Ende haben.
Aber alle sind sich darüber im Klaren, dass für den Igel keine Sensationen mehr zu holen sind, wenn er dem Hasen hinterhersegelt. Vielleicht findet man irgendwo in den Weiten noch ein bislang übersehenes Eiland, einen Küstenstrich, der Frankreich einmal zu irgend etwas nütze sein kann. Aber wahrscheinlich wird es bei kleinen Ehren bleiben. Seeleute werden es zu schätzen wissen, wenn auf ihren Karten die eine oder andere Geisterinsel, die nie mehr war als eine Nebelbank im Teleskop, getilgt und die irreführend fehlerhafte Position einer Bucht oder eines Riffs endlich korrigiert wird. In akademischen Kreisen wird gewürdigt werden, was für neue Tiere, Pflanzen, Minerale die ehrgeizigen Wissenschaftler an fernen Gestaden aufspüren.
Uns stellt sich die (ketzerische) Frage: Trägt das alles als Romanstoff? Was den Ertrag seiner weiten Reisen betrifft, bleibt Lapérouse ewiger Zweiter. Selbst das Lapérouse-Museum in seiner Heimatstadt Albi umfasst nur zwei (unbedingt sehenswerte!) Räume. Und steht nicht auch das literarische Sujet im Schatten britischer Vorreiter? Gelungene historische Romane vor kolonialem Hintergrund an exotischen Schauplätzen gibt es zuhauf (z.B. David Mitchells »Die tausend Herbste des Jacob de Zoet«, um nur einen einzigen – und in vielerlei Hinsicht vergleichbaren – zu nennen). In puncto Dreimast-Abenteuern auf den Weltmeeren hat Patrick O'Brian (1914-2000) eine großartige Romanserie um den pflichtbewusst-konservativen Kapitän Jack Aubrey und seinen liberalen Freund, den Schiffsarzt Stephen Maturin verfasst, die mit historischem und nautischem Fachwissen und feiner Charakterzeichnung glänzt (Verfilmung von Russell Crowe: »Master & Commander – Bis ans Ende der Welt«).
Naomi J. Williams überrascht gleich in ihrem Debütroman (»Landfalls«  ) mit einem gänzlich anderen Zugang. In vierzehn Kapiteln, einem Prolog und einem Epilog gestaltet sie aus den unterschiedlichsten Perspektiven Episoden, die sich vor der Abreise in London, in Weltgegenden zwischen Sibirien und Kalifornien und – zwanzig Jahre nach Lapérouse' Tod – daheim in Albi zugetragen haben könnten. Offiziere und Mannschaftsgrade, Priester, Familienangehörige, Eingeborene und Kolonialbeamte erzählen, schreiben offizielle und private Briefe, reflektieren, tragen ins Logbuch ein. Wir lesen ausführliche Konversationen, Tischgespräche mit feinen Damen, Erörterungen in der Offiziersmesse, Verhandlungen mit Gouverneuren, spanischen Mönchen, russischen Soldaten und Bauern. Wir lesen von bis zur Selbstaufgabe Pflichtbewussten, von Tapferen, Ehrgeizlingen, Aufrechten, Saufbolden, Idealisten und Verbohrten. Wir lesen detaillierte Berichte von hindernisreichen Überlandreisen, Festivitäten, Ritualen. Wir lesen anschauliche Beschreibungen von Unterkünften, Kleidung, Mahlzeiten. Wir lesen von Erwartungen, Erfolgen, Frustrationen, Optimismus, Skepsis und folgenreichen Fehlern.
) mit einem gänzlich anderen Zugang. In vierzehn Kapiteln, einem Prolog und einem Epilog gestaltet sie aus den unterschiedlichsten Perspektiven Episoden, die sich vor der Abreise in London, in Weltgegenden zwischen Sibirien und Kalifornien und – zwanzig Jahre nach Lapérouse' Tod – daheim in Albi zugetragen haben könnten. Offiziere und Mannschaftsgrade, Priester, Familienangehörige, Eingeborene und Kolonialbeamte erzählen, schreiben offizielle und private Briefe, reflektieren, tragen ins Logbuch ein. Wir lesen ausführliche Konversationen, Tischgespräche mit feinen Damen, Erörterungen in der Offiziersmesse, Verhandlungen mit Gouverneuren, spanischen Mönchen, russischen Soldaten und Bauern. Wir lesen von bis zur Selbstaufgabe Pflichtbewussten, von Tapferen, Ehrgeizlingen, Aufrechten, Saufbolden, Idealisten und Verbohrten. Wir lesen detaillierte Berichte von hindernisreichen Überlandreisen, Festivitäten, Ritualen. Wir lesen anschauliche Beschreibungen von Unterkünften, Kleidung, Mahlzeiten. Wir lesen von Erwartungen, Erfolgen, Frustrationen, Optimismus, Skepsis und folgenreichen Fehlern.
Was wir selten oder gar nicht lesen (und ich lange vermisst habe), sind Szenen aus dem Alltag auf hoher See, von lebensbedrohlichen Stürmen, von kämpferischen Auseinandersetzungen, aus Lapérouse' bewegtem Vorleben (u.a. im Indischen Ozean, im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg) oder überhaupt Dramatisches. So etwas, wie auch das katastrophale Ende der Expedition im Jahr 1788, als Boussole und Astrolabe unter bis heute nicht vollständig geklärten Umständen mit Mann und Maus spurlos verschwanden, erscheint nur indirekt, als Randnotiz, in der Rückschau.
Die Kunst der Aussparung des Selbstverständlichen? Mehr als das. Verglichen mit O'Brian fehlen Salzwasser-Abenteuer, verglichen mit Joseph Conrad fehlen Spannungsbögen und wuchtige Tragik. Wer auf diese Elemente und selbst auf eine konsistente Plot-Linie verzichten kann, wird einen multiperspektivischen, multistilistischen, multiepisodischen Gesellschaftsroman genießen, der gelegentlich auf Schiffsplanken spielt. Am Ende setzen sich aus den unendlich vielen Mosaiksteinchen zahlreiche wunderbare, differenzierte Charakterbilder zusammen, wobei die erstaunlichen Porträts von Randfiguren traditioneller Geschichtsforschung – die Ehefrau eines Gouverneurs in Chile, ein Inuit-Mädchen in Alaska, die Ehefrau eines französischen Schiffbrüchigen auf den Salomonen – am nachhaltigsten beeindrucken. Vor allem hier erweist Naomi J. Williams bereits in ihrem Debütroman überzeugende Qualität und gestalterische Originalität. Interessant auch, dass über all die Unterhaltungen und Zweit- und Dritthand-Berichte das Wesen einer solchen weltumspannenden Entdeckungsreise, ihre Unwägbarkeiten und Gefahren, ihr Tragik-, Enttäuschungs- und Glückspotenzial sehr intensiv zu erspüren sind, ohne dass derlei jemals szenisch ausgebreitet wird.
Bleibt lobend zu erwähnen, dass der Abfassung dieses originellen Romans gewaltige Recherchen vorausgegangen sind. Selbst in dieser Hinsicht umschifft die Autorin allerdings allzu nahe Liegendes: Hinsichtlich Segelkunde, Nautik, Naturkunde, Geologie erfahren wir nur Oberflächliches. Umso sachkundiger schreibt sie über winterliche Lebensbedingungen in Sibirien, die Tricks der Porträtmaler, über Kupferstichfaksimiles und biografische Details ihrer (historischen) Figuren. Den Großteil ihres Buches gestaltet Naomi J. Williams freilich aus ihrer reichen, disziplinierten Fantasie.
Ein intelligent konzipiertes, psychologisch feinsinniges, elegant formuliertes (von Monika Köpfer ausgezeichnet übersetzt), leicht zu unterschätzendes Erstlingswerk, das leider Gefahr läuft, diejenigen, die durch Thema und Titel angelockt werden, zu enttäuschen, und diejenigen, die es begeistern könnte, durch Titel und Thema abzuschrecken.
 · Herkunft:
· Herkunft: 

