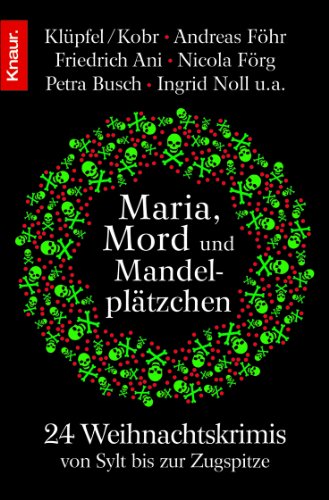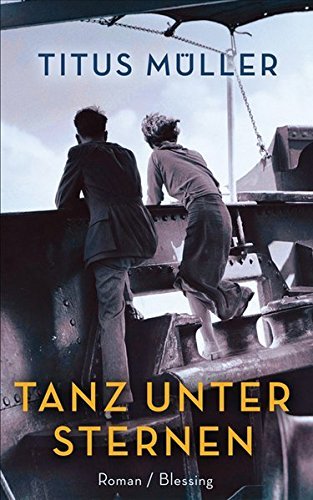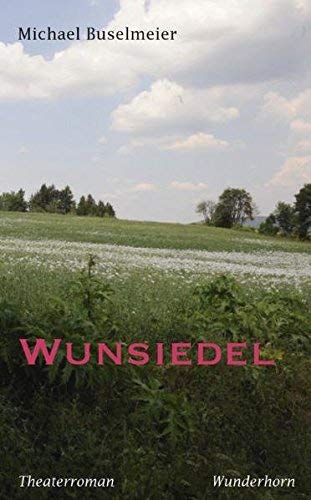
Wunsiedel
von Michael Buselmeier
Ein junger Schauspieler bekommt 1964 seine erste Anstellung bei einer Provinzbühne und scheitert dort mit all seinen Theater- und Lebensidealen. Vier Jahrzehnte später sucht er die Stätten des Desasters erneut auf und erkennt nicht nur seine damaligen Unzulänglichkeiten, sondern auch, welche Schätze ihm damals in seiner Verbitterung verborgen blieben.
Hass Liebe
Das Scheitern eines Schauspieler-Novizen, seine auf den Ort und seine Mitmenschen projizierten Selbstzweifel, seine späte Rückkehr und die Rehabilitierung des damals Verschmähten – ist das nicht ein arg triviales Sujet? Mag sein – aber das Lesen dieses Kleinods von einem Roman ist ein Genuss, fasziniert, macht süchtig. Wie das?
Da ist der ästhetische, bildkräftige Sprachstil, der einen genussvoll gleitenden Lesefluss erlaubt und alle Sinne anspricht. Buselmeiers Prosa entfaltet sich meisterlich an fachkundigen Naturschilderungen, anfangs überlagert von selbstquälerischen Empfindungen, bei der Rückkehr 2008 befreit, geradezu jubilierend, mit hochpräzisen Sinneseindrücken von flirrender Hitze, Tierlauten, Gerüchen, Wolken ... Oft ist der Satzbau gebrochen mit Aufzählungen, Partizipien, Fragmenten, passend zur assoziativen Erzählstruktur.
Die Themen der Absätze wechseln scheinbar ohne System und doch in ruhigem Rhythmus zwischen den Zeiten, Personen, Landschaften und erfassen weit mehr, als die Gattungsbezeichnung (»ein Theaterroman«) erwarten lässt. Reizvoll die vielen Charakterstudien – der Spezies Schauspieler, einiger Wunsiedler Bürger, der Mutter, der Freundin und ihrer Familie; aufschlussreich die prägnanten Exkurse über »Götz von Berlichingen«, über Theatertheorien und praxis; fein die kleinen Einblicke in vitae und Werke diverser Künstler – Goethe, Hans Sachs, Richard Wagner und allen voran Jean Paul, Wunsiedels bedeutendster Sohn. Dessen irrwitzige, heute weithin unbekannten Romane studierte Schoppe vor Ort, und Buselmeiers altmeisterliche Wortkunst ist offenkundig an Vorbildern wie Jean Paul geschult.
Da ist die Relativität der Perspektive: IchErzähler Moritz Schoppe durchlebt in der Rückschau erneut und en detail seine Initiation in der TheaterWelt.
Nach den üblichen Vertröstungen auf der Suche nach einem Engagement findet der junge Idealist endlich einen, der ihn ernst nimmt und etwas zu sagen hat: Friedrich Siems, den Intendanten der LuisenburgFestspiele in Wunsiedel, Oberfranken. Der stellt ihn als Regieassistenten für die Sommersaison 1964 ein, gibt ihm Anerkennung, Verantwortung und Perspektive. Schoppe schickt sich an, die Theaterwelt zu erobern und zu revolutionieren. Doch leider stirbt Siems unerwartet. Als Schoppe seine Arbeit unter Siems' Nachfolger Christian Mettin aufnimmt, erkennt er schnell, dass intellektuelles Mittelmaß, gewohnheitsmäßiges Desinteresse, abgestumpfte Routinen, fassadenhafte Charaktere die Arbeit an Deutschlands ältester Freilichtbühne bestimmen. Offene Ablehnung, höhnische Demütigungen drücken ihn nieder, verbittern ihn; er wird passiv, orientierungslos, hasserfüllt. Schließlich verliert er noch seine Heidelberger Freundin Ulla an einen Rivalen.
Bei allem Verständnis für die Leiden des jungen Stürmers und Drängers in seiner »Wunsiedeler Theatergruft« hält sich unsere Sympathie für ihn jedoch in Grenzen, denn nach und nach seziert der Erzähler sein Jugendbildnis schonungslos: »eine Mischung aus Anmaßung und Furchtsamkeit, IchBesessenheit und Depression, aus Besserwisserei und der Unfähigkeit, standzuhalten und etwas zu leisten. Ich lief ... wie ein offenes Messer herum ... Ich hatte die allerhöchsten Ansprüche an mich, an die anderen und an den Weltkreis, brachte aber so gut wie nichts zustande«.
Was klingen mag wie strafende Selbstverachtung, ist aber »Staunen über mich selbst«, ausgelöst durch die Rückkehr an den Schauplatz der »zehn lehrreiche[n] Lebens und Leidenswochen« nach vierundvierzig Jahren. Das Wunsiedel revisitedErlebnis ermöglicht es dem gereiften, lebensweisen Erzähler, abzurechnen mit sich und seinen Erfahrungen, und er wird frei für bisher verstellte, überraschende Perspektiven auf den anrührenden Ort, die herbe Landschaft. Er erlebt eine »sanfte Amnesie«.
Schoppes ganzes Leben bis zur Abreise aus Wunsiedel ist eine Geschichte der Verluste, des Verlierens, der erzwungenen schmerzhaften Abschiede: von den Handpuppen des Knaben; von der Mutter, die ihn in einem Heim zurückließ; von Ulla; von den Illusionen und der Kompromisslosigkeit des Idealisten.
Schließlich ist da der Reiz des Autobiographischen: Ist Moritz Schoppes Selbstfindungsweg vom SchauspielEleven, enthusiastisch, aber an der Realität scheiternd, zum gesetzten Schriftsteller, mit sich und der Welt im Reinen, bloße Fiktion? Gedankenspiele über das Theater, die Kunst, das Leben, und Wunsiedel ist ihr Katalysator (Der Autor hätte aber auch Bad Hersfeld wählen können ...)? Oder ist Schoppe Buselmeiers Alter Ego? Der Autor selbdritt: Schaut Buselmeier (alt) durch Schoppe (alt) auf Schoppe (jung) , dabei auch Buselmeier (jung) ins Visier nehmend, ohne sich vollständig outen zu müssen? Schon 1989 hatte Buselmeier »Schoppe. Ein Landroman«  veröffentlicht ... Gab es 1964 einen Regieassistenten Michael Buselmeier auf der Luisenburg? (Leider ist deren Archiv noch nicht im Internet einsehbar.) Fest steht: Nur einer, der Wunsiedel damals selbst erforscht hat, kann die Gässchen, den Marktplatz, die Gaststätten, den Bahnhof, bestimmte Einwohner der titelgebenden Kleinstadt in ihrem Zustand jener längst vergangenen Epoche so akribisch, so detailverliebt und vor allem so authentisch ins Leben zurück holen wie der Autor. Und auch mit den Besprechungsräumen und Garderoben, dem gewaltigen Felsgebirge auf der Freilichtbühne, den unterirdischen Labyrinthen, dank derer die Schauspieler links unten abgehen und ganz oben, quasi aus den Wolken herab, wieder auftauchen können, muss er bestens vertraut sein.
veröffentlicht ... Gab es 1964 einen Regieassistenten Michael Buselmeier auf der Luisenburg? (Leider ist deren Archiv noch nicht im Internet einsehbar.) Fest steht: Nur einer, der Wunsiedel damals selbst erforscht hat, kann die Gässchen, den Marktplatz, die Gaststätten, den Bahnhof, bestimmte Einwohner der titelgebenden Kleinstadt in ihrem Zustand jener längst vergangenen Epoche so akribisch, so detailverliebt und vor allem so authentisch ins Leben zurück holen wie der Autor. Und auch mit den Besprechungsräumen und Garderoben, dem gewaltigen Felsgebirge auf der Freilichtbühne, den unterirdischen Labyrinthen, dank derer die Schauspieler links unten abgehen und ganz oben, quasi aus den Wolken herab, wieder auftauchen können, muss er bestens vertraut sein.
Wie dem auch sei: Als windfall profit holt dieser erfolgreiche Roman (in die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 aufgenommen) die »kleine, aber gute lichte Stadt« (Jean Paul) ein wenig aus ihrer Schattenlage. Seit Jahrzehnten zählt die herbe, notorisch unterkühlte Gegend unverdientermaßen zu den Verlierern. Weitab von den Transitwegen, erst »Zonenrandgebiet«, dann, nach dem Fall des nahen »Eisernen Vorhangs«, chancenlos gegen die »Billiglohnländer«, sind viele Einwohner weggezogen, um ihr Glück anderswo zu suchen. Die heimischen Märkte sind weggebrochen, Gebäude verfallen, Niveaus gesunken, Touristen ausgeblieben. Obwohl Moritz Schoppe das Provinztheater der LuisenburgFestspiele schon in der Blütezeit der Sechziger als plumpe Anbiederung an die schlichten Bedürfnisse des ländlichen Publikums verachtet und der Autor den Niedergang der Stadt bis 2008 ungeschönt vor Augen führt, ist Buselmeiers Ton stets gelassen, niemals böse, eher wehmütigbedauernd. Die Wunsiedel gewidmeten Teile seines Romans klingen wie verhaltene Liebeserklärungen an das Städtchen und seine Umgebung.
 · Herkunft:
· Herkunft: