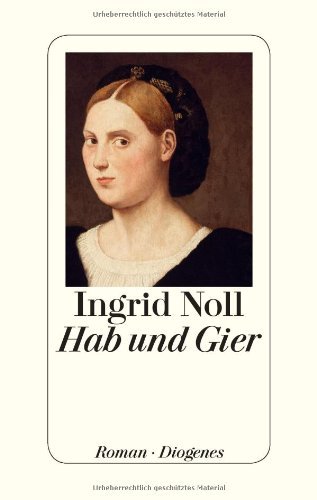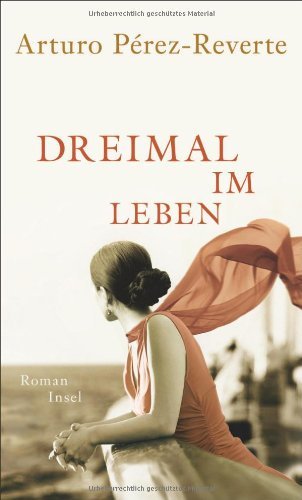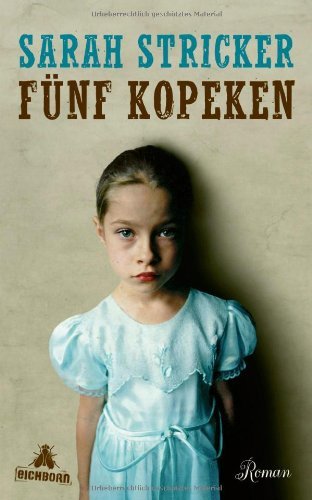
Mutters andere Seite
Tochter und Mutter schenken einander kein gutes Wort. Unverblümt formuliert Anna: »Meine Mutter war sehr hässlich. Dürr ... bleich ... spitzes Kinn ... noch spitzeren Mund ... blind wie ein Fisch.« Nie nennt sie ihren Namen. Und ihre Mutter hat jahrelang jedem auf die Nase gebunden, dass ihre Anna »ein Unfall gewesen sei, einer von der übelsten Sorte«, und »dass sie ja eigentlich gar keine Kinder hatte haben wollen«. Anna kann sich »an genau ein Mal« erinnern, »dass [ihre Mutter] sagte, dass sie mich liebt«.
Doch so kalt und distanziert, wie es anfangs scheint, ist die Tochter-Mutter-Beziehung nicht, die Sarah Stricker in ihrem Debütroman »Fünf Kopeken« auffaltet. Denn sie verstehen und brauchen einander.
Nun hat die angehende Journalistin Anna ihre fünfzigjährige krebskranke Mutter zu sich nach Hause geholt, um sie in ihrer letzten Lebensphase zu pflegen. Eigenartige Veränderungen stellen sich ein: Wo sie sich kaum noch aufrichten kann und Anna sie »mit dem Löffel füttern musste, wurde sie mit einem Mal schön«. Die Frau, für die es immer nur »Zukunft« gegeben, die nie aus der Vergangenheit berichtet hatte, beginnt plötzlich zu erzählen, »redete und redete und redete«. Anna hört zu und wird zur Chronistin ihrer Mutter, während sie sich selber weitgehend im Hintergrund hält.
Schon in ihrem zweiten Satz deutet Anna den bestimmenden Faktor im Leben ihrer Mutter an: »Alles andere hätte mein Großvater ihr nie erlaubt«; »viel zu lachen hatte sie nicht.« Sie war das einzige Kind ihrer Eltern Oskar und Hilde Schneider.
Die Familie Schneider ist in einem »winzigen Nest« im Pfälzischen beheimatet; sie verdienen ihren Lebensunterhalt als Kfz-, Sanitär- und Elektro-Handwerker. Nur die Brüder Oskar und Helmut besuchen ein Gymnasium. Hilde stammt dagegen aus gutem Berliner Haus. Als einzige ihrer Familie überlebte sie die Luftangriffe 1943, konnte aber die in den Kriegsjahren durchlittenen Ängste nie mehr ablegen. Angst vor allem und jedem blieb ihre »erste und einzig wahre Liebe«. Eine Cousine in Oskars Dorf nimmt die ausgebombte junge Frau auf, und so begegnet sie Oskar. Dessen Mutter ist ganz beeindruckt von »der guten Kinderstube, die meine Großmutter in die ihre brachte« ...
Nach dem Tod des Vaters (Annas Urgroßvater) übernimmt Oskar dessen Kurzwarenladen und macht aus der kleinen Boutique »Mode-Schneider« innerhalb einiger Jahre ein blühendes Imperium. Wie man so ein Geschäft aufbaut, wie man an die Spitze gelangt – »groß, größer, am größten, auf jeden Fall größer als alles, was es bisher gab« –, das und noch mehr hat er 1944 an der Wolga und im Kriegsgefangenenlager Kasan (»der Quelle alles Guten in seinem Leben«) gelernt. Schon mit 19 Jahren war Großvater Offizier, und die Jahre »zwischen 39 und 45« waren »die besten seines Lebens«. Dort lernte er, dass »Stillstand den Tod bedeuten kann«, dass man sich einen bösen Virus namens Müßiggang einfangen kann, dem man nur durch permanente Bewegung entkommt. Und so erlebten ihn seine Frau und seine Tochter Tag für Tag: »Er ging nicht, er rannte. Er fuhr nicht, er raste. Er überlegte nicht, er wusste. Vor allem: es besser.« Er war einer der Macher, die das Wirtschaftswunder ermöglichten und von ihm profitierten.
In diesem Klima kühler Erfolgsorientiertheit wächst Annas Mutter auf. Langeweile zu haben steht »unter Höchststrafe«; »Freizeit« (das böse »F-Wort«) fällt allenfalls im Zusammenhang mit »jenen verachtenswerten Geschöpfen da draußen«, die Stunden in Cafés oder auf Liegewiesen verplempern.
Glücklicherweise ist das Mädel hochintelligent und hat jede Menge Talente. Etwas anderes hätte Großvater kaum durchgehen lassen. »Meine Mutter war zu hässlich, um dumm zu sein.« Ob zeichnen, turnen, musizieren – sie räumt die Pokale ab, gewinnt die Medaillen. Das ist keine Sache des Glücks, sondern harter Arbeit. »Ein Preis ohne Fleiß« wäre für Großvater unerträglich. Ihr Tagesablauf ist streng zielorientiert: Finde heraus, welche »Meisterleistungen die allermeisterhaftesten« sind.
Auf der Strecke bleibt Mutters Jugend. Sie hasst sie bei ihren Altersgenossinnen mit ihrer törichten Aufmüpfigkeit, dem dümmlichen Getuschel und Gekicher. Auch die Veränderungen ihres eigenen Körpers stören sie: »Drähte und Schläuche in ihrem Inneren, die sich unkontrolliert erhitzten, ihr das Blut in die Wangen trieben«. Für zarte Liebe (»kuhäugig glucksende Glückseligkeit«) fehlt ihr jegliches Talent, und ohnehin: »Schmetterlinge ... gehören nicht in den Bauch.«
Nach dem Mauerfall ziehen die Schneiders nach Berlin, wo »Mode-Schneider« weiter wächst. Annas Mutter studiert Medizin und hilft in den verbleibenden Stunden des Tages, neue Filialen aufzubauen. Schlaf kann ruhig mal gestrichen werden.
Da fällt ihr Arno mit seiner »bedingungslosen Liebe« so einfach »in den Schoß«. Doch sie lässt sich nicht fallen, fühlt sich nicht einmal richtig zu ihm hingezogen. Sie will ihn sich als Mann fürs Leben »verdienen ... als Preis für all die Mühe, die sie sich gegeben hatte, die zu werden, die sie war«. Begeistert ist dagegen Großvater; er stand »kurz davor, meinem Vater einen Heiratsantrag zu machen«.
All dies hat Anna kommentarlos aufgenommen und mit nachsichtiger Distanz wiedergegeben. Hinter dem vordergründigen Humor steckt oft tiefe Melancholie. Denn Empathie gab es nicht, und wenn sie doch aufkam, so wurde sie im Keim erstickt. Wie hätte Mutter, zur Gefühlskälte erzogen, ihrer Tochter Wärme schenken können?
Nun wird Anna mit Dingen konfrontiert, die eine Tochter nicht wirklich über ihre Mutter wissen will. Kurz vor dem anberaumten Hochzeitstermin lernt Mutter den Russen Alex kennen, dessen Glücksbringer dem Buch den Titel gibt, und verfällt ihm mit Haut und Haaren. Mit ihm lebt sie alles aus, was »man ihr nicht zutrauen wollte«: Begierde und Sex, Lust und Leidenschaft. Jetzt muss sie all dies endlich »laut aussprechen, um sich zu vergewissern, dass sie sich die Frau, die all die Jahre nur in ihrem Gedächtnis weitergelebt hatte, nicht nur ausgedacht hatte«. Anna protokolliert und »stempelte ihr alles ab, jede einzelne Szene«, und das sind über hundert Seiten teilweise starker Tobak ...
Sarah Strickers Debütroman »Fünf Kopeken« ist die Lebensbeichte einer Sterbenden, die in den letzten Tagen ihres Lebens aufblüht, ihre Masken fallen lässt, ihr langjähriges Schweigen löst und ihrer Tochter ein wohlgehütetes Geheimnis offenbart – weniger als Vertrauensbeweis denn als Selbstfindung oder Selbstbestätigung. Anna ist mehr als ihr Sprachrohr; sie erzählt und kommentiert das Gehörte voller Witz und oft bissiger Ironie. So entsteht das farbige Bild einer Familie, deren ältere Mitglieder recht einfarbig, aber unterschiedlich waren. Die Urgroßeltern: blass. Die Großeltern: »Ein schönes Paar. Nur heben sich plus und minus eben gegenseitig auf.« Die Mutter: an der Oberfläche grau, aber tief darunter leuchtend rot. Und die Tochter Anna?
»Fünf Kopeken« wurde im Januar als bester Debütroman des Jahres 2013 mit dem hochdotierten Mara-Cassens-Preis des Vereins Literaturhaus Hamburg ausgezeichnet. Ein tolles Stück Literatur von einer Autorin, die man sich merken sollte.
 · Herkunft:
· Herkunft: