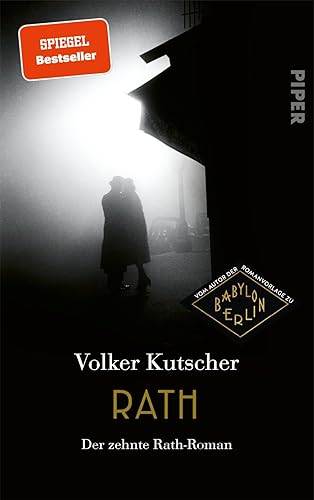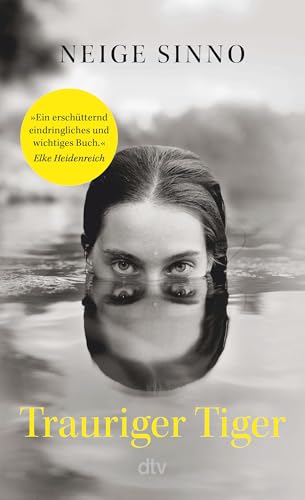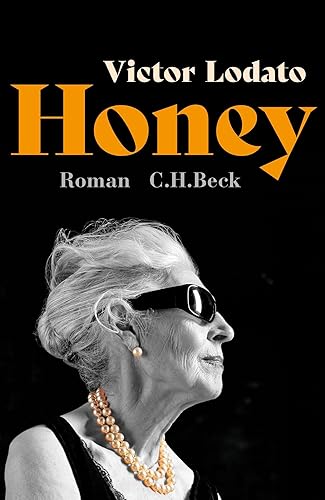
Honey
von Viktor Lodato
»Honey« ist ein bittersüßer, tragikomischer Roman über eine glamouröse, selbstbewusste alte Dame, die sich angesichts ihres drohenden Lebensendes mit ihrer Vergangenheit und ihren Wurzeln auseinandersetzt und das Leben noch einmal auf ihre ganz eigene Weise in die Hand nimmt.
Landminen der Erinnerung
Ilaria »Honey« Fazzinga ist 80 Jahre alt und eine bemerkenswerte Dame, die ihr Leben intensiv geführt hat. Als Tochter einer italienischstämmigen Mafiafamilie in New Jersey ist sie unter der brutalen Herrschaft ihres Vaters, des »Großen Pietro« (»eine Eisenstange, die Knochen zerschmettern konnte«) aufgewachsen, für den Gewalt eine Erziehungsmethode und ein Lebensprinzip war. Schon als junge Frau hatte Honey jedoch eigene Vorstellungen davon, wie sie leben wollte. Die traditionellen Erwartungen ihrer Familie, die sie in eine Rolle als Ehefrau eines Clan-Mitglieds und Mutter vieler Kinder drängen wollte, lehnte sie rigoros ab. Mit 2000 Dollar, einem festen Händedruck und einem letzten Wangenkuss ließ der Vater seine eigenwillige, hochmütige Tochter zähneknirschend nach Kalifornien in die von ihr ersehnte Freiheit ziehen.
Ehrgeiz, Intelligenz und ihr attraktives Erscheinungsbild, das sie bis heute mit Hingabe pflegt, ebnen ihr den Weg nach oben. Sie wird eine angesehene Kunstexpertin, bewegt sich in den Kreisen der Reichen und Schönen und lebt das Leben, das sie sich erträumt hat.
Nach erfüllten Jahrzehnten an der Westküste hätte sich die feine Dame in Ruhe einem komfortablen Lebensabend hingeben können. Doch passives Abwarten, was der Zufall bringen mag, ist nicht ihre Sache. Sie will sich auf ihren eigenen Abschied vorbereiten. So meldet sie sich bei der Organisation »Final Exit Network« an, um ihrem Tod selbstbestimmt entgegenzugehen, ganz nach dem Motto: »Man muss stark sein, um zu leben, und noch viel stärker, um zu sterben.« Außerdem hat der Tod ihres Fast-Ehemanns Dominic Sparra und von zwei ihrer engsten Freundinnen eine Leere hinterlassen. Da zieht es sie mit Macht zurück in ihre Heimatstadt. Es sind nicht die Familienbande, die sie zurückrufen (ihre Eltern und ihr Bruder sind längst verstorben), nicht der Wunsch nach einem Neuanfang mit ihren jüngeren Verwandten und auch nicht die väterliche Prophezeiung »Ich weiß, dass du wiederkommst«, sondern ein innerer Impuls, den sie nicht ignorieren kann: ein Gefühl, dass sie ihre Reise nicht abgeschlossen hat, der Drang, »Dinge zu Ende zu bringen«.
Der Roman beginnt mit einer Szene, die auf den ersten Blick trivial erscheint und doch den entscheidenden vollen Akkord setzt. Honey will ein Schaumbad bei Kerzenlicht genießen. Doch die Stimmung kippt unversehens, als sie in den flimmernden Kerzen das Gefühl einer Beerdigung überkommt. Ein Krampf in ihrem Fuß führt dazu, dass ihre Gedanken umso schneller zurück in ihre Jugendzeit wandern: an ihren Vater, den ermordeten Bruder, geheime Gräber. Verfolgt von den Geistern der Vergangenheit, kämpft Honey gegen die Erinnerung und gegen die Angst, dass ihr Tod bald komme – und das nicht in der Weise, die sie sich vorstellt. »Wie ein urgeschichtlicher Vogel krampfte sie ihre Zehen mit den lackierten Nägeln«, und so schwingt die Erzählung weiterhin zwischen Melancholie, Satire, Ernst und Witz.
Lodato gelingt es meisterhaft, die inneren Konflikte der Protagonistin zu entfalten, und Humor ist dabei ein zentrales Element. Honey ist gleichzeitig emanzipiert, hemmungslos arrogant und von ihrer Vergangenheit gezeichnet. Sie nimmt sich selbst nicht allzu ernst und ist sich ihrer Schwächen und Widersprüche voll bewusst. Der Autor breitet die bisweilen chaotischen, bisweilen tristen, bisweilen selbstironischen, bisweilen zynischen Gedanken, Aktionen und dahingezischelten Kommentare seiner komplexen Protagonistin mit eleganter Leichtigkeit vor den Lesern aus. Im Vivienne-Westwood-Kostüm und Perücke (weil ihr echtes Haar aussieht, »als würde es Signale in den Weltraum schicken«) legt sie einen Auftritt bei Dominic Sparras Trauerfeier hin und spart nicht mit vergifteten Freundlichkeiten und Sticheleien über »alte Leute«, Schwerhörige (das »waren die Schlimmsten«), das »Galeriepublikum«. Die Souveränität hinter diesem beißenden Humor trägt sie seit Langem durch ihre Erinnerungen an traurige und konfliktreiche Zeiten.
Die Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte ist das zentraler Thema von Honeys Erzählung. Trotz aller Abkehr vom Milieu ihrer Herkunft ist sie nie wirklich frei davon. Als ihr Großneffe Michael plötzlich wieder in ihrem Leben auftaucht, um sie um Geld zu bitten, erinnert sie sich an die alten Verhältnisse, in denen das Blut der Familie das Maß aller Dinge war und sie sich – wie Michael – als Außenseiterin fühlte. Ihre Entscheidung, Michael trotz seiner Unzuverlässigkeit und seines abgerissenen Aussehens einen Scheck auszustellen, illustriert ihre Zerrissenheit zwischen der Ablehnung ihrer Herkunft und der Verbundenheit mit ihren Wurzeln. »Sempre la famiglia« – der Leitspruch zieht sich als roter Faden durch den Roman.
Honeys Rückkehr nach New Jersey konkretisiert die Bestandsaufnahme ihres Lebens. Trotz ihres Vorsatzes, in der alten Heimat bloß nicht auf die »Landmine der Erinnerungen« zu treten, holt die Vergangenheit Honey unerbittlich ein. Zu oft, als dass sie mit den Erlebnissen abschließen könnte, war sie Zeugin der tödlichen Gewalt des Vaters. Sie weiß um die Schlachten zwischen den rivalisierenden Clans, um die Leichen im Gemüsegarten ihres Elternhauses, um die Umstände des Todes ihres Bruders Enzo. Sie erkennt, dass die neue Generation in der Familie die kriminellen Aktivitäten erfolgreich auf aktuellere Geschäftsfelder verlagert hat, die Methoden von Gewalt und Unterdrückung innerhalb der Familie aber nicht verschwunden sind. Sie haben nur andere Formen angenommen, als sie sie als Jugendliche ertragen musste. Sie muss sich kümmern, bevor sie abtreten kann.
Schon in ihrer Jugend war sie »keine Heilige«, wie Michael sie erinnert, und sie ist keineswegs frei von Aggression und Gewaltfantasien. Als ihre neue Nachbarin mit ihrem Kombi den liebevoll gehegten Kirschbaum auf Honeys Grundstück niederfährt, entsteht einer der amüsantesten Konflikte des Romans, in dem Honey die »voluminöse junge Frau mit schweren Brüsten« sarkastisch als »Mörderin« bezeichnet.
Manche Äußerungen zu Viktor Lodatos Buch lassen einen Mafia-Kriminalroman erwarten, aber dieses Genre streifen Honeys Erinnerungen nur gelegentlich. Mit seiner klaren Sprache gestaltet der Autor vielfältige Szenen, Dialoge und Gedanken, die uns eine gereifte, lebenskluge »Grande Dame« vor Augen führen. Aus manch tiefen Tälern in ihrem Lebensweg hat sie Verletzungen davongetragen, aber auch Kraft und Mut gewonnen. Damit bietet der Roman eine Mischung aus Leichtigkeit und Schwere, aus Witz und Melancholie. Honey kann die Dinge mit scharfem Humor nehmen, auch wenn sich dahinter tiefe Trauer über den Verlust ihrer Freunde und über die Unabwendbarkeit des eigenen Lebensendes verbirgt. Die Erzählung sprüht vor Esprit, doch Lodato verwehrt uns nie den Blick auf die verletzten, verletzlichen Seiten seiner Protagonistin.
Lodatos Erzählstil, übersetzt von Claudia Wenner, ist präzise, aber nie trocken. Er schafft es, ernste Themen wie Gewalt, Altern, Tod und Familie aus einem humorvollen Blickwinkel zu präsentieren und schreckt vor Überspitzungen ins Lächerliche und Absurde nicht zurück. Die Dialoge zwischen Honey und den anderen Figuren sind lebendig und pointiert, die Reflexionen über das Leben und den Tod kommen nie schwerfällig daher. Der Roman ist weder rein humorvoll noch rein dramatisch, sondern eine gekonnte Mischung aus beidem, die den Lesern immer wieder ein Lächeln entlockt, während sie gleichzeitig die tiefere Tragik von Honeys Leben spüren.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: