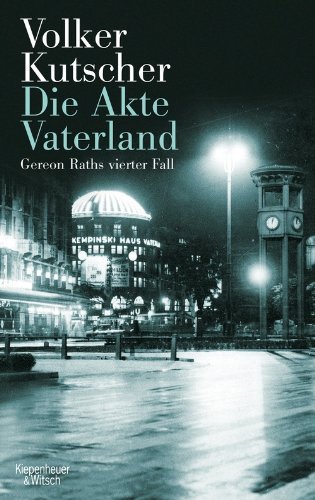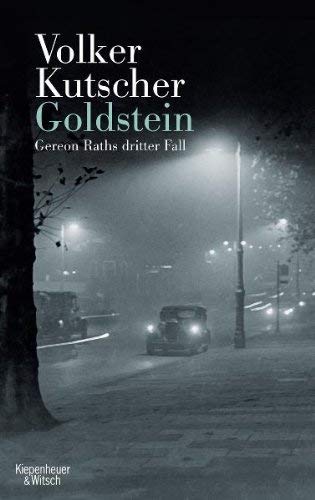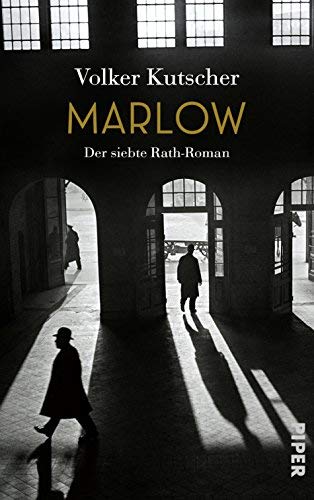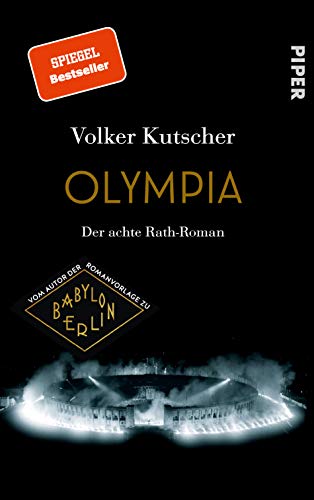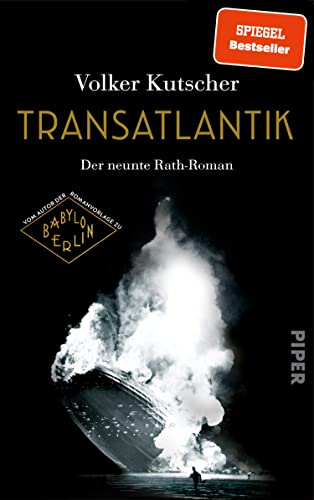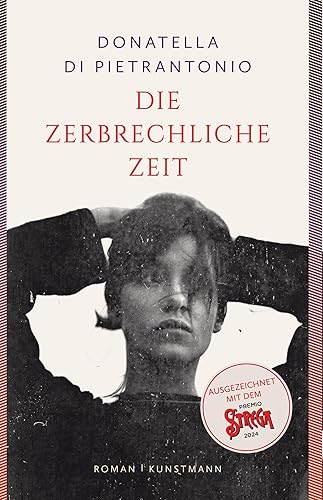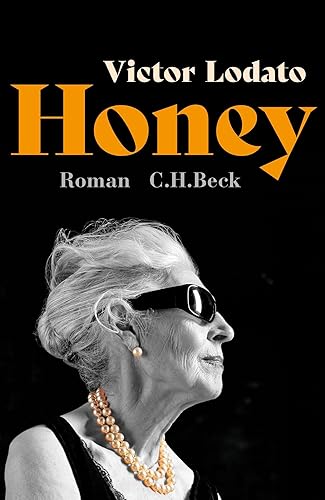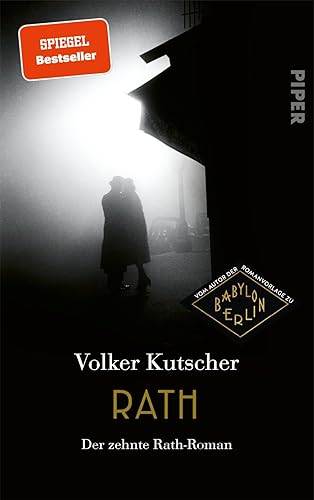
Rath (Band 10 der Gereon-Rath-Romane)
von Volker Kutscher
Mit dem letzten Band führt Volker Kutscher seine Gereon-Rath-Reihe mit historischem Tiefgang und atmosphärischer Dichte weiter bis zur Reichskristallnacht 1938. Indem der Nationalsozialismus erstarkt und die deutsche Kultur einen beispiellosen Niedergang erlebt, versuchen die Protagonisten Gereon und Charlotte zu überleben und ihre Positionen zu finden. Ein fesselndes Zeitporträt.
Zeitenwende
Volker Kutschers höchst erfolgreiche Reihe der Gereon-Rath-Romane erreicht mit dem 10. Band ihren unwiderruflichen Abschluss. Der Autor selbst hat die rote Linie bestimmt, bis zu der er seine Kriminalromane führen will: Es ist der 9. November 1938, die Reichskristallnacht.
Die Handlung der Reihe umfasst nun nahezu ein Jahrzehnt – von 1929 bis 1938. Der erste Band schildert die Spätphase der Weimarer Republik. Die Weltstadt Berlin durchlebt eine aufreizende, gefährlich instabile Zeit, in der alles möglich scheint – kometenhafter Aufstieg und krachender Kollaps. Während weite Teile der Bevölkerung täglich um ihre nackte Existenz kämpfen müssen, befinden sich andere in einem permanenten Rausch – künstlerisch, unternehmerisch, politisch, kreativ, innovativ, grenzenlos, tabufrei, mutig, aggressiv und rücksichtslos, ein Tanz auf dem Vulkan mit hochmoderner Technik, schreienden Massenmedien, befeuernden Ideologien, Straßenschlachten, Kokain, illegalen Nachtclubs, mitreißenden Melodien, stampfenden Rhythmen.
Nur neun Jahre später ist die Stadt (und mit ihr das Land) eine völlig andere geworden. Der Nationalsozialismus hat sich als Ideologie und Macht im Alltag der Bürger eingenistet und bestimmt ihn jetzt in allen Bereichen, bis hinein in die Familiengefüge. Wer sich trotz allgegenwärtiger Propaganda kritische Distanz zur alles beherrschenden Gesinnung bewahren konnte, klammert sich an die Hoffnung, sich Freiräume bewahren zu können, und es werde schon nicht so schlimm werden. Dabei leiden immer mehr Mitbürger unter dem Eindringen der Politik in ihr sicher geglaubtes Privatleben durch Bespitzelung und Drangsalierung. Immer mehr Menschen bemerken, dass in ihrem Umfeld Personen, die den Nazis missliebig sind, beleidigt, geächtet, geschlagen, ihrer Freiheit beraubt werden, spurlos verschwinden oder freiwillig alles aufgeben und über Nacht wegziehen.
Mit Gereon Rath, dem Protagonisten, konnten wir diese Dekade in gewissem Rahmen und großer Intensität miterleben. Der gebürtige Kölner zog nach Berlin, arbeitete dort als Kriminalkommissar und lernte im Polizeipräsidium die Stenotypistin Charlotte (»Charly«) Ritter kennen. Die beiden verliebten sich ineinander, heirateten, nahmen einen Pflegesohn (Fritz) zu sich und wurden beruflich und privat in aufregende kriminelle, wirtschaftliche und politische Machenschaften von teils nationaler Relevanz verstrickt, während der sich ihre Wege bisweilen trennten. Dabei nahmen sie auch unterschiedliche Haltungen zur Entwicklung der deutschen Politik ein und gerieten in entsprechende Konflikte und Gefahren. Während Gereon eher unpolitisch ist und weder als Mitläufer noch als Opponent hervortrat, ahnt Charlotte mit feinem Gespür für Recht und Unrecht seit Langem, wohin die Ereignisse führen können, und bleibt sich in ihrer widerständischen Rolle bis zum Schluss treu. Ihre wechselhafte Geschichte macht sie zur eigentlichen Heldin der Reihe: Sie tut stets ihre Pflicht, weder Haft noch Folter können sie brechen, und den Schutz von höchster Stelle weiß sie klug zu nutzen, um ihre Ziele zu verfolgen.
Im neunten Band (»Transatlantik«) will sich Gereon Rath im Mai 1937 in die USA absetzen und reist mit dem legendären Zeppelin-Luftschiff »Hindenburg« nach New York. Als dieses bei der Ankunft in Lakehurst in Flammen aufgeht, lässt Volker Kutscher seine Leser im Ungewissen, ob der Protagonist unter den Todesopfern oder den Überlebenden der Katastrophe ist.
Mit der Auflösung im nun erschienenen letzten Band verblüfft uns der Autor wie so oft zuvor: Einerseits lesen wir, dass Gereon Rath für tot erklärt wird und Charlotte eine Witwenrente erhält. In Wahrheit aber lebt Gereon unter falschem Namen in Amerika, wo sein Bruder Severin, der mit amerikanischer Staatsbürgerschaft als Journalist in New York tätig ist, ihn finanziell unterstützt. Als die beiden Brüder die Nachricht erreicht, ihr Vater Engelbert habe einen Schlaganfall erlitten und liege im Sterben, kehren sie nach Deutschland zurück, obwohl sie hier um ihr Leben fürchten müssen. Während Severin als Korrespondent seiner US-Zeitung aus der deutschen Hauptstadt berichten kann, findet Gereon zunächst Unterschlupf bei einem Vertrauten des Vaters und sucht dann Charlotte in Berlin auf. Sie braucht Beistand für zwei wichtige Anliegen: Sie will eine bedrängte Freundin aus einer Klinik holen, und Fritz, noch immer treuer Hitlerjunge, muss vom schwerwiegenden Verdacht, einen Mord begangen zu haben, entlastet werden. Eine Fülle von Episoden, Nebenhandlungen und bedrückenden Schilderungen führen uns vor Augen, wie sich die Stimmung im Lande gegen politische Gegner, Juden und andere Gruppen verdüstert und radikalisiert, bis sie im November 1938 einen Tiefpunkt erreicht. Familie Rath muss sich nun auf einen Weg einigen, wie und wo sie eine gemeinsame Zukunft finden und gestalten kann. Falls so etwas überhaupt noch realisierbar ist, müssen viele Steine aus dem Weg geräumt werden.
Wenngleich der Plot genug Verbrechen und deren Aufklärung bereitstellt, rückt das Genre Kriminalroman jetzt in den Hintergrund. Kutschers Anliegen ist, die Atmosphäre dieser bedrohlichen Zeit einzufangen.
Sehr deutlich gestaltet der Autor die offenen und nicht so offensichtlichen Mechanismen, mit denen sich ein Unterdrückungsstaat etabliert: Besetzung sämtlicher Stellen im Staatsapparat und den Medien mit zuverlässigen Gefolgsleuten, Kontrolle des Rechtssystems durch willige Richter und politisch gewünschte Urteile, durch Manipulation von Beweismaterial, Alibis und Zeugenaussagen, dazu das Anstacheln von Konkurrenz und Misstrauen in der Bevölkerung durch Fördern von Denunziation und Einbindung kleiner Helfer (wie Gendarme oder Blockwarte) in den großen Apparat durch Ausstattung mit begrenzten Machtbefugnissen. Für etwas mehr Geld, eine eindrucksvolle Uniform, einen Titel und das Recht, andere nach Gutdünken zu tadeln oder zu strafen, ist manchem jedes Mittel recht, und so werden aus Freunden schnell Feinde, aus Nachbarschaftshilfe Intrigen, aus solidarischen Gruppen leicht beherrschbare Einzelkämpfer.
In der Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 fallen bei vielen indoktrinierten Menschen letzte Hürden bürgerlichen Anstands. Marodierende Horden der SA und der Hitlerjugend, durch Uniformen, Lieder, Parolen und Gleichschritt zu einer Gemeinschaft verschweißt, in der jeder Einzelne seine individuelle Verantwortung abgeben kann, zünden Synagogen an, zertrümmern jüdische Geschäfte, plündern Wohnungen, dreschen auf jeden ein, der sich zur Wehr setzt, verletzen und töten mitleidlos mit Prügeln und Eisenstangen. Wer könnte sie noch aufhalten? »Der höchste Akt des Widerstandes war es, den Blick schamhaft abzuwenden und vorüberzugehen«, schreibt Kutscher auf den letzten Seiten seines Romans, die die verheerenden Ereignisse jener Nacht schildern. Für ihn bedeuten sie das Ende der Zivilisation und die Einleitung des organisierten Massenmordes an den Juden – eine Grenze, die er als Schriftsteller nicht zu überschreiten vermag.
Volker Kutscher ist es gelungen, das Wachsen des Nationalsozialismus und die Faszination vieler Bürger für diese Ideologie ergreifend darzustellen und dennoch erzählerische Distanz zu wahren. Intensive Recherchen erlauben es ihm, uns den Alltag lebendig und bildstark zu schildern. Detailreiche Beschreibungen von Waren, Verkehrsmitteln, Wohnungseinrichtungen, Verhaltensweisen, dazu zeittypische, oft amüsante Redensarten und perfekt transskribierte Dialekte spulen in unserem Kopfkino einen mitreißenden Film ab. Neben Repräsentanten vieler Haltungen zur Regierungspolitik – Mitläufer und Skeptische, entschiedene Gegner und jubelnde Anhänger, Opfer und Profiteure – treten immer wieder prominente Persönlichkeiten auf, wodurch die privaten Handlungen der Charaktere in den großen geschichtlichen Rahmen eingeordnet werden, so wie es der ambitionierten Intention des Autors entspricht.
Zur Illustration der erzählerischen Methode sei nur ein Beispiel von vielen vorgestellt. Während seiner Tätigkeit als Regierungsrat im Kölner Polizeipräsidium hatte Gereons Vater viel mit Konrad Adenauer, dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt, zu tun, woraus sich eine enge Freundschaft entwickelte. Nachdem die Nationalsozialisten Adenauer 1933 all seiner Ämter enthoben, konnte er sich in seinem Haus in Rhöndorf intensiver seinem Steckenpferd widmen: dem Erfinden technischer Geräte. Hier kommt Gereon Rath als Chauffeur unter, als er aus den USA zum Krankenbett des Vaters eilt. Diese Handlungsführung gibt Kutscher nun Gelegenheit, uns nicht nur mit den laut Gereon Rath »spinnerten Ideen« des alten Mannes zu unterhalten (ein »elektrischer Insektentöter«, eine »von innen beleuchtete Stopfkugel«), sondern auch mit seinem Charakter und seinem markanten Dialekt (»et funktioniert … die mache kinne Mucks mie!«). Wie nebenbei findet Weltpolitik statt: »Dä Schämberlähn. Dä muss doch zum Führer. Lesen Se denn king Zeidung?«, tadelt Adenauer seinen Fahrer, als sie am 22. September 1938 am Fähranleger am Rhein warten müssen. Denn gerade ist der britische Premierminister Neville Chamberlaine auf dem Weg nach Bad Godesberg, wo er Adolf Hitler treffen und in seinen territorialen Ambitionen beschwichtigen will.
Mir imponiert erneut, wie es Volker Kutscher gelingt, in seiner unterhaltsamen Fiktion ein seriöses, differenziertes Gesellschafts- und Geschichtsbild zu zeichnen, das den Lesern die Augen zu öffnen vermag für Entwicklungen, die jederzeit und überall wieder keimen können, wenn skrupellose Persönlichkeiten menschliche Schwächen geschickt ausnutzen. Nichts ist einfacher, als über das Dritte Reich Empörungsliteratur zu produzieren, denn einfach zu identifizierende Übeltäter, Missetaten und unsägliche Verbrechen springen massenhaft ins Auge. Doch nichts ist primitiver, nichts ist kontraproduktiver als simples Verurteilen und Zurschaustellen des Bösen von oben herab, aus moralisch erhabener Sicht.. So etwas klärt nicht auf, sondern verhindert die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht anders als die Wiederbelebung alter Propagandaphrasen, die Vertuschung und Verdrängung des Bösen und der leichtfertige Umgang mit dem Etikett »Nazi« in unseren Tagen. In Kutschers Romanen können wir dank meisterlicher Gestaltung selber lesen, sehen, hören und erkennen, wie sich eine Katastrophe entwickeln konnte.
 · Herkunft:
· Herkunft: