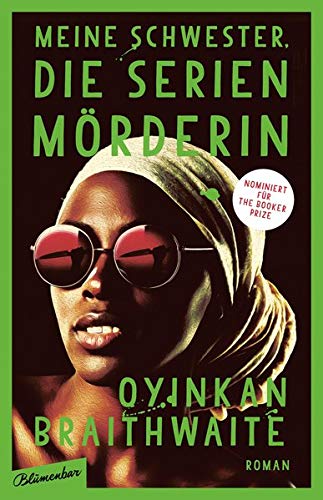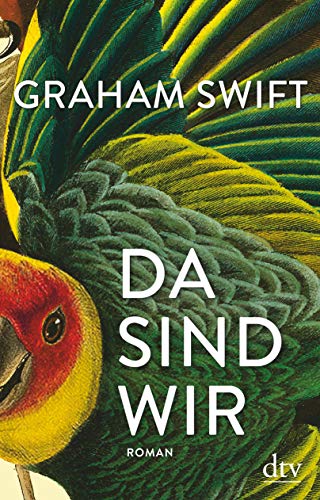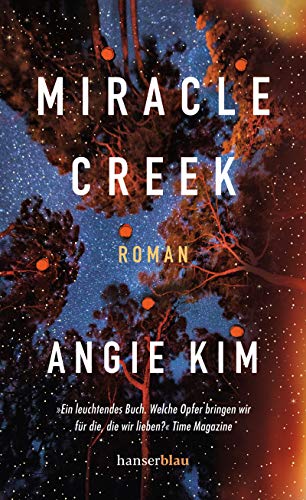
Miracle Creek
von Angie Kim
Ein medizinisches Gerät, das Kranken Linderung bringen soll, explodiert in Folge einer Brandstiftung. Angeklagt wird die Mutter eines autistischen Jungen, der dabei ums Leben kam. Der Prozess deckt auf, welche Geheimnisse das Südstaatennest Miracle Creek vergiftet haben.
Lügen und Wahrheiten
Nach vier Jahren der Trennung ist Familie Yoo endlich wieder beisammen. Young Yoo und ihre Tochter zogen bereits 2004 in die USA, Vater Pak Yoo ist soeben aus Seoul eingetroffen, wo er jahrelange Erfahrungen mit der HBO-Therapie gesammelt hat. In der Kleinstadt Miracle Creek, Virginia, hoffen die Eltern, mit Paks medizinischer Expertise ein Geschäftsmodell realisieren zu können, das ihnen Wohlstand beschert und der fast volljährigen Tochter ein Hochschulstudium finanziert. In einer Scheune steht ihr Investment, die teure Überdruckkammer, dem Rumpf eines Privatjets ähnlich, in dem sechs Patienten Platz finden. Wenn der Behälter sorgfältig versiegelt ist, wird langsam medizinisch reiner Sauerstoff zugeführt, den die Kranken dann unter Überdruck einatmen. Die Therapie ist bei speziellen Vergiftungen und Krankheiten indiziert, aber teuer und weltweit nicht unumstritten.
Schon aus eigenem Interesse achtet Pak pingelig auf Sicherheit, und dennoch geschieht im August 2008 eine Katastrophe. Eine brennende Zigarette löst eine Explosion der Druckkammer aus, bei der zwei der Insassen getötet und vier schwer verletzt werden.
Der komplexe Debütroman der gebürtigen Südkoreanerin Angie Kim schildert den Gerichtsprozess, der ziemlich genau ein Jahr nach dem Unglück beginnt und vier Tage dauert. Die Stanford- und Harvard-Absolventin hatte schriftstellerische Erfahrungen als Prozessbeobachterin gesammelt, indem sie in diversen Zeitungen (u.a. der New York Times) Essays veröffentlichte. »Miracle Creek«  , übersetzt von Marieke Heimburger, ist reine Fiktion, doch fließen persönliche Erfahrungen ein, die die Autorin während der jahrelangen Sauerstofftherapie eines ihrer Söhne machte.
, übersetzt von Marieke Heimburger, ist reine Fiktion, doch fließen persönliche Erfahrungen ein, die die Autorin während der jahrelangen Sauerstofftherapie eines ihrer Söhne machte.
Auf der Anklagebank sitzt Elizabeth Ward, eine Außenseiterin. Sie soll das Feuer gelegt haben, das die Explosion auslöste und zwei Leben vernichtete – das ihres achtjährigen autistischen Sohnes Henry und das einer Freundin, die fünf Kinder hinterlässt. Obwohl Elizabeth die Todesstrafe droht, wenn die zwölf Geschworenen sie am Ende schuldig sprechen sollten, verfolgt sie ihren Prozess mit versteinerter Miene und ohne jegliche Gefühlsregung. In der Tat hat sie bereits mit dem Leben abgeschlossen. Ihre Hinrichtung würde sie als einfache, schnelle Erlösung von den seelischen Qualen der Trauer um ihr Kind willkommen heißen. Schon im Vorfeld hat sie alle Schuld zugegeben und lehnt es ab, sich zu verteidigen. Diese abweisend-resignative Haltung bringt ihre engagierte Verteidigerin Shannon schier zur Verzweiflung, nicht aber zur Aufgabe ihrer Bemühungen um die Rekonstruktion der Wahrheit.
Unter der Leitung von Richter Frederick Carleton III entwickelt sich die Verhandlung. Die Anklagepunkte trägt Staatsanwalt Abraham Patterly vor, ein Afroamerikaner (ungewöhnlich genug in der Provinz von Virginia). Dann werden nacheinander Zeugen gehört, die über die Umstände am Unglückstag Auskunft geben. Manche werden in der Prozesssituation präsentiert, wie sie auf die Fragen des Staatsanwalts und der Verteidigerin reagieren, andere im Zuge perspektivisch wechselnder Schilderungen des Tagesverlaufs. Indem immer wieder Rückblicke einfließen – auf frühere Lebensphasen verschiedener Personen, auf den Alltag, auf das innerfamiliäre Zusammenleben und die Nachbarschaft – wird deutlich, dass jedes Paar und jede Familie von Schwierigkeiten unterschiedlichster Art bedrückt ist und sich ein anderes Leben wünscht.
Young Yoo kommt als erste zu Wort. Die ehrgeizige Ehefrau und Mutter schildert ihre Hoffnungen auf eine erfolgreiche Zukunft der ganzen Familie in Amerika, für die die Eltern unermüdliche Anstrengungen aufbringen. Dabei entgeht ihnen allerdings, dass ihre Tochter, deren Wohl im Mittelpunkt ihres Strebens steht, sich in der neuen Heimat nie richtig angekommen fühlte und liebend gern nach Korea zurückkehren würde – eine bittere Erkenntnis, die sich ihnen erst am Ende des Romans erschließt. Im Übrigen verlief der Unglückstag nicht ganz wie üblich. Aus Selbstschutz haben die Eltern eine leicht modifizierte Wahrheit abgesprochen, was Young Yoo nun emotional stärker belastet als erwartet (»Gott würde [ … ] sie in irgend einer Weise für ihre Lügen bezahlen lassen.«).
Im Reigen der im weiteren Verlauf angehörten Personen kompliziert sich das Bild naturgemäß. Von der Autorin feinfühlig herausgearbeitete Innenperspektiven geben der Handlung einen besonderen Reiz, denn sie enthüllen Kleinigkeiten, die jeder lieber zurückhält, weil sie plötzlich für die Wahrheitsfindung bedeutsam werden könnten. Tatsächlich hütet nahezu jede Figur Geheimnisse, sei es zum eigenen Schutz oder aus Scham, und hat deswegen den Mitmenschen vorgespielt, was am wenigsten Probleme verursacht. Es entsteht der Eindruck, dass eigentlich jede Person das Feuer hätte legen können, zumindest einen Teil zu dem Unglück beitrug und Verantwortung übernehmen müsste. Doch Wahrheit und Moral erweisen sich als dehnbare Begriffe. Leichter lebt es sich mit Heuchelei und Schuldzuweisungen an andere.
Vom juristischen Prozedere her können Gerichtsverfahren staubtrockene Angelegenheiten sein. Angie Kim verleiht dem Indizienprozess indes durch einen bunten Mix an Verwirrungsfaktoren unvermutete Spannung und einen intensiv ergreifenden Sog. Falsch gedeutete Beobachtungen, vertauschte Handys, missverstandene Notizen, gezielte Unterstellungen, verdächtige Telefonate, kleine Lügen und interessante Spuren am Tatort geben Rätsel auf, die sehr langsam bis zum überraschenden Ende aufgelöst werden.
Die Angeklagte Elizabeth Ward gerät im Übrigen auch mitten in die kämpferisch geführte Auseinandersetzung um den Umgang mit autistischen und anders benachteiligten Kindern. Auf der einen Seite des weltanschaulichen Grabens stehen die Mütter vom Typ »ProudAutismMom«, die jegliche Einwirkung auf ihr Kind ablehnen und es ohne Einschränkung so annehmen, wie es ist. Ihr ungezügelter Hass entlädt sich gegen die Mütter auf der anderen Seite, die sich mit dem Zustand ihres Kindes eben nicht abfinden wollen. Mit großem Engagement kämpfen sie um jeden winzigen Fortschritt und sind bereit, jeden Strohhalm selbst umstrittener Therapien zu ergreifen. Teilweise drastisch schildern diese Mütter ihre Erfahrungen in ihrem erschwerten Alltag, in der Auseinandersetzung mit Gesundheitsbehörden, mit kleinen Hoffnungen und großen Enttäuschungen. Viele leiden darunter, ihre eigenen Bedürfnisse ständig unterdrücken zu müssen, wahrscheinlich niemals ein unbeschwertes, selbstbestimmtes Leben führen zu können und obendrein einem ständigen Wettstreit voller Neid und Missgunst ausgesetzt zu sein. In dieser brisanten Gemengelage erscheint Elizabeth manchen als »Ungeheuer«: Hatte sie sich gewünscht, ihr Kind wäre nie geboren worden? Wollte sie »ihren Sohn wirklich unbedingt loswerden«?
 · Herkunft:
· Herkunft: