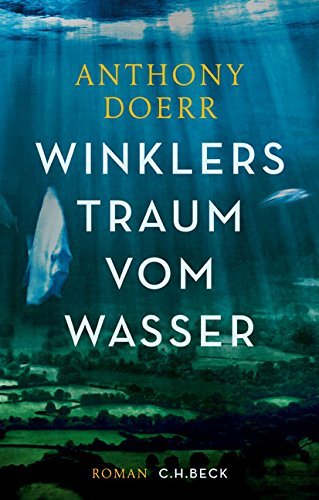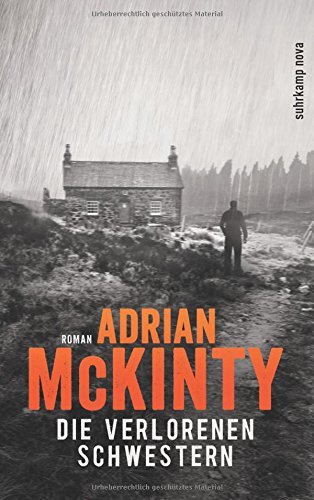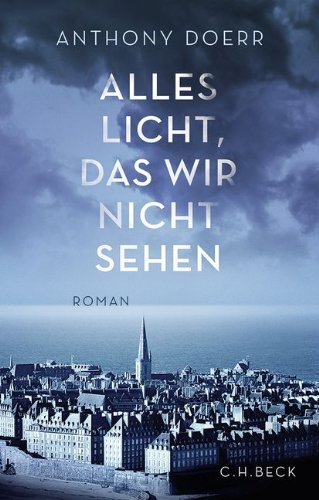
Zwei, die ihr Schicksal in die Hand nehmen
Marie-Laure, 1928 geboren, ist Halbwaise. Mit sechs Jahren erblindet sie. Aber ihr Vater hadert nicht mit dem Schicksal: »Man kann Glück haben oder auch Pech.« Vielmehr unternimmt er alles, um seine Tochter zu befähigen, sich die Vielfalt der Welt zu erschließen und ein möglichst unbeeinträchtigtes Leben zu führen. Mit bewundernswerter Imagination, Tatkraft und Disziplin schenkt er dem Mädchen eine einzigartige Kindheit.
Jeden Morgen nimmt Daniel LeBlanc Marie-Laure mit zu seinem außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Im »Muséum national d'Histoire naturelle« ist er der Verwalter der zwölftausend Schlüssel für sämtliche Türschlösser des Museumsgebäudes, der Werkstätten, Gewächshäuser und des Jardin des Plantes. Er nutzt jede Sekunde, um den Tastsinn des Kindes zu entwickeln, indem er ihr Schlüssel und Alltagsgegenstände in die Hand gibt, und der Wissenschaftler Dr. Geffard erweitert ihre Sensitivität mit Schätzen aus aller Welt, die er aus den Schränken und unzähligen Schubladen seines Labors hervorholt: Schalentiere mit unterschiedlichsten Gehäusen, Stacheln, Dornen, Windungen, Höhlungen, weich, glatt oder rau ...
Auch zu Hause ist alles auf Marie-Laures Förderung eingerichtet. Ihr Vater achtet darauf, dass sich immer alles am selben Platz befindet, und ordnet sogar die Speisen auf ihrem Teller gemäß dem Zifferblatt der Uhr an. Klebestreifen am Boden und Zwirnfäden von Raum zu Raum ermöglichen ihr die Orientierung in der Wohnung. Damit sie sich demnächst auch in ihrem Wohnviertel zurechtfinden kann, konstruiert er in seiner Werkstatt ein Miniaturmodell aus Holz mit Häusern, Straßenzügen, Plätzen, Bänken, Bäumen und Gullys. Zu jedem Geburtstag verbirgt er sein Geschenk in einer neuen Holzschachtel, die zu öffnen dank raffiniert angeordneter Leisten, Fugen und Mechanismen ein Geduldsspiel ist. Anhand eines Lehrbuchs erlernt Marie die Blindenschrift, den Zugang zur Welt der Bücher.
Das wertvollste Exponat des Naturkunde-Museums ist »Meer der Flammen«, der größte Diamant der Welt. Zwar kann Marie-Laure das tropfenförmige Rot im Innern des bläulichen Steins niemals sehen, doch die ihm zugeschriebene mythische Geschichte von Glück und Unglück, einem Fluch und seiner Aufhebung behält sie in Erinnerung.
Im Juni 1940 vertreibt der Krieg Vater und Tochter aus Paris. Das Museum ist geschlossen. Seine Schätze hat man vor den anrückenden Deutschen in Sicherheit gebracht. Das »Meer der Flammen« und drei Kopien davon wurden an verschiedenen Orten in Verwahrung gegeben. Daniel und Marie-Laure finden bei Onkel Etienne in Saint-Malo Unterschlupf.
Im weit entfernten Essen hat derweil ein Altersgenosse von Marie-Laure eine nicht minder außergewöhnliche Kindheit verbracht. Werner Hausner und seine jüngere Schwester Jutta sind Vollwaisen und wachsen in einem Heim auf, wo nach der Weltwirtschaftskrise Hunger und Not groß sind. Doch Werner, klein für sein Alter, abstehende Ohren und schlohweiße Haare, scheint über all dem »zu schweben«. Jeden Tag streunt er, seine Schwester im Bollerwagen ziehend, durch das Viertel um die Zeche Zollverein. Sie erkunden alles, was Kinderaugen wahrnehmen, schwatzen mit der Bäckersfrau und bringen den erfreuten anderen Heimkindern Brot und Milch mit. Vor allem aber bemerkt und fördert Elena, die elsässische Erzieherin, Werners Forscherdrang (»Wenn der Mond so groß ist [...], warum sieht er dann so klein aus?« »Wenn ein Blitz ins Meer einschlägt, warum sterben dann nicht alle Fische?«) und sein handwerklich-technisches Talent, denn er bastelt für die Kinder Spielzeug aus Papier, experimentiert mit Elektroschrott und bringt ein defektes Radio wieder zum Laufen.
Elenas Prophezeiung – »Du wirst einmal etwas Großes tun.« – bewahrheitet sich, jedoch leider nicht zum Wohle der Menschheit. Zunächst gehört er dank seiner naturwissenschaftlich-technischen Begabung zu den wenigen, die für die Eliteschulen des Nazi-Regimes, die »Nationalpolitischen Erziehungsanstalten« (Napola), auserkoren sind. Dort wird er nicht nur ideologisch linientreu ausgerichtet (»Ihr werdet Heimat essen und Nation atmen ... Schwäche ablegen ... in die gleiche Richtung marschieren ... allein für die Pflicht leben«), sondern auch schikanöse Aussonderungsmethoden und menschenverachtende Diskriminierung kennenlernen. Er aber setzt sich durch, wird Funktechniker, zieht mit einer Spezialeinheit an die Ostfront, trägt bei zum verhehrenden Vormarsch der Wehrmacht.
Im August 1944 hat sich das Blatt gewendet. Werner wurde in eine der letzten von den Nazis gehaltenen Städte beordert, nach Saint-Malo. Mit seinen Peilsendern soll er die Kämpfer der Résistance auffinden, die den Amerikanern verschlüsselte Informationen über die Stellungen der Deutschen übermitteln. Unter heftigem Beschuss des Feindes ist sein Quartier zerstört, er selbst im Keller verschüttet, da spürt er tatsächlich eine zarte weibliche Stimme aus einem nicht weit entfernten Radio auf, die aus Jules Vernes »20.000 Meilen unter dem Meer« vorliest. Es ist die Stimme Marie-Laures.
Hiermit sind die zwei Handlungsstränge angedeutet, die die Kindheits- und Jugendjahre der beiden Protagonisten umfassen. Obwohl die Französin und der Deutsche einander nicht persönlich begegnen, verbinden sich ihre Schicksale subtil miteinander. Erzählt werden ihre Werdegänge im Präsens, in regelmäßig alternierender Perspektive und scheinbar unsystematischer zeitlicher Abfolge (der jeweilige Erzählzeitraum dient als Kapitelüberschrift). Ab Seite 145 (Juni 1940) tritt ein neuer Handlungsstrang hinzu. Der deutsche Offizier Reinhold von Rumpel soll den sagenumwobenen Diamanten für die geplante deutsche Kulturhauptstadt Linz requirieren, verfolgt dabei jedoch auch vitale persönliche Interessen.
Schließlich, am 7. August 1944, mit dem der Roman erzählerisch einsetzt, laufen alle drei Handlungsfäden in Saint-Malo zusammen. Die Alliierten sind in der Normandie gelandet. Flugblätter »regnen ... vom Himmel ... wehen über die Befestigungsmauern, fliegen radschlagend über die Dächer«. Die Stadt ist von den voraufgegangenen alliierten Bombardements zerstört und verbrannt. Der größte Teil der Bevölkerung verlässt, den Flugblattaufrufen der Amerikaner folgend, die Stadt. Marie-Laure aber traut sich nicht hinaus, denn sie ist jetzt allein. Ihr Vater war nach Paris zurückbestellt worden, kam jedoch nie dort an, und Onkel Etienne ist wegen seiner Aktivitäten in der Résistance (bei denen sie ihm zur Hand ging) inhaftiert. Die Lage des blinden Mädchens spitzt sich lebensbedrohlich zu, als von Rumpel sie entdeckt ...
Anthony Doerrs »All the Light We Cannot See«  ist ein rundum gelungenes, vielschichtiges Werk, das Werner Löcher-Lawrence kongenial übersetzt hat. Die beiden jungen Protagonisten unterschiedlicher Nation lassen uns das Kriegsgeschehen aus ungewohnten Perspektiven erleben. Marie-Laure ist von vornherein die stille, gute Heldin. Werner, das Technikgenie, lässt sich für das Vernichtungssystem instrumentalisieren und vermag sich erst am Ende zu bekehren. Die Schrecken der Zeit werden keineswegs ausgespart: nicht die bittere Not im Ruhrgebiet, nicht die mitleidlose Selektion in der Napola, nicht die Gräuel auf den Schlachtfeldern, nicht der Horror der Bombardements.
ist ein rundum gelungenes, vielschichtiges Werk, das Werner Löcher-Lawrence kongenial übersetzt hat. Die beiden jungen Protagonisten unterschiedlicher Nation lassen uns das Kriegsgeschehen aus ungewohnten Perspektiven erleben. Marie-Laure ist von vornherein die stille, gute Heldin. Werner, das Technikgenie, lässt sich für das Vernichtungssystem instrumentalisieren und vermag sich erst am Ende zu bekehren. Die Schrecken der Zeit werden keineswegs ausgespart: nicht die bittere Not im Ruhrgebiet, nicht die mitleidlose Selektion in der Napola, nicht die Gräuel auf den Schlachtfeldern, nicht der Horror der Bombardements.
Der dritte Handlungsstrang um den legendären Diamanten sorgt für eine Art dramatischer Entspannung von der immer wieder erschütternden Weltkriegshistorie. Die rücksichtslose Jagd eines gierigen Bösen nach einem Schatz, die kriminalistische Suche nach dem Original unter drei versteckten Kopien, dazu die esoterischen Eigenschaften des Diamanten (die nach meinem Geschmack allerdings fehl am Platz sind) könnten auch Inhaltsstoff eines spannenden Jugendromans sein.
Jedes Detail hat seinen funktionalen Platz im stimmigen Sinnzusammenhang. Nichts ist bloß Füllmaterial in diesem motivisch dichten und konsistenten Gefüge. Beispielsweise spiegelt sich in der Kellerszene, als Werner die zarte Stimme hört, das Schicksal seines in der Kohlegrube umgekommenen Vaters, das den Sohn immer verfolgt hatte. Interessant auch die disparaten Funktionen des Radios als technische Innovation, bedrohliche und rettende Technik, wichtiger Informationskanal und Instrument politischer Indoktrination (Dem Roman ist – ohne Quellenangabe – ein Goebbels-Zitat vorangestellt, dass sich »die deutsche Revolution« ohne Rundfunk nicht in dieser Form hätte abspielen können.).
Sprachlich begeistert der Roman durchgängig mit detailreichen Beschreibungen, eindringlichen Schilderungen, faszinierender Wortgewalt, klugen Sentenzen, ungewöhnlichen Perspektiven (wie erlebt eine Blinde die Welt?), kühnen Metaphern und Vergleichen (Marie-Laure isst ein Omelett: »Die Eier schmecken wie Wolken. Wie gesponnenes Gold.« und eingemachte Pfirsiche: »Stücke nassen Sonnenlichts«).
Kein Wunder, dass Anthony Doerr für seinen wunderbaren Roman mit dem Pulitzer-Preis 2015 geehrt wurde.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Sommer 2015 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: