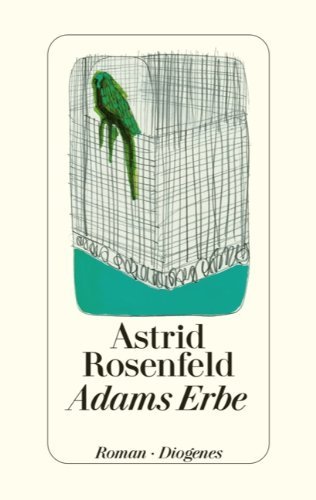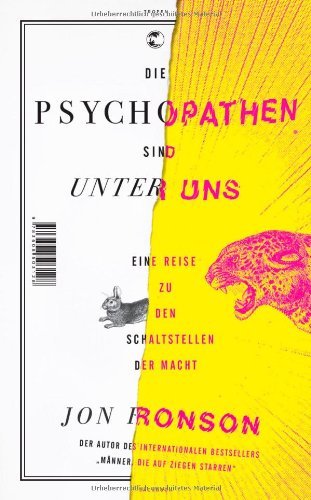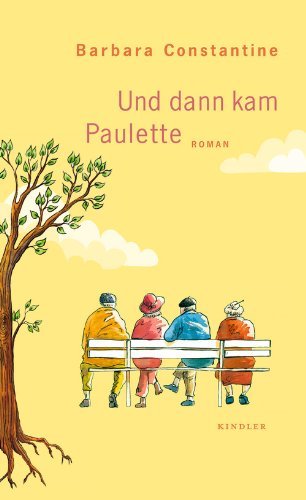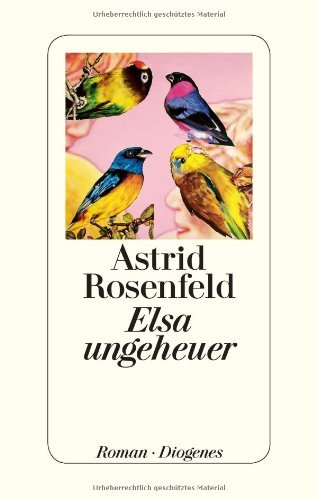
Die Brauer-Buam vom Immenhof
Unser Ich-Erzähler Karl Brauer (1977 geboren) wächst mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Lorenz auf dem idyllischen elterlichen Ponyhof auf. Neben den Sommergästen wohnt dort auch der großmütige alte Zigarrenraucher Murmelstein (»Murmeltier« genannt), ein wurzelloser Ex-Lebemann, der sich nach einem Verkehrsunfall 1975 dauerhaft hier einquartiert hat und als eine Art Maskottchen freie Kost und Logis genießt. Dafür prägt er die Knaben (Karl ist anfangs gerade acht) fürs Leben – durch weise Sprüche (also ein »Philosoph«!) und drastisch-explizite Schilderungen seiner ungezählten Sex-Abenteuer mit »Schnallen und Fotzen« aus aller Welt. Alle anfallenden Arbeiten im Dienst von Mensch und Tier erledigt bereitwillig eine grantelige Haushälterin (»die älteste Frau der Welt«), die beständig frömmelnde Sprüche (»liebes Herzjesulein«) oder aber Sticheleien gegen den nichtsnutzigen Dauergast auf den Lippen, das Herz aber auf dem rechten Fleck trägt.
So patent wie alle diese Leute sind, löst man die meisten Problemchen locker mit guten Worten und gutem Willen. Nur Mama Hanna, ein angeheirateter Stammgast aus Holland und schon seit ihrer Jugend psychisch angeschlagen, hat sich soeben in den Freitod gestürzt (vom Balkon).
In dieses Idyll bricht eines Tages ein widerborstiges Mädel aus reichem Hause ein. Hinter etlichen Spleens und zur Schau getragener rauer Schale werden in seltenen schwachen Momenten innere Nöte erkennbar (»Dann brach Elsas Stimme …«). Augenblicklich reißt Elsa das Regiment über die Herzen der Buben an sich. Zu dritt durchleben sie Schönes und Schauerliches (Schweineschlachten, Tschernobyl; Schule kommt kaum vor) und bleiben doch immer »herrliche Kinder« (wie »Murmeltier« sie stets apostrophiert).
Friede, Freude und Eierkuchen finden ein Ende, als die um Elsa (»die Königin des Murmeltiers«) erweiterte Familie zum Grab der Mutter nach Den Haag reist und da über Onkel Jaap eine neue Welt kennenlernt: die der großen Kunst (von Rembrandt bis zu unserer Zeit), ihrer Besitzer, Manager und Macher. Dort regieren keine Herzen, sondern eiskaltes Kalkül, Falschheit und Gier. In diesem Wunderland finden die Brauer-Buam vom Immenhof als junge Erwachsene eine neue Existenz – halb zieht es sie, halb sinken sie, halb werden sie hineinmanipuliert (Schnittmengen). Unlimitierte Kreditkarten, Kokainlinien und Kohabitationen ad libitum sind der Lohn für Lorenz’ ambitioniertes Kunstprojekt: Er will nichts weniger als »die Ewigkeit« malen, und die greise Mäzenin Irina Graham, launisch und undurchschaubar, sponsert ihn mit ihrem Millionenerbe und ihrem Einfluss. Wie es weitergeht und endet, ist vorhersehbar: Elsa taucht ab, Lorenz genießt, Karl schwankt, Murmelstein stirbt erleuchtet, Papa Randolph säuft; der pathetische Schluss löst offene Fragen mehr oder weniger zufriedenstellend (X »wollte einfach nicht mehr.«).
Astrid Rosenfelds zweites Opus ist ein handwerklich solide gemachter Trivialroman. Ihre Sprache ist wohltuend sorgfältig geformt; es gibt ansprechende Passagen (»Da standen wir, Hannas Mann und Hannas Kinder, aus dem Zusammenhang herausgerissen«, S. 43; »Eine Zimmerlänge, eine Grabesbreite und zwei unbeantwortete Fragen«, S. 153; oder der großartige 1. Satz: »Für manche Menschen scheint die Erde einfach nicht der rechte Ort zu sein«), ein paar nette Weisheiten – und weder Grammatik- noch Druckfehler. Augenfällige Dingsymbole (ein Halskettchen), Leitmotive (Hund versus Wolf) und Formeln (»hatte das Ende der Welt erreicht«) strukturieren die Handlung und setzen überdeutliche Marken: Achtung: bedeutsam!
Aber alle Charaktere sind eindimensionale Standard-Typen; selbst die Protagonisten entwickeln ihre Persönlichkeit kaum, obgleich sie unterschiedlichste Welten durchschreiten. Auch wenn sie sich bisweilen wild gebärden und von ihren Emotionen sprechen, überzeugen sie nicht als lebendige Menschen; sie sind nie wirklich lustig, nie wirklich traurig, nie tragisch, sondern bleiben Papiertiger.
Oberflächlich ist auch die Handlungsgestaltung. Der Ponyhof liegt »in der Oberpfalz«. Aber keiner spricht auch nur ein Wörtchen Dialekt, isst mal einen Leberkäs oder tut sonst was Lokalkoloriertes. Ob Bayerischer Wald, Düsseldorf oder Texas – die Schauplätze bleiben blasse, bedeutungslose, austauschbare Kulissen.
Spannung knistert nirgendwo; trotz kleiner und größerer Schicksalsschläge plätschert die Geschichte merkwürdig flach vor sich hin, ohne unter die Haut zu gehen. Die Konfliktlösungen sind naiv: Der zupackende kleine Bruder rettet die Karriere des verzweifelten Lorenz, indem er einfach mal fix nach Den Haag fährt und ein beherztes Gespräch mit Frau Graham über ihn führt. Und wie läutert man in der Welt des globalen Kunst-Kommerzes die abgebrühtesten Bösewichte? Mit Sätzen wie »Werden Sie Lorenz irgendwann verzeihen?« oder »Alin, denk mal bitte scharf nach. Wer ist hier das Arschloch?« (Die im Kontext intendierte Antwort ist in etwa: »Oh, jetzt wo du es sagst, erkenne ich’s – ich bin selbst ein Arschloch.«)
Eine zentrale Rolle im Plot spielt die Kunst. Dass Lorenz als »der neue Star der internationalen Kunstszene« (Klappentext) reüssiert, verdankt er zwar zu einem guten Teil der Förderung durch die Graham-Gruppe, doch dessen ungeachtet skizziert ihn die Autorin durchaus als fähigen, innovativen, ambitionierten Künstler. Über welche Talente und Konzepte er eigentlich verfügt, das deutet sie allerdings nur sehr vage, wenn nicht unbeholfen an. Im Übrigen gibt sie sich mit reichlichem name-dropping zufrieden. Die Szenen aus der Welt der Kunst bestätigen nur die landläufigen Stammtischphantasien von spinnerten und/oder raffgierigen Künstlern, Sammlern und Händlern, die nichts als Mammon, Orgien und Koks im Kopf haben.
Dem Roman fehlt insgesamt die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit seinen Anliegen. Am unangenehmsten empfinde ich das beim Thema Sex: Einerseits dient ein übler Missbrauchsfall zurecht als Auslöser für tiefe Betroffenheit und Abscheu; andererseits wird mehrfach in heiterem Tonfall erzählt, wie der alte Murmelstein und später auch eine der Damen aus der Kunst-Welt den kleinen Kindern unverblümt und detailliert ihre sexuellen Erlebnisse enthüllen – und mehr. Was also: Ist sexuelle Freizügigkeit mit Minderjährigen nun verheerend oder spaßig?
Zu widersprüchlich, zu flach, zu wenig unterhaltsam.
 · Herkunft:
· Herkunft: