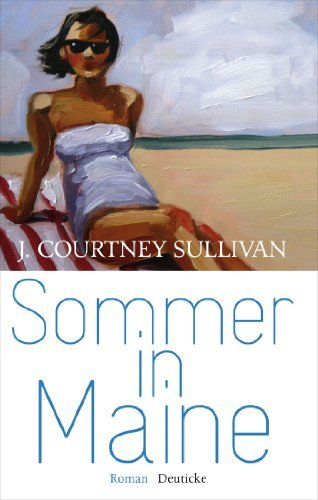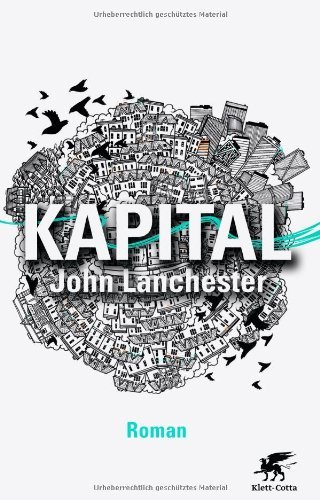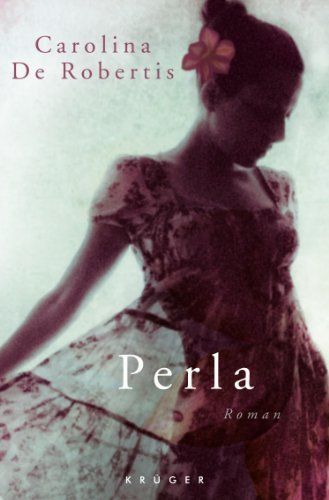
Vater und Vatermörder
Desaparecidos – Verschwundene: So nüchtern und schlicht benannten die Argentinier diejenigen Menschen, die die Militärjunta ihres Landes während der Diktatur 1976 bis 1983 verschwinden ließ. Eine genauere Bezeichnung war ihnen auch nicht möglich, denn diese Personen – am Ende sollen es mehr als 30.000 gewesen sein – wurden von heute auf morgen spurlos von der Bildfläche entfernt. Was blieb den Angehörigen zu tun übrig? Bekannt wurden die Madres de Plaza de Mayo, die Mütter und Großmütter, die jeden Donnerstag auf einem zentralen Platz von Buenos Aires erschienen, um Fotos ihrer unauffindbaren Verwandten vorzuzeigen; die weißen Kopftücher, die sie trugen, waren Ausdruck ihrer Entschlossenheit, die Suche niemals aufzugeben, und Symbol ihrer Solidarität im stillen Protest gegen das Regime.
Nach dem Ende der Diktatur kam ans Tageslicht, auf welche Weise sich die Herrschenden unliebsamer Bürger entledigt hatten. Sie wurden verschleppt, in Lagern gehalten, gefoltert, vergewaltigt, misshandelt, schließlich umgebracht. Carolina De Robertis’ Roman »Perla«  , den Cornelia Holfelder-von der Tann aus dem Amerikanischen übersetzt hat, liegen zwei besonders infame Praktiken zugrunde – die eine vernichtete Leben, die andere zwang es in neue Bahnen.
, den Cornelia Holfelder-von der Tann aus dem Amerikanischen übersetzt hat, liegen zwei besonders infame Praktiken zugrunde – die eine vernichtete Leben, die andere zwang es in neue Bahnen.
Von der ersten Verfahrensweise wurde nichts bekannt, ehe Adolfo Scilingo, ein ehemaliger Korvettenkapitän und Pilot, von seiner eigenen Beteiligung berichtete – erst 1995. Die Gefangenen wurden splitternackt in Flugzeuge verfrachtet und weit über dem Meer vom Himmel hinab ins Wasser gestürzt. Die zweite betraf die Kinder der Opfer. Sie wurden ihren Eltern, bevor man sie tötete, weggenommen und kinderlosen Offiziersfamilien übereignet.
Ein dokumentierter Fall aus dem Jahr 1976 verbindet beide bitteren Motive. Im Februar wird die erst wenige Monate alte Victoria entführt; wenige Monate später wird die Leiche ihres Vaters am Strand von Uruguay angespült. Erst als Erwachsene wird Victorias DNA abgeglichen, erst dann erfährt sie ihren wahren Namen, erhält sie ihre wahre Identität. Von ihrer Mutter fehlt bis heute jede Spur.
Victoria und ihr Schicksal könnten der Autorin als Romanvorlage gedient haben, denn auch Perla wächst in einer Offiziersfamilie auf, und auch ihr toter Vater taucht später wieder auf.
Ehe Perla schlagartig involviert wird, ist sie ein zufriedenes Kind. Wohlbehütet wächst sie im Haushalt eines Offiziers auf und findet, sie habe »Glück, solche Eltern zu haben«. In der Schule erfährt sie zum ersten Mal etwas von Menschen, die verschwunden sind. In der Familie ihrer Klassenkameradin Romina ist der Onkel seit sieben Jahren »einfach weg«, »aus dem Haus gegangen und nicht mehr zurückgekommen«. Rominas Großmutter trifft sich regelmäßig mit anderen Frauen auf der Plaza de Mayo, um mit Plakaten und Fotos zu demonstrieren, um die Regierung anzuklagen und Rechenschaft einzufordern.
Als Perla dies zu Hause berichtet, beruhigt ihre Mutter Luisa sie: »Glaub nicht die Lügen über die Verschwundenen … diese Leute sind hysterisch, sie verstehen vieles nicht.« Was soll Perla denn nun glauben?
Zu Besuch in Rominas Familie hört Perla eines Tages, dass die »Schlimmen Jahre« der dictatura jetzt vorbei seien. Aber zu Hause geht die Verdrängung weiter: Da wird der Fernseher ausgeschaltet, wenn über Gerichtsprozesse berichtet wird, wenn Bilder von Massengräbern gesendet werden – das seien alles »Lügen ausländischer Kräfte«.
Perla baut sich ihr eigenes, sie beruhigendes Weltbild auf. »Die Verschwundenen waren noch irgendwo. Nur nicht bei uns … Ein Riss hatte sich zwischen unserem Planeten und einer anderen verborgenen Welt aufgetan … sie waren durch diesen Riss gefallen … gefangen in einer anderen Dimension«. In einem Schulaufsatz entwickelt sie daraus eine faszinierende Geschichte von »geisterhaften Menschen mit den verzerrten Mündern, … die statt Luft Erinnerungen atmeten.«
Zwar schwirren in Perlas Kopf immer noch Mutters Worte, die Verschwundenen trieben sich in der Welt herum, aber mehr und mehr zweifelt Perla an dieser Version. Die Freundin ist zu intelligent, um bloße Hirngespinste zu verbreiten. Doch Perla wagt es nicht, das Dilemma selbst zu klären, mit eigenen Augen die Demonstration der Madres mit ihren weißen Kopftüchern zu schauen; sie weicht dieser Konfrontation aus.
Die Wende tritt ein, als Perla eines Tages Romina mit zu sich nach Hause nimmt. Auf den ersten Blick erkennt das Mädchen den stolzen Offizier auf dem silbergerahmten Gruppenfoto im Arbeitszimmer: »Er ist einer von ihnen … dein Vater«, und sie rennt hasserfüllt davon.
Bald findet Perla in ihrem Physikbuch einen Zettel in Rominas Handschrift: »BIST DU AUCH EINE MÖRDERIN?« Mit einem Mal holt das Leid der anderen sie nun ein, und »die Verbrechen meines Vaters – und zugleich die der Nation, Verbrechen, die ich nicht in Worte gefasst hatte – ritten auf meinem Rücken, schlangen sich um meine Schultern, klebten an mir und ließen sich nicht wegwischen.«
Mit dieser Last muss Perla zu leben lernen. Nach außen gibt sie sich freundlich und zuversichtlich; in ihrem Inneren schämt sie sich zutiefst. Indem sie reifer wird, denkt sie differenzierter. Ein Psychologiestudium hilft ihr, den Vater besser zu verstehen (er wird zu ihrem »Phantompatienten«) und sich – erst Jahre später – von ihm zu lösen.
Als Studentin verliebt sich Perla in Gabriel, einen investigativen Journalisten, den sie später heiratet. Er berichtet ihr von den Hijos, den Kindern der Verschwundenen, und den geheimen Adoptionen. Könnte nicht auch Perla eine Hija sein? Die Vermutung erschüttert die Beziehung schwer, und es dauert Jahre, bis Perla fähig ist, ihre Identität tatsächlich zu überprüfen.Denn um die Perla von heute sein zu können, muss sie die brutale Wahrheit der Verbrechen an den Desaparecidos als Teil ihres Ichs zu akzeptieren lernen. Ihr leiblicher Vater, so erfährt sie, wurde Opfer eines mehrfachen Mörders, eines Täters, wie ihr Adoptivvater einer war, der sie doch gleichzeitig innigst liebte.
In einem schmerzvollen, verzweifelten Prozess der Selbstfindung transponiert Perla ihre Gedanken in eine andere, eine märchenhafte Welt. Da liegt eines Tages ein ausgezehrter, nackter Körper triefnass mitten im Wohnzimmer, nach »Fisch und Kupfer und verfaulenden Äpfeln« stinkend, und an der »aschfahlen Haut klebte Seetang«. Der Mann kann kaum sprechen, den Kopf kaum heben, er hat nur Durst. In dieser geisterhaften Szene wie aus einer anderen Sphäre ergießen sich die Erinnerungen der Gestalt, die aus den Tiefen des Wassers kommt und mit ihm eins geworden ist: die Aufenthalte in Haft, die qualvollen Folterungen, die nackten Menschenleiber im Flugzeug, der Flug übers Meer, das Öffnen der Ladeklappe, der Sturz in die Tiefe … Wie Tropfen fallen die Gedanken an seine geliebte Frau Gloria, schwanger, gefesselt an einen Stuhl – was mag aus ihr und dem Kind geworden sein?
In diesem parallelen fantastischen Erzählstrang leistet die Autorin Außergewöhnliches, das an prägende Lesemomente in Isabel Allendes »Geisterhaus« erinnert. Carolina de Robertis lässt den toten Vater aus dem Meer als stinkendes, nässendes Wesen mitten in Perlas Leben fallen. Ach wäre es doch fort, dieses eklige Etwas, zusammengerollt wie ein Embryo. Perla fährt zur Uni, doch bei ihrer Rückkehr ist es immer noch da. Der Mann beobachtet sie, sie beobachtet ihn. Jeder verfolgt seine eigenen Gedanken. Den anderen zu erkennen, anzunehmen, mit ihm zu sprechen – das wird erst am Ende des Romans möglich sein. Die literarische Gestaltung fasziniert gleichermaßen: Die bildkräftige, poetische Sprache kontrastiert hart mit den brutalen Inhalten voller erniedrigender, menschenverachtender Gewalt.
Über diesen mystischen Weg vermag Perla die Dämonen ihrer Vergangenheit zu besiegen. Ihre Schwangerschaft erhält eine symbolische Überhöhung. Wie Perlas Eizelle schon in Glorias Mutterleib vorhanden war, war die ihres Kindes bereits in Perla angelegt, ehe sie befruchtet wurde. Da nun der Spuk vorbei ist, der tote Vater in Frieden gehen kann, kann auch Perla ihr Baby in die Welt setzen. Ihr Kind »ist unser aller Wiedererscheinen«. In diesem Kontext gewinnt auch der titelgebende Name der Protagonistin einen tieferen Sinn – die schimmernde Perle, geschützt in einer Muschel, geborgen aus den Tiefen des Meeres …
»Perla« ist ein faszinierender, literarisch perfekter Roman, der den Leser bis zum letzten Buchstaben gefesselt hält und dessen stimmige bildliche Gestaltung durchweg begeistert. Zusätzliches Gewicht verleiht ihm das politisch-historische Anliegen der Autorin. Ihre Anklage ist berechtigt, denn bis heute sind die Verbrechen der Vergangenheit nicht vollständig aufgeklärt, und in vielen Familien lebt das Leid noch immer fort.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Sommer 2013 aufgenommen.
 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: