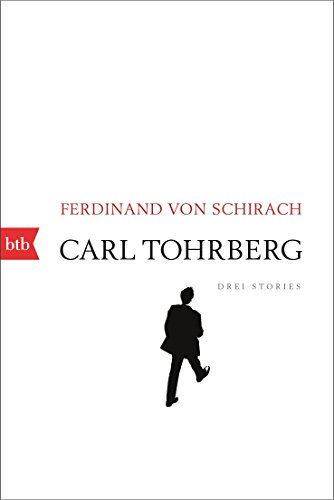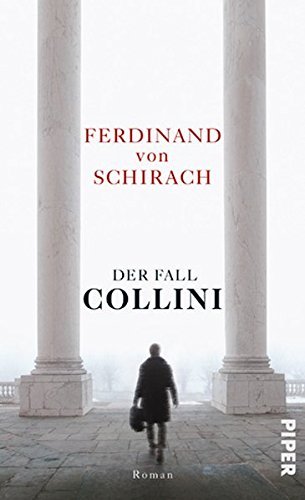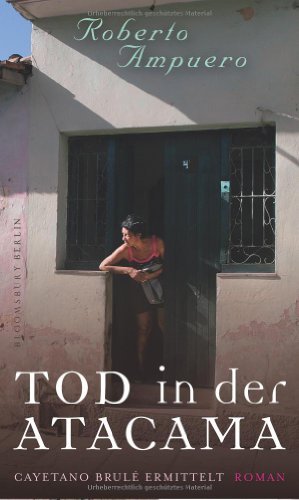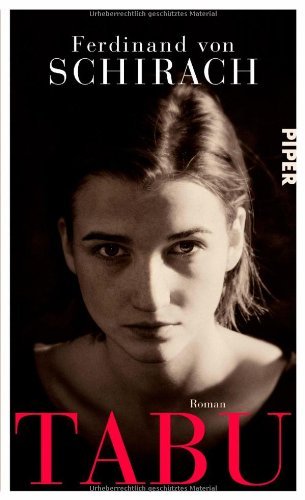
Ein großer Bluff
Die von Eschburgs waren einmal ein angesehenes Adelsgeschlecht. Sie betrieben eine Papiermühle und eine Spinnerei. Aber nach Inflation und Weltwirtschaftskrise war das Vermögen der fleißigen Ahnen dahin, so wie auch von der einstigen Burg, »die dem Dorf seinen Namen gegeben hatte«, nur noch Steinreste zeugen.
Dann bewohnte die Familie eine heruntergekommene Villa am See. Der Putz bröckelt, Blecheimer fangen die Regentropfen auf, die durch das undichte Dach fallen. Allüberall springen dem Betrachter noch Relikte der Sammelleidenschaft der Altvorderen entgegen: »Schirmständer aus Elefantenfüßen … zwei ausgestopfte Krokodile … zwischen Goethe und Herder der Kopf eines schielenden Gibbons … Hocker mit den vier Hufen einer Säbelantilope«.
In diesem Ambiente gehören auch Kinder nur zum Inventar. Man lässt sie erziehen und versorgen. Um Sebastian, den einzigen Sohn des Hauses, kümmert sich die Köchin. Von seinem achten Geburtstag an wird für ihn ein Platz an der elterlichen Tafel mit eingedeckt.
Ein Glück ist das schweigsame Mahl nicht für ihn, denn die Interessen der Eltern sind schon zu weit auseinandergedriftet, als dass sie noch etwas miteinander zu sprechen wüssten. Mutter sucht ihr Heil auf dem Rücken der Pferde und brilliert als Dressurreiterin, Vater flüchtet sich auf die Pirsch durch Wald und Flur.
Der zurückhaltende Sohn vertieft sich in die Welten klassischer Bücher, wird eins mit großen Protagonisten von den Helden griechischer Sagen bis zu Tom Sawyer. Die Patres im Schweizer Privatinternat erwischen ihn, wie er mit wechselnden Stimmen vor sich hinmurmelt.
In den Ferien holt ihn die familiäre Misere zu Hause ein: Ein Unfall sei es gewesen, besänftigt ihn die Mutter, als sie an Sebastians Bett sitzt und seine Hand hält; er habe »nur schlecht geträumt«. Sebastian weiß es besser, hat er doch den Knall in Vaters Arbeitszimmer gehört, ist voller Panik hineingestürmt, hat ihn gefunden. Mit seinem Jagdgewehr hatte Vater sich den Kopf weggeschossen. Welcher Knabe wäre nicht hinfort traumatisiert?
Mutter verkauft nun die Villa; bald heiratet sie auch wieder – einen »Macher« und Schreihals, der Sebastians Unsicherheit in Bezug auf seinen weiteren Lebensweg nicht hinnehmen kann: »Du gehst auf so eine teure Schule und hast keinen Plan.« Der Vater hatte die Bedeutung intakter Wurzeln besser erkannt, als er sagte, »das Haus würde immer da sein … Sebastian und seine Kinder und seine Enkel würden auch noch hier leben. Ein Mensch sei verloren ohne sein Zuhause.« Vorbei, vorbei …
Als Mutter es nicht schafft, zu seiner Abiturfeier zu kommen (»die Nerven«), schneidet Sebastian das dünne Fädchen, das sie verbindet, endgültig durch und geht seiner eigenen Wege. In Berlin lernt er bei einem Fotografen.
Wenige Jahre später wird Sebastian zu einem Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Umstände und Hintergründe bleiben mysteriös. Er gesteht einen Mord, widerruft sein Geständnis jedoch später. Die zugehörige Leiche wird nie gefunden, denn – das angebliche Opfer lebt. Schon bei seiner Verhaftung kannte Sebastian die vermeintlich gemeuchelte Frau, hatte ja auch ihr Studium finanziert. Abseits jeglichen Verbrechens genießt sie ihr fideles Dasein an einem Sebastian bekannten Ort.
Wie soll man das verstehen? Ist Sebastian von Eschburg ein Freak, ein Performance-Künstler, der mit respektheischenden Institutionen Possen reißt? Ist alles nur eine Farce, ein inszeniertes Spiel um Wirklichkeit und Wahrheit?
Verständlich ist es ja, dass dieser Sebastian schon seit seiner Kindheit und Jugend merkwürdig ist. Beispielsweise assoziiert er Farben, um die Realität besser zu erfassen: »Die Hände des Mädchens waren aus Cyan und Amber, seine Haare leuchteten für ihn violett mit einer Spur Ocker.« (Dass die vier Romankapitel mit »Grün«, »Rot«, »Blau« und »Weiß« überschrieben sind, unterstreicht die zentrale Bedeutung der ›Farbenlehre‹.)
Weniger harmlos mutet sein Verhalten an: Als er den neuen Partner seiner Mutter zufällig beim Masturbieren beobachtet, schneidet er sich in vollem Bewusstsein die linke Zeigefingerkuppe ab; »für einen Moment fühlte er sich lebendig.«
Gleichzeitig entwickelt Sebastian künstlerische Sensibilität und Kreativität. In seinen Fotografien sucht er einen weichen, warmen Ton, um Gegenstände, Menschen und Landschaften so zu erfassen, wie er sie ertragen kann, »fließend, vergangen und warm«. Seine Ausstellungen und Bildbände begeistern, er findet internationale Anerkennung.
Sebastians langjährige Freundin Sofia bemerkt ihm gegenüber, der überwiegende Farbton seiner Bilder sei »Sepia, die Tinte des Tintenfisches. Manche Ärzte verschreiben sie gegen Depressionen.« Tatsächlich könnte man nachvollziehen, wenn jemand mit solch einer seelisch verarmten Vergangenheit vor dem Leben flieht, psychische oder charakterliche Störungen entwickelt, insbesondere unter einem übersteigerten Geltungsbedürfnis leidet. Wäre dies ein ›normaler‹ Psychothriller, ließe der Leser dem Mann durchaus auch einen Frauenmord durchgehen. Aber sich ohne Not des Mordes anklagen zu lassen und sogar ein Geständnis abzulegen, das strapaziert den Bogen der Plausibilität doch allzu sehr.
Was also will Ferdinand von Schirach uns in seinem zweiten Roman sagen? Auf den ersten einhundert Seiten lesen wir in gewohnt distanziertem Berichtsstil – schnörkellos, unterkühlt, schnittgenau, präzise – aus dem Leben eines irgendwie verformten Menschen. Dann müssen wir die unappetitlichen Passagen hinter uns bringen, in denen der Fotograf Francisco de Goyas Gemälde »Die nackte Maja« als pornografische Gruppeninszenierung nachstellt. Erst anschließend landen wir endlich auf dem Terrain, auf dem der Autor wirklich kompetent ist: der als Handlung aufbereiteten Erörterung eines juristisch/moralisch/ethisch komplexen Falles, bei dem die Wahrheit nicht unbedingt enthüllt zu werden braucht, vielleicht nicht einmal gefunden werden kann. Katalysator ist, wie schon in von Schirachs innovativen Erzählbänden »Verbrechen« und »Schuld«, der Rechtsanwalt Konrad Biegler, der außerdem für die interessante Perspektive sorgt: Unabhängig von Wahrheit und Schuld muss der Strafverteidiger seine Pflicht erfüllen, den Angeklagten zu verteidigen.
In der Tat erwirkt Biegler für Sebastian von Eschburg vor Gericht überzeugend einen Freispruch. Denn Sebastian habe nur deswegen gestanden, weil ihm ein Polizist während des Verhörs Folter angedroht habe, und dazu gibt es sogar einen Vermerk in den Akten . (Natürlich knüpft von Schirach hier an den Fall des Jurastudenten Magnus Gäfgen an, der 2002 den kleinen Jakob von Metzler entführte und dem man Schmerzen zuzufügen androhte, um ihn zur Preisgabe des Verstecks zu bewegen.)
Damit wirft Ferdinand von Schirach ein heißes Eisen in die Runde: Ist die Würde des Menschen wirklich unantastbar? Oder sind Fälle denkbar, in denen sie verhandelbar ist? Darf etwa, wie im konkreten Fall, ein Mensch mit Folter bedroht oder womöglich gar gefoltert werden, um ein Menschenleben zu retten? Und steht die Würde des Bedrohten umso eher zur Disposition, wenn die Zahl der Menschen, die zu schützen sind, steigt? Hierzu hat von Schirach einen ausgezeichneten Essay verfasst (»Die Würde ist antastbar – Warum der Terrorismus über die Demokratie entscheidet«, SPIEGEL 38/2013). Doch wer hoffte, dass sein neuer Roman »Tabu« dieses brisante Thema vertiefen würde, wird leider enttäuscht: Viel zu wenig Raum widmet der Autor dieser brandaktuellen Problematik.
In einem »Hinweis« auf der letzten Seite des Buches schreibt Ferdinand von Schirach: »Die Ereignisse in diesem Buch beruhen auf wahren Begebenheiten.« Das galt für alle seine Bücher und macht sie so faszinierend. Diesmal aber fügt er hinzu: »›Wirklich?‹ fragte Biegler.« Und auch viele Leser werden sich fragen, ob der Autor hier nicht zuviel »inszeniert« hat, wie Biegler das auch von seinem Mandanten vermutet.
 · Herkunft:
· Herkunft: