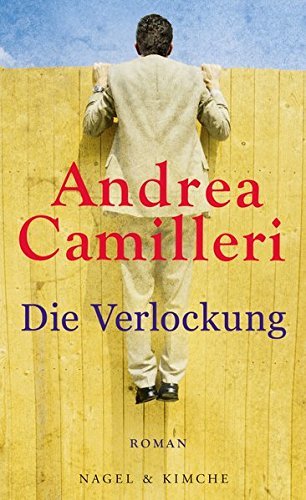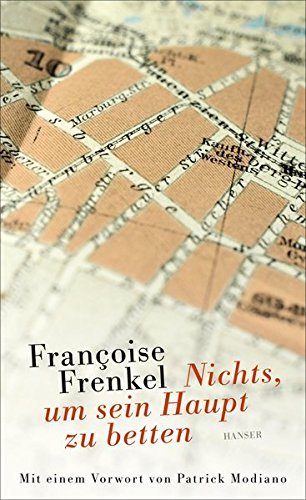
Am seidenen Faden
Aus den unsortierten Bücherkisten eines Trödelmarkts in Nizza fischte Michel Francesconi die Originalausgabe einer Biografie, die 1945 gedruckt, kaum beachtet und vergessen worden war. Aber der Bücherfreund, selbst Autor und Illustrator, erkannte die Qualitäten seines Zufallsfundes und initiierte eine Neuausgabe. Sie erschien 2015 mit unverändertem Text und einem Vorwort des Literatur-Nobelpreisträgers Patrick Modiano bei Gallimard, Paris, und 2016 in der Übersetzung von Elisabeth Edl bei Hanser.
Zweierlei macht dieses Buch lesenswert: Die literarisch gebildete Autorin schreibt in hoher stilistischer Qualität (die in der Übersetzung gut erhalten ist), und es überzeugt durch die Authentizität einer direkten Zeitzeugenschaft, die trotz der Unmittelbarkeit schrecklicher Erlebnisse emotionale Distanz zu halten vermag.
Die Verfasserin wurde am 14. Juli 1889 in Piotrków (bei Lodz) als Frymeta Idesa Frenkel geboren. Schon ihre Kindheit erlebt sie als Reich voller Bücher. Die Eltern fördern ihre Leseleidenschaft und Kreativität, lassen ein Möbelstück schreinern, das die sechzehnjährige Tochter selbst entworfen hat: ihre erste eigene Bibliothek. Die Literatur wird auch ihr akademisches Studienfach an der Sorbonne in Paris. Nebenbei arbeitet sie in der Bibliothèque Nationale und sammelt praktische Erfahrungen bei einem Buchhändler. Im pulsierenden Treiben der Metropole scheint das Getöse des Weltkriegs weit entfernt, hat nur »die allgemeine Fröhlichkeit ein wenig gedämpft«.
In ihrer Heimat verschont das Kriegsgeschehen dagegen kaum jemanden. Bei ihrer Rückkehr 1920 ist Françoise, wie sie inzwischen genannt wird, glücklich, ihre Angehörigen unversehrt wiederzufinden. Entsetzt ist sie allerdings über die kulturbanausischen russischen Besatzer, die im Haus gewütet und geplündert haben.
Geduldig, zäh und mutig realisiert die junge Frau ein kühnes innovatives Projekt: eine Buchhandlung für französische Literatur in Berlin. Dazu muss sie bürokratische Hürden überwinden, sich vorerst mit einem kleinen Laden im Zwischengeschoss eines Privathauses begnügen, bis das »Maison du Livre« schließlich rasant reüssiert und in der Nähe des Touristenmagneten KaDeWe im mondänen Viertel der Passauer Straße eröffnet. Während sich das Interesse der Deutschen an rein französischer Literatur anfänglich noch in Grenzen hält, entdecken Ausländerinnen – Polen, Russen, Tschechen, Türken, Norweger, Schweden, Österreicher – das Juwel, wo unter anderem begehrte Modezeitschriften ausliegen.
Françoise erweitert ihre Buchhandlung zum Ort geistig-kultureller Begegnungen, indem sie Vorträge und Autorenlesungen, begleitet von unterhaltsamen musikalischen und schauspielerischen Darbietungen, organisiert. Voller Optimismus hofft sie auf eine »mögliche Verständigung zwischen den Völkern«. Bald geht die intellektuelle frankophile Elite ein und aus – Claude Anet, Henri Barbusse, Julien Benda, Madame Colette, André Gide, Aristide Briand.
Der Politik aber will Françoise kein Podium bieten. Dabei bekommt auch sie schon die zunehmende Willkür der zukünftigen Machthaber in Deutschland zu spüren: Polizeikontrollen, Beschlagnahme indizierter Bücher. Nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze (1935) wird das »Maison du Livre« unter dem Schutz der französischen Verlage zwar noch geduldet, aber die jüdische Eigentümerin erkennt die Zeichen der Zeit und beginnt ihr Geschäft aufzulösen.
Im August 1939 beginnt Françoise Frenkel ihre Flucht, zunächst nach Paris, dann der deutschen Besetzung weichend nach Avignon, im Dezember 1940 nach Nizza. Da sich das Vichy-Regime mit der Verfolgung und Auslieferung von Juden als verlängerter Arm der Nazis in Paris erweist, gibt es auch hier keine Sicherheit. Die Autorin berichtet von den Schicksalen vieler Gestrandeter, die unterwegs ihr gesamtes Eigentum eingesetzt haben, um der Entdeckung zu entgehen, durch korrupte Helfer ausgesaugt, durch französische Kollaborateure verraten wurden, Polizeirazzien zum Opfer fielen. Ist Françoise selbst stark genug, um sich gegen alle Gefahren zu retten? Als sie zufällig Zeugin wird, wie Juden in überfüllte Busse eingepfercht und abtransportiert werden, ist sie versucht auszurufen: »Nehmt mich mit, ich gehöre zu ihnen.« Doch dann fragt sie sich: »Wem würde dieses Opfer nützen? Was konnte es ändern? Wozu?«
Françoise hat Freunde in der Schweiz, die ihr Visa und Geld zukommen lassen. Dennoch wird für sie kein Schlagbaum geöffnet. Dreimal versucht sie die gefährliche Grenzüberquerung, wird schließlich erwischt und festgenommen. Den Freunden hat sie es zu verdanken, dass sie aus dem Gefängnis freikommt, wiederholt in vermeintlich sicheren Verstecken kurzzeitig untertauchen kann und im Juni 1943 endlich auf illegale Weise die Schweiz erreicht.
Beeindruckend, wie das Ehepaar Marius und viele andere »Menschen guten Willens« trotz stets drohender Repressalien bis hin zur Inhaftierung uneingeschränkt Hilfe leisten. »Hier sind Sie zu Hause, das heißt, bei guten Franzosen. Nichts wird ihnen zustoßen, solange wir die Herren hier sind. Was die Zukunft angeht und die Vergeltung, darauf können Sie sich verlassen, so wahr ich Marius heiße!«
Nach ihrer Odyssee durch Frankreich im letzten Moment vor der sicheren Deportation in die Vernichtungslager bewahrt, beginnt Françoise am Vierwaldstätter See unter dem frischen Eindruck der letzten beklemmenden Phase, voller Sorge um die Angehörigen in Polen und voller Angst um die eigene Sicherheit mit der Niederschrift ihrer Biografie »Rien où poser sa tête«  . Sie sieht sich in »der Pflicht der Überlebenden, Zeugnis abzulegen« für die, »die für immer verstummt sind, unterwegs vor Erschöpfung gestorben oder ermordet«. In ihren Vorbemerkungen widmet sie ihr Buch aber auch den »Menschen guten Willens«, die mit »unermüdlicher Tapferkeit« »ihren Willen der Gewalt entgegengestellt« haben.
. Sie sieht sich in »der Pflicht der Überlebenden, Zeugnis abzulegen« für die, »die für immer verstummt sind, unterwegs vor Erschöpfung gestorben oder ermordet«. In ihren Vorbemerkungen widmet sie ihr Buch aber auch den »Menschen guten Willens«, die mit »unermüdlicher Tapferkeit« »ihren Willen der Gewalt entgegengestellt« haben.
Françoise Frenkels Autobiografie ist frei von rührseliger Larmoyanz, frei von Hass oder Groll gegen die Unterdrücker, die Kollaborateure, Xenophoben und Antisemiten. So bizarr grausam und unmenschlich die Geschehnisse sind, ist doch sogar Raum für heitere Episoden, zum Beispiel als Françoise die gefälschten Papiere einer siebzigjährigen Französin erhält und auf dem Passbild als persönliches Merkmal eine Warze am Kinn prangt. Wie soll Françoise, Mitte fünfzig, dieser Vorgabe gerecht werden?
Im Anhang ergänzen eine Zeittafel, ein Dossier mit Schwarz-Weiß-Dokumenten und Bemerkungen zur deutschen Ausgabe dieses beeindruckende, so lange übersehene Zeugnis aus dunklen, heute wieder gern verdrängten Zeiten.
 · Herkunft:
· Herkunft: