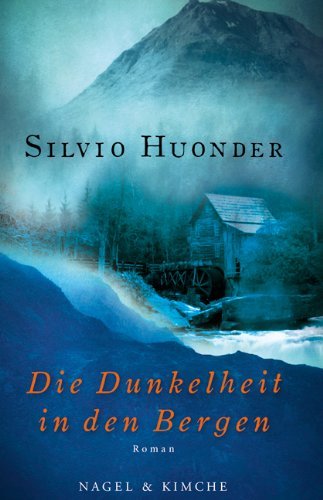Ein dünnes Stöffchen
Fridas Kindheit war nicht wirklich schön. Ihre Mutter, mit sich und der Welt nicht zufrieden, konnte dem Mädchen nicht die Herzenswärme geben, nach der sie sich sehnte. Ein wenig mehr davon verspürte Frida bei ihrem Vater, einem Anwalt, der aber auch zu Wutausbrüchen neigte. Nun ist er nach schwerer Krankheit verstorben.
Frida ist jetzt sechsundzwanzig Jahre alt und arbeitet als Verkäuferin in einer Parfümerie. Nach Vaters Tod fühlt sie das Bedürfnis, ihr Leben zu ändern. Er hatte ja einmal davon gesprochen, ihr ein bisschen Startkapital zu hinterlassen; davon könnte sie sich vielleicht eine kleine Wohnung kaufen. Vor allem möchte sie sich beruflich neu orientieren. Beim »Wochenblatt« sucht man händeringend neue Mitarbeiter, und da kann sie als ungelernte Journalistin mit kleinen Reportagen anfangen.
Die Welt des Journalismus ist schnelllebig, Publikum und Macher fordern ständig neue Knüller und professionelle Produkte. Wird man von jemandem, der zuerst einmal den Duft seines Gegenübers identifiziert, um sich dann auf dessen Klamotten und sein Aussehen zu konzentrieren, eine kritische Weltsicht, seriöse Recherchen, anspruchsvolle Kommentare erwarten können? Dazu scheint mir nicht nur Frida ein allzu naives Ding; auch die Einblicke, die Gerður Kristný dem Leser in dieses Berufsfeld zumutet, sind harmlos und oberflächlich bis zur Unerträglichkeit.
Genauso unbefriedigend verlaufen Fridas Versuche, endlich mit ihrer Schwester Gubba ins Reine zu kommen. Sie neidet Gubba deren Nähe zur Mutter, und etliche Erlebnisse in der Vergangenheit haben ihre Beziehung zueinander vergiftet. So enden auch ihre neuerlichen Begegnungen fruchtlos, die Gespräche gehen aneinander vorbei, stecken voller Misstrauen, arten in Streitereien aus. Hier gelingt es der Autorin, in einer Atmosphäre der Tristesse, die anrührt und am Ende sogar richtig schmerzt, Orientierungslosigkeit, fehlende Reife und mangelndes Durchsetzungsvermögen einer jungen Frau widerzuspiegeln. Doch scheitert der gute Ansatz in der Ausgestaltung an ausbleibender Konsequenz und an ausufernden Nebenhandlungen, die die Seiten füllen, ohne für die zentralen Problemkreise irgendwelche Relevanz zu gewinnen.
Die Autorin Gerður Kristný erhielt für ihren Roman »Die grüne Bluse meiner Schwester« (»Bátur með segli og allt«) den Halldór-Laxness-Literaturpreis, der nach dem Literaturnobelpreisträger des Jahres 1955 benannt ist. Das hat meine Erwartungen ebenso stimuliert wie die Werbebotschaft auf dem rückwärtigen Cover des hübsch gestalteten Taschenbuchs: »Intelligent, schräg und typisch isländisch«. Nun gut, manche Textstellen sind ganz nett, was vor allem dem an der Umgangssprache orientierten Stil der Autorin bzw. Tina Fleckens amüsanter Übersetzung zu danken ist (Wie wohl Metaphern wie »sich vom Acker machen« oder »hirnrissig« auf Isländisch klingen?). Aber insgesamt fand ich das Buch keineswegs zum Brüllen komisch, sondern eher langweilig und seinen Humor sehr eigenwillig.
 · Herkunft:
· Herkunft: