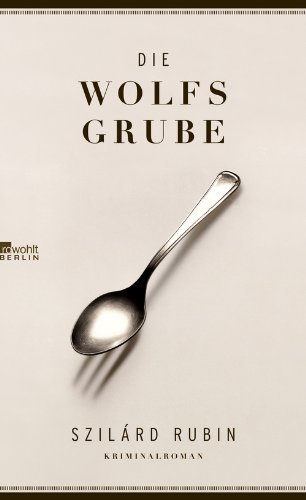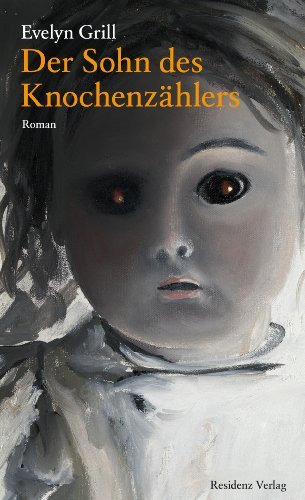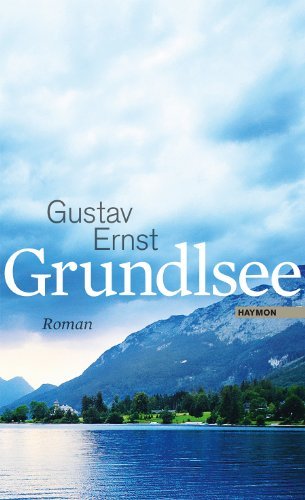
Verlorene Heimat
Der Vater ist auf Geschäftsreise in Asien bei einer Flugzeugexplosion ums Leben gekommen. Hätte er doch seinen Job gekündigt! Seine Frau hätte nichts dagegen gehabt, aber sie haben nie darüber geredet. Nun ist er tot und kann nur noch aus einer höheren Dimension auf seine Familie hinabschauen. Die Erinnerungen an die Anfänge der Ehe und an die schöne Zeit mit den Kindern schwinden dahin: »Ihre Namen und den meiner Frau weiß ich schon längst nicht mehr.« Ein bisschen eintönig ist es schon, im gesamten Text durchgängig nur »meine Frau« zu lesen. Aber am Ende versteht man die kleine Erzählung aus der Ich-Perspektive des Vaters.
Enkelin Miranda hat aus der Großfamilie niemanden außer ihrem Vater John kennengelernt, aber was der ihr darüber erzählte, hat sie tief beeindruckt. Deswegen zieht es sie zu den Wurzeln, zu den Anfängen an den Grundlsee.
Rückblick: Am See verbringt die Wiener Familie jeden Sommer wunderschöne, ungetrübte Stunden in ihrem Ferienhaus. Die Eltern und die Kinder John, Bella und Baby Lili toben, spielen, wandern, schwimmen, fahren Boot. Mit so einem turbulenten Tag der jungen Familie setzt der Roman ein. Kaum ist die Sonne aufgegangen, kuscheln sich die Kinder John und Bella schon zu ihren Eltern ins Bett. Man plant einen gemeinsamen Ausflug zum Baden am Sommersbergersee, denn der ist wärmer als der Grundlsee. Man will ihn umlaufen und an der Fischerhütte Schweinsbraten essen. Also los (die Eltern sind ein eingespieltes Team): anziehen, Lili wickeln, frühstücken. Da ist Leben in der Bude, und der Tag gelingt prächtig. Nach abendlichen Schweinsrippchen und »mit Powidl gefüllten Buchteln mit Vanillesoße« gibt es noch einen Zeichentrickfilm im Fernsehen, dann sind die Kinder endlich reif für ihre Kisten. Die Eltern atmen auf: »Endlich ist eine Ruh.«
In ihrer beneidenswerten Familienidylle können die Kinder kaum nachvollziehen, was es mit einer Scheidung auf sich haben mag, wie sie sie aus ihrem Freundeskreis kennen: »Dass Papa nicht daheim wohnt, obwohl er der Papa ist?« Nein, sie wollen immer alle als Familie zusammen bleiben und noch im Grab beeinander liegen. Der befremdliche Wunsch aus Kindermund wird sich nicht erfüllen.
Zeitsprung, zehn Jahre später: Die Jugend – inzwischen 17/15/10 Jahre alt – macht Ferien im Ausland, während die Eltern in vollen Zügen ihren Urlaub am Grundlsee genießen, soweit es die sorgenvollen Gedanken gestatten, die ständig um ihre Brut kreisen.
Zeitsprung, fünfzehn Jahre später: John wohnt in Den Haag, entwickelt Computerspiele, ist verheiratet und hat eine Tochter namens Miranda. Bella (verheiratet, zwei Kinder) arbeitet als Ärztin in Baltimore. Lili lebt in Brüssel, wo sie beim EU-Parlament arbeitet und die Männer wechselt wie …, na, Sie wissen schon. Wo alle so vollauf beschäftigt sind, schaffen sie es kaum, sich zu treffen; selbst ein Telefonat mit Mutter in Wien ist zeitlich schwer einzurichten. Dabei ist Vater gerade auf seinem Flug nach Asien abgestürzt und Mutter allein mit ihrer Trauer.
Zeitsprung, fünfzehn Jahre später: Das Schicksal schlägt weitere Kapriolen …
Gustav Ernsts Familienroman »Grundlsee« ist ein besonderes Stück konstruierter Literatur über drei Generationen hinweg. Die Handlung wird nicht chronologisch erzählt, sondern erschließt sich aus den Dialogen der Figuren. Die gesprochenen Sätze sind lapidar kurz, werden aber zu endlosen Ketten aneinandergereiht, ohne Anführungszeichen, ohne Absatz, allein das Verb »sagen« beendet penetrant jeden Redeanteil. Das Produkt wirkt künstlich. Doch es ist direkte Rede, und die Unvermitteltheit zieht den Leser zusammen mit den rasanten Sprecherwechseln sogartig weiter und in die Tiefe. Nach kurzer Zeit hüpft man über die nervigen »sagt meine Frau/John/Bella/…«-Einsprengsel einfach hinweg.
Die erzählte Zeit umfasst nur je einen Handlungstag in jeder Phase, und sie tragen sich an unterschiedlichen Orten zu:
Amsterdam, nach Vaters Tod: Lili und John treffen sich mit ihrer Mutter in einem Thai-Restaurant. Gemeinsam reflektiert man Kindheitserinnerungen, verarbeitet Vergangenheit, zankt sich, wird wehmütig: »Ihr werdet einander sicher irgendwann einmal brauchen«, mahnt Mutter. Zum Grundlsee fährt sie nicht dieses Jahr: »Ich allein?«
Triest, fünfzehn Jahre danach: John und Bella haben sich in einem Cafe verabredet. Sie bedauern, wie sich die Geschwister immer weiter auseinandergelebt haben, räumlich wie charakterlich. Jeder hatte seine eigenen Probleme, seinen eigenen Kopf. Sie hätten einander dringend gebrauchen können, jeder hat sich nach dem anderen gesehnt, aber keiner hat sich wirklich öffnen, die anderen um Hilfe bitten können. »Zum Anrufen hat es komischerweise nie gereicht. Da hätt ich mir lieber die Zunge abgebissen.«
Immerhin tauschen sie sich bei diesen Gelegenheiten aus. Nur dadurch – da ein Erzähler kaum auftritt – erfahren wir Leser die Interna der Familie: Vater war schon einmal verheiratet; Johns Frau ist drogenabhängig …
So artifiziell dieser Roman daherkommt, so strohtrocken der Erzählton klingt (ein wenig Musik bringen nur die Redeanteile), so rühren uns doch die Charaktere und ihre Entwicklung. Es schmerzt, dass die Geschwister verlernen, einander ihre gegenseitige Liebe zu zeigen. Es schmerzt, dass Vorwürfe über Jahre unausgesprochen bleiben, bis kein Verzeihen mehr möglich ist. Es schmerzt, dass selbst eine so stabile gemeinsame Basis wie die des Grundlsees Zerfall nicht verhindern kann.
Am Ende bleibt Bella allein zurück. Ihre Selbstkritik ist bitter: »Mein ganzes Leben bin ich zu spät gekommen.« Jetzt ist niemand mehr da, mit dem sie zum verlorenen Ort ihrer unbekümmerten Kindheit heimkehren könnte: »Der Grundlsee ist mein größtes Grab«.
Gustav Ernsts »Grundlsee« ist keine gewöhnliche Lektüre; sie wirkt spröde. Aber sie ist ein lohnendes Erlebnis.
 · Herkunft:
· Herkunft: