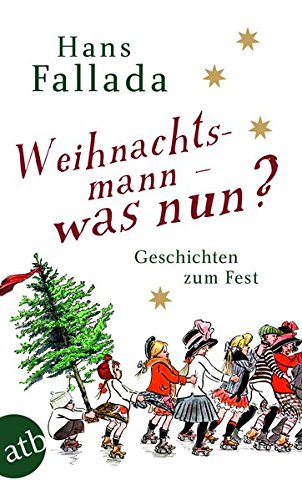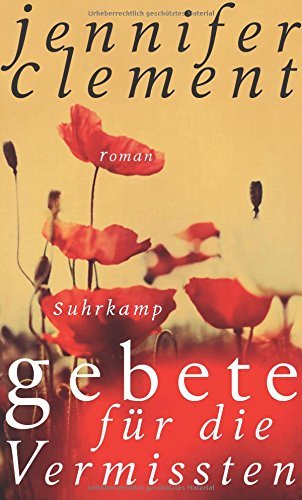
Wo man Mädchen in Erdlöchern versteckt
Acapulco – wer wollte da nicht von Sonne, Sandstrand, Luxushotels und unbeschwertem Urlaub träumen? Doch die Stadt ist mit über 140 Morden je 100.000 Einwohnern im Jahr eine der tödlichsten der Welt. Guerrero, der Bundesstaat, in dem die mexikanische »Ferienoase« liegt, gilt als der gefährlichste des ganzen Landes. Weltweites Aufsehen erregte er, als im September 2014 43 Studenten verschleppt und offenbar getötet wurden; dahinter steckten wohl Mitglieder der lokalen Regierung und der Sicherheitsbehörden, letzten Endes die Drogenkartelle, die Mexiko mit Schmiergeldern und Brutalität unter ihre Kontrolle gebracht und das staatliche Rechtssystem ausgehebelt haben. Inzwischen findet man immer neue Massengräber, aber die Welt ist längst zu aktuelleren Themen übergegangen.
Die amerikanische Autorin Jennifer Clement hat dem brisanten Thema, das Leid über eine ganze Region bringt, einen Roman gewidmet. Im Februar 2014 erschien »Prayers for the Stolen«  in den USA; schon jetzt liegt die deutsche Übersetzung von Nicolai von Schweder-Schreiner vor: »Gebete für die Vermissten« erzählt, unter welch unglaublich deprimierenden Umständen Frauen und Mädchen in einer Gegend leben, in der Gesetzlosigkeit und nackte Gewalt jegliche Ordnung und Humanität weggefegt haben.
in den USA; schon jetzt liegt die deutsche Übersetzung von Nicolai von Schweder-Schreiner vor: »Gebete für die Vermissten« erzählt, unter welch unglaublich deprimierenden Umständen Frauen und Mädchen in einer Gegend leben, in der Gesetzlosigkeit und nackte Gewalt jegliche Ordnung und Humanität weggefegt haben.
In den einfachen Hütten eines kleinen Bergdorfes mitten im tropisch-heißen Dschungel Guerreros hausen lauter Frauen mit ihren Kindern. Die Männer sind abgehauen, wollten später Geld schicken, aber ihre Spuren verloren sich schnell. Manche wurden vielleicht bei ihrer Flucht in die USA erschossen, andere haben irgendwo neue Familien gegründet. Jedenfalls sind die Frauen jetzt auf sich allein gestellt, und sie schlagen sich tapfer und einfallsreich gegen jede Gefahr. Schlangen, und rote Ameisen, deren Bisse die Arme so dick anschwellen lassen, dass sie wie Beine aussehen, sind eine alltägliche natürliche Bedrohung.
Die größte Gefahr aber geht von Bestien ganz anderen Kalibers aus. Sie rücken auf Motorrädern oder in SUVs an, tragen Ray-Ban-Brillen auf rasierten Köpfen, Kalaschnikows hängen über ihre Schultern, in den Jeanstaschen stecken Granaten und Kokainbeutel, in den Hemdtaschen Marlboro-Päckchen. Niemand ist vor ihrer Menschenjagd sicher. Erst entführen sie die Bauern vom Maisfeld weg, damit sie bei der Marihuana-Ernte helfen. Dann nehmen sie sich Mädchen vor, die gerade die Pubertät erreicht haben. Keine von ihnen ist je zurückgekommen und konnte berichten, was ihr widerfuhr, doch die Mütter ahnen, was geschieht, und befürchten das Schlimmste.
Die Protagonistin und Ich-Erzählerin heißt Ladydi Garcia Martinez. Ihre Mutter Ruth hatte ihr den Namen der britischen Prinzessin gegeben, weil sie eine Art »Heilige der Betrogenen« ist. Den mörderischen Hass ihrer Mutter auf alle verderbten Männer, Prinz Charles eingeschlossen, trägt Ladydi somit immer mit sich herum. Ihr Vater hatte mit allen Frauen im Dorf Sex, ehe er seine Frau auf Nimmerwiedersehen verließ. Seither erwartet Ruth, stets vom Alkohol benebelt, sehnsüchtig den Tag der Abrechnung, an dem er durch die Tür tritt und sie ihn abballern kann.
Ruth ist von allen getäuscht. Zu Gott beten? »Bitte nie um Liebe und Gesundheit ... Wenn Gott hört, was du willst, gibt er es dir nicht. Garantiert.« Sich auf die Obrigkeiten verlassen? Traue niemandem! Hier sind »alle Drogendealer, die Polizei ohnehin, der Bürgermeister garantiert auch, sogar unser Scheißpräsident.« »Das Leben ist böse,« lautet ihre bevorzugte Maxime.
Zuwendung oder gar Liebe findet Ladydi in ihrem trostlosen Zuhause nicht. In der Hütte gibt es nicht einmal Möbel. Der Kühlschrank ist Mutters Heiligtum; darin kühlt sie zwischen Bier, Eiern und Käse auch Kissen, um nachts für ein paar Stunden einen kühlen Kopf zu haben. Ansonsten dudelt der Fernseher, vorzugsweise »History Channel«, Mutters Tor zur Welt.
Der anfangs fünfjährigen Ladydi erschließt sich erst nach und nach, warum und wozu ihre Mutter oft eigenartig handelt. Sie ruft sie beispielsweise immer nur »Junge« und kleidet sie auch so. Sie hält ihr einen gesprungenen Spiegel vors Gesicht und kommentiert: »In Mexiko ist es das Beste, ein hässliches Mädchen zu sein.«
In der Grundschule tragen alle Mädchen kurze Haare und Jungenkleidung – bis auf Maria. Dass sie mit einer Hasenscharte zur Welt kam und deswegen niemals entführt werden würde, rechnet man ihr als Glück an.
Als Ladydi älter wird und ihre Weiblichkeit unaufhaltsam hervorbricht, geht ihre Mutter das Problem pragmatisch an: »Jetzt machen wir dich hässlich«. Und weil »nichts abstoßender [ist] als ein dreckiger Mund«, erwägt sie einen Moment lang, ihrer Tochter einzelne Zähne auszuschlagen. Aber dann besinnt sie sich darauf, mit einem Filzstift den weißen Schmelz zu verschmieren, so dass die Zähne vergammelt aussehen. Ruth beherrscht diese Tricks, denn sie betreibt einen Schönheitssalon. Als sie ihn fünfzehn Jahre zuvor eröffnete, schwebte ihr vor, hübsche junge Mädchen mit besonderen Frisuren, Make-up und Nagellack herauszuputzen. Nun ist der Traum zerstoben, und aus »The Illusion« ist ein professioneller »Hässlichkeitssalon« geworden.
Später gräbt man Erdlöcher, damit sich die Mädchen wie kleine Karnickel verstecken können, wenn die Jäger kommen. Die Idee stammt von Concha, der Mutter von Ladydis bester Freundin Paula. Doch ehe sie realisiert werden konnte, wurde Paula, das hübscheste von allen Mädchen, von den Dealern geholt, direkt aus ihrem Bett. Sie trug ein langes T-Shirt ihres (verschwundenen) Vaters und einen rosa Schlüpfer – »was schlimmer [ist], als nackt zu sein«.
Ladydi bleibt ein solches Schicksal erspart. Marias Bruder Mike beschafft ihr einen Job als Kindermädchen bei einer reichen Familie in Acapulco. Welch glückliche Fügung! Als Mike sie in seinem Ford Mustang dorthin bringt, hat er auf einer Ranch abseits der Schnellstraße kurz noch etwas zu erledigen. Er kommt blutbeschmiert zurück ins Auto und eröffnet Ladydi, warum ihr Vater seiner Mutter regelmäßig Geld aus New York schickt. Für Ladydi bricht eine Welt zusammen. Wie ein Roboter nimmt sie teilnahmslos die Befehle des Mannes entgegen, der gerade zum Killer geworden ist: »Ich gehorchte. Ich gehorchte. Ich gehorchte.« Selbst die Plastiktüte, die er ihr zusteckt, nimmt sie zur Aufbewahrung entgegen.
In der noblen Villa über den Klippen erlebt Ladydi ein paar glückliche Monate. Sie verliebt sich in den Gärtner Julio, aber schon bald steht die Polizei vor der Tür und stellt Ladydi unangenehme Fragen ...
Hart, wie das Leben Ladydi mitspielt, so erzählt sie es aus ihrer Perspektive: Ihre Sprache ist faktisch, kurz und bündig. Um so erschütternder wirken die Aussparungen, das Nichterzählte, in unserem Kopfkino, etwa wenn Paula sich Ladydi öffnet und ihr berichtet, wie sie (wie viele andere entführte Frauen) zur »Liebessklavin« eines Drogenbarons wurde. Außer den Frauen halten sich die Drogenhändler auch Raubtiere. Der Kot von Tigern und Löwen hält Drogenspürhunde von der heißen Ware ab, wenn ein Transport kontrolliert wird. Denn »der Kot von Wildtieren roch nach Fleisch ... nach Menschenfleisch«, wie manche sagten.
Ihr schonungsloses Leben kann Ladydis Gefühle nicht ganz abtöten. Vor allem zwischen ihr und Maria bleibt ein zartes Band gegenseitiger Fürsorge und Anteilnahme. Maria leidet unter ihrer Gesichtsentstellung und wird nach Jahren operiert.
»Gebete für die Vermissten« schockt den Leser nicht selten mit ungeschönten Brutalitäten und grausamen Wahrheiten. Doch steht zu befürchten, dass die Realität wahrscheinlich noch unfassbar schrecklicher ist als das, was Jennifer Clement uns in ihrem Roman schildert. Er ist ein Appell an die Welt, endlich die Schreie der verzweifelten Menschen wahrzunehmen, die in Mexiko auf die Straßen gehen – bevor das Land zu einem großen Friedhof wird.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Winter 2014 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: