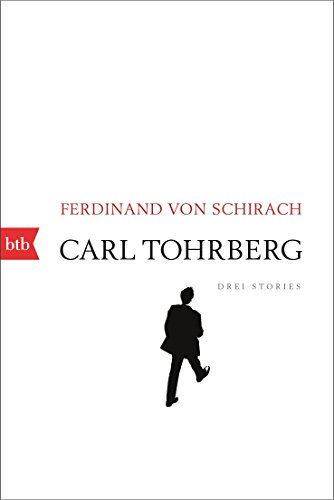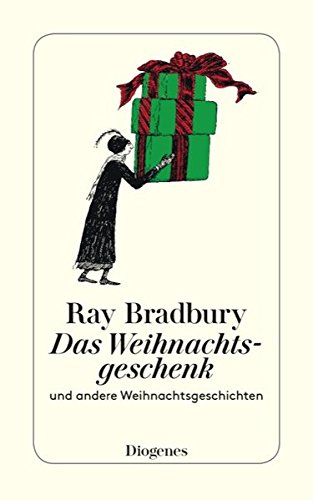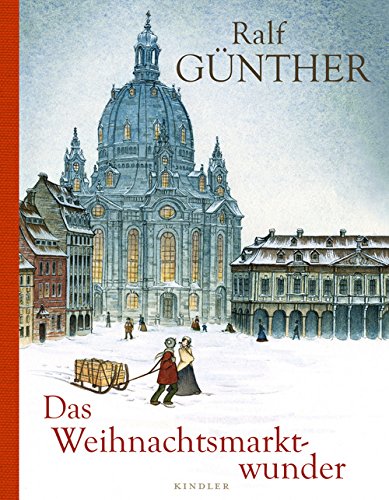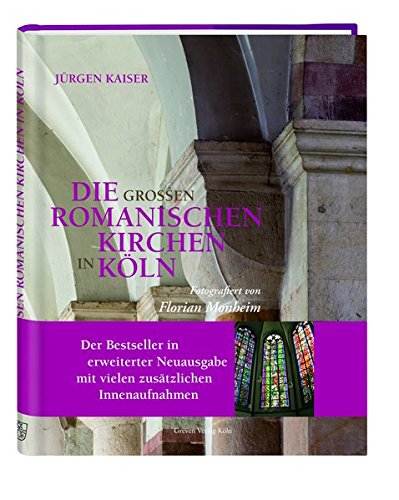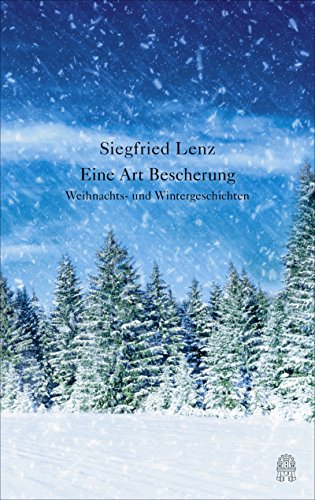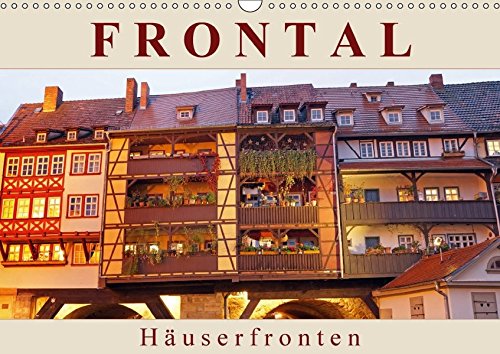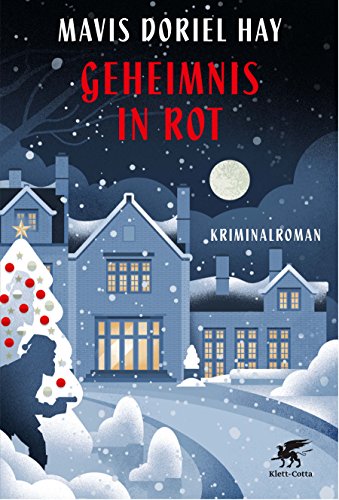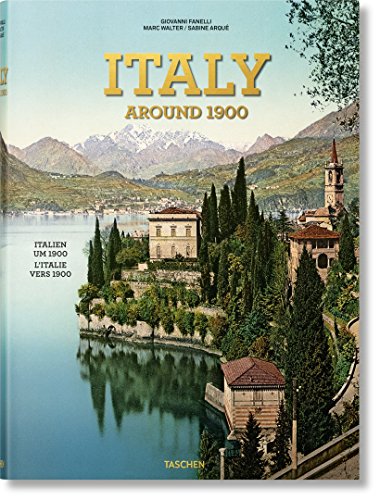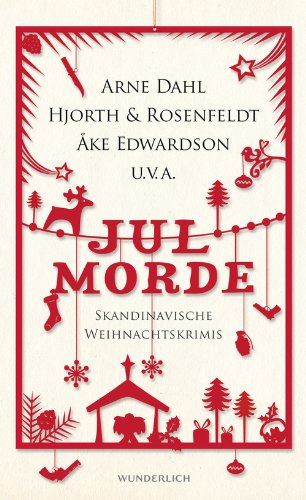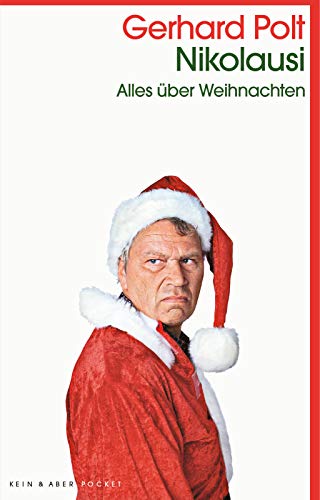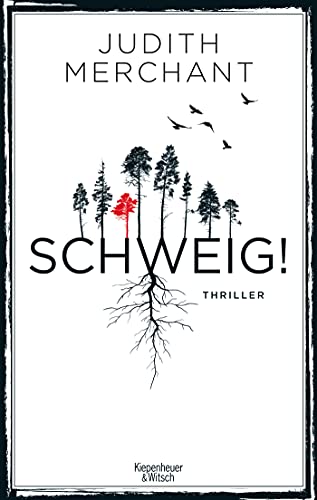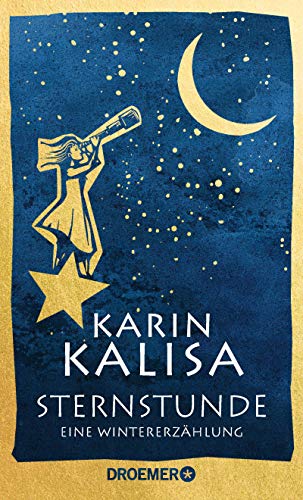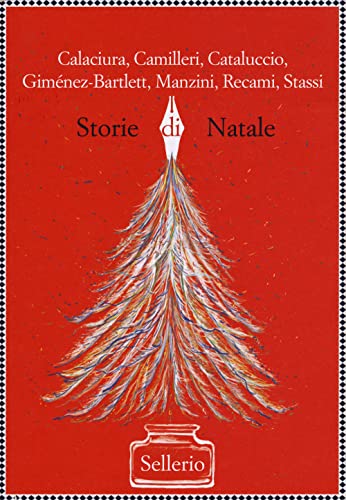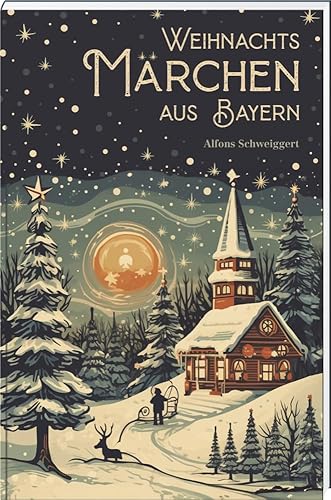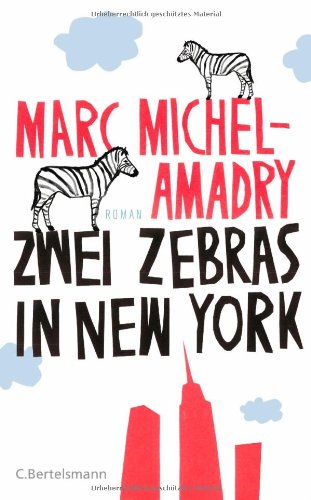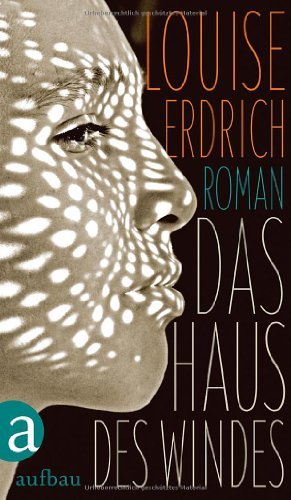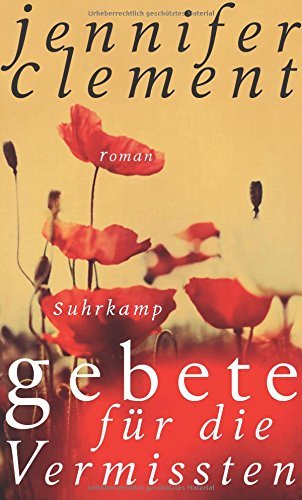Als Weihnachten noch Weihnachten war
Dass das Weihnachtsfest zur Konsumorgie verkommt, wird schon seit Jahrzehnten beklagt, und doch schreitet die Sinnentleerung ungebremst fort. Mit der Bereitstellung von Wunschzetteln beim Online-Versandhändler scheint ein absoluter Tiefpunkt erreicht: Der Beschenkt-werden-Wollende listet die Artikel auf, die er möchte, und wer sich zum Schenken verpflichtet fühlt, klickt das Objekt an, das er dem Wünscher gönnt. Verpackung und Versand: erledigt. Enttäuschung: weitgehend ausgeschlossen (ansonsten: Rücksendeschein liegt bei). Beteiligte Gefühle: keine. Zusammenhang mit Weihnachten: keiner.
Bücher und Musik-CDs für die Advents-
und Weihnachtszeit finden Sie hier.
Während die religiöse Bedeutung als Fest der Freude über Christi Geburt immer mehr in den Hintergrund geriet, wurde Weihnachten doch weiterhin als »Fest des Friedens und der Familie« verstanden und auch in ungläubigen Kreisen akzeptiert und gefeiert. Nun zeigt selbst dieser gesellschaftlich-kulturelle Konsens Auflösungserscheinungen: Kommerzialisierung, Trivialisierung, Individualisierung, Virtualisierung und Geschichtsvergessenheit nagen an der Substanz.
Dass hier offenbar nichts hinzugewonnen, sondern vielmehr Elementar-Menschliches verloren geht, mag man an der erstaunlichen Wirkung erkennen, die Erzählungen von Weihnachtsfeiern in früherer Zeit entfalten, als Glück noch nicht so platt mit Besitz verwechselt wurde und die Menschen noch enge persönliche Beziehungen miteinander pflegten, ob sie wollten oder nicht.
Solche Geschichten lesen wir in dem wunderbaren Büchlein »Weihnachtsmann – was nun?«, in dem der Aufbau-Verlag weihnachtliche Texte aus diversen Werken des bedeutenden, wenn auch ein wenig in Vergessenheit geratenen Autors Hans Fallada (1893-1947) zusammengestellt hat. Es handelt sich um Autobiografisches und Fiktionales, um Kindheitserinnerungen und Briefe, Romanauszüge und Kurzgeschichten aus der Berliner Zeitung »Tägliche Rundschau«, die er zwischen 1902 (ein handgeschriebener Wunschzettel) und 1946 verfasste. Pate für den Titel stand sein berühmtester Roman »Kleiner Mann – was nun?«  , dessen Titel zum geläufigen Bestandteil der Alltagssprache avancierte.
, dessen Titel zum geläufigen Bestandteil der Alltagssprache avancierte.
Hans Fallada (eigentlich Rudolf Ditzen) durchlebte schwere Zeiten, politisch, wirtschaftlich und persönlich. In der Schule ist er Außenseiter. Mit achtzehn duelliert er sich mit einem Freund – von beiden als Suizid intendiert, doch Fallada überlebt schwer verletzt und wird zeitweise in die Psychiatrie eingewiesen. Weil er nicht Jurist werden will, überwirft er sich mit seinem Vater, einem Richter. Für den Kriegsdienst ist er untauglich. Er verfällt Alkohol und Morphium, verbringt zwei Jahre in Entzugsanstalten und wird straffällig. 1928 heiratet er Anna Issel (»Suse«). Nachdem er sich mit schlecht bezahlten Gelegenheitsarbeiten durch die entbehrungsreichen Jahre des Krieges, der Inflation, der Massenarbeitslosigkeit und der Weltwirtschaftskrise geschlagen hatte, protegiert ihn um 1930 der Verleger Ernst Rowohlt und gibt ihm Arbeit in seinem Berliner Verlag; 1932 erscheint »Kleiner Mann – was nun?«, ein international beachteter Bestseller. Weitere Romane und Erzählungen folgen, bis er von den Nazis ins Abseits gestellt wird. 1944 wird die Ehe mit Anna, die vier Kinder geboren hatte, geschieden. Noch immer von der Sucht gequält, wird Fallada 1946 in die Nervenklinik der Berliner Charité aufgenommen und stirbt dort ein Jahr später an Herzversagen.
Was haben die Weihnachtsfeste eines solchen Lebens, solcher Zeiten mit unseren nach der Jahrtausendwende zu tun? Das muss man selbst erlesen, um es zu begreifen. Man wird äußerliche Ähnlichkeiten finden – und doch war alles anders. Vor allem war die Geste entscheidend, nicht der materielle Wert. Um Kinder- und erwachsene Augen glücklich erstrahlen zu lassen, genügte eine kleine geschmückte Fichte mit einer Geschichte.
Welche Rituale und Marotten in der gutbürgerlichen Familie des Landrichters Ditzen Jahr für Jahr gepflegt wurden, von der geheimnisumwitterten Beschaffung des Baums über die lange, spannungsgeladene, genussvolle Zeremonie der Beschenkung (Enttäuschungen über allzu Nützliches nicht ausgeschlossen) bis zum Festschmaus im Familienkreis am Feiertag, erfahren wir als eine Art Folie für das Kommende in der Eingangsgeschichte »Familienbräuche«.
Festschmaus, Baum und Geschenke waren selbst in der bittersten Not der späteren Jahre unverzichtbar. In der (fiktiven) Familie Pech trägt jedes Kind etwas zur Vorbereitung bei. Sohn Peter hat den Auftrag, ein Bäumchen zu besorgen, klettert über den Zaun einer Gärtnerei, um eins zu »organisieren«, und wird natürlich erwischt (»Weihnachten der Pechvögel«). In »Der parfümierte Tannenbaum«, einer Episode aus »Kleiner Mann – was nun?«, erwirbt der Protagonist Pinneberg ein winziges Bäumchen im Topf, auf dass es später eingepflanzt und mit Sohn »Murkel« groß werden möge. Doch es erweist sich als elender »Blender«, dem man alle Wurzeln abgehauen hat, und macht der jungen Familie auch sonst keine ungetrübte Freude.
Der strenge Vater Ditzen achtete pedantisch darauf, dass kein Kind bevorzugt, für jedes gleich viel Geld ausgegeben wird. Das eherne Gerechtigkeitsprinzip ist ihm jedoch wichtiger als die eigentlichen Bedürfnisse seiner Kinder, und indem er radikal für Ausgleich sorgt, führt er das Schenken ad absurdum und erntet nur Unverständnis. Denn dass Freude mit Geld zu tun haben solle, rief bei Ditzens Kindern noch Befremden hervor ...
Dass Geld das Schenken erleichtert, versteht sich hingegen von selbst. Wenn aber keins da ist? Das junge Ehepaar »Mumm« und »Itzenblitz« (Fallada?) entwickelt ein durchdachtes »System von Einzelkassen: Wirtschaftsgeld, Taschengeld, Mumms Geld, Kohlenfonds, Neuanschaffungskasse, Mietefonds und Weihnachtskasse« – viele Schachteln und Schächtelchen, in denen doch »meistens Ebbe herrschte« (»Fünfzig Mark und ein fröhliches Weihnachtsfest«). Nichtsdestoweniger beginnen die beiden schon im Sommer, ihre Wünsche aufzuschreiben, denn was wäre schlimmer, als in der »Hatz« der Weihnachtszeit Überflüssiges zu kaufen (»man schenkt sich womöglich etwas ganz Dummes, was man nachher nicht braucht«)? »Wünschen ist frei«, daher tragen sie nach warmen Hausschuhen und einem Buch auch einen »Vierröhrenradioapparat« und ein »bleuseidenes Abendkleid (ganz lang)« ein, wohl wissend, dass sie derlei Träumen über Jahre werden nachhängen müssen ...
Aus den vielen Weihnachtsgrüßen an seine Lieben erfahren wir von den beklemmenden Umständen, in denen die Menschen lebten (»Futtermittelkarten«, »Einheitsseife«, »fett- und fleischlose Suppen«). Doch man kommentiert sie mit Ironie und Galgenhumor; Lamentos und Schuldzuweisungen fehlen ganz; stattdessen schwingt immer ein optimistischer Ton mit (»auch für mich würde sich das Leben wieder lohnen«); der Dank für übersandte Weihnachtspakete klingt ebenso ehrlich wie die Wünsche, das Fest möge ein fröhliches werden. Tatsächlich spürt man, dass die Familie ein Hort der Wärme, aufrichtiger Zuneigung, wahren Mitgefühls und gegenseitiger Solidarität war, dessen man sich zu Weihnachten erfreute und versicherte. Davon zeugen noch Falladas letzte Briefe an seine Mutter und seine geschiedene Frau Suse, beide voller Anteilnahme und Fürsorge.
Dieses Buch schwelgt nicht in billiger Nostalgie. Schon die Sprache ist fern jeglicher Süße. Fallada gilt als Vertreter der »Neuen Sachlichkeit«; er beobachtet aus der Distanz, protokolliert nüchtern, formuliert unaffektiert, räsonniert illusionslos. Der Ton: humorvoll, melancholisch, nachdenklich, komisch, warmherzig, spritzig. Seine Ausdrucksweise ist oft schnoddrig (»knorke«, »das war verdammt knapp von wegen direkt drohendem Fest«, »eine Bohrung angelegt von wegen Weihnachtsgratifikation«) und klingt dadurch sehr modern. Genau deswegen kommen wir den erzählten Sachverhalten und Denkweisen aus historischer Zeit sehr nahe. Sollte die Vergangenheit uns anrühren, womöglich hier und da Wehmut auslösen, so wurde das nicht künstlich stimuliert.
Uns wird dann nur bewusst, was wir verloren haben.
 · Herkunft:
· Herkunft: