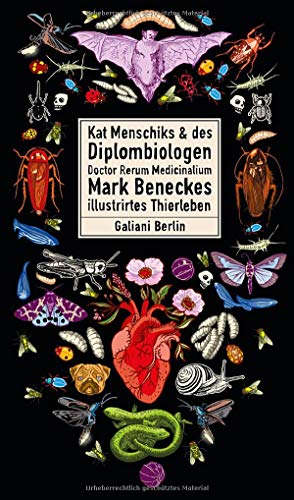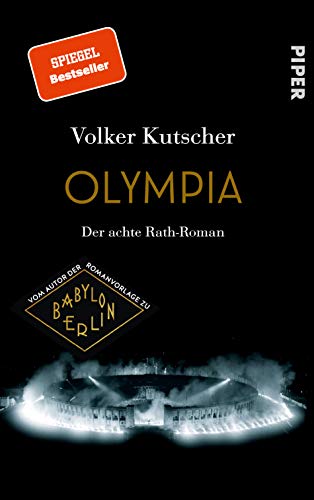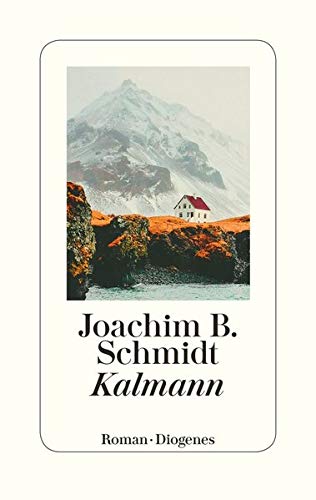
Kalmann
von Joachim B. Schmidt
Fast alle in seinem Dorf in der Abgeschiedenheit der isländischen Provinz unterschätzen Kalmann als harmlosen Naivling. Bis der Außenseiter dazu verhilft, einen rätselhaften Mord zu lösen.
Der Sheriff von Raufarhöfn
Die Halbinsel Melrakkaslétta, nur knapp zwei Kilometer vom Polarkreis entfernt, ist so ziemlich die nördlichste Region Islands. Sie ist nicht nur weitab vom Schuss, sondern auch gebeutelt von den Wirtschaftskrisen der Welt und ein Opfer der Reglementierung der Fischfangquoten. Dort liegt die 173-Seelen-Gemeinde Raufarhöfn, der niemand eine Zukunft prophezeien mag und wo der Protagonist eines bemerkenswert warmherzigen, originellen Kriminalromans agiert. Kalmann Óðinnson, 33, etwas unförmig und ein wenig langsam im Kopf, zu seinem Leidwesen immer noch alleinstehend, ist ein Einzelgänger, der lieber mit den Tieren redet. Menschen können ihn bisweilen in Rage versetzen. Dann lässt er seine Wut aber eher an sich selber aus, oder er malträtiert die Gegenstände im Haus. Als Ich-Erzähler gibt er uns einen naiven, geradezu kindlichen Blick auf sein moribundes Dorf und seinen persönlichen Alltag, auf die Welt im Kleinen und im Großen, und alles wirkt recht schlicht. Kalmann ist ein Stiller und gibt nur wenige Worte von sich, aber er hat einen eigenwilligen Spürsinn, der ihn wohl befähigt, genau das wahrzunehmen, was andere nicht sehen. Das plaudert der harmlose Erzähler dann ganz spontan und arglos aus – und handelt sich damit bisweilen Kalamitäten ein.
Die Raufarhöfner nehmen den Sonderling, wie er ist, als liebenswerten Dorftrottel mit ein paar Macken. Die augenfälligste darunter ist eine ungewöhnliche Kostümierung, die niemand weiter beachten oder bereden würde, wären wir in Texas. Aber hier in der polarnahen Provinz würden »Cowboyhut, Sheriffstern und Mauser« (eine Knarre Modell C96) jeden Fremden stutzig machen (wenn sich denn jemals einer hierher verirren würde). Für Kalmann ist das volle Outfit eine Schutzausrüstung, die ihn zum wahren Mann macht. Stilecht sagt er »Okidoki« und tippt dabei leicht an die Krempe seines Cowboyhuts, wenn er durchs Dorf zu seinem Boot läuft, um mal wieder draußen auf dem Meer Haifische zu angeln.
Die Western-Marotte ist vom Erbe seines leiblichen Vaters übrig geblieben. Quentin Boatwright war auf der US-Militärbasis Keflavík stationiert und hatte eine außereheliche Affäre mit Kalmanns Mutter, die dort eine Zeitlang als Sekretärin jobbte. Kurz bevor er neun Jahre später samt Ehefrau und ehelichem Kind nach Amerika zurückbeordert wurde, bestand er darauf, seinem Sohn ein »Erbstück« zu hinterlassen: eine Kiste mit Zigaretten, Kaugummi, Schokolade, Militärkleidung und dem besagten Ensemble aus Cowboyhut, Sheriffstern und Mauser C96. Letztere stamme von seinem Vater, »der im Koreakrieg gekämpft und nur knapp überlebt habe«. Zwar wollte Mutter nichts von alledem, »schon gar keine Waffen«, doch die letzten Worte seines »Samenspenders« hat Kalmann bis heute nicht vergessen: »I want him to fucking have it!«
In ihren jungen Jahren hat Kalmanns Mama gewiss ihr Bestes gegeben, um ihr geliebtes Söhnchen, das etwas anders als die anderen tickte, zu erziehen. Wirklich Zeit hatte sie aber nie für ihn. Sie war unverheiratet, musste Geld verdienen, arbeitete nach der Keflavik-Zeit in einer Fischfabrik. Nach dem Tod ihrer Mutter zog sie mit ihrem Kleinkind zu dessen Großvater, der verständnisvoll die Rolle des Ersatzvaters übernahm. Er machte nicht nur den besten Gammelhai (das fermentierte Fleisch des Grönlandhais), sondern gab dem Enkel alles mit, »was man eben braucht, um zu überleben«. Dazu gehörte auch ein Gewehr nebst Schießübungen (die bei Nachbars Katze zu einem unerwarteten Lebensende und bei Mutter zu einen Tobsuchtsanfall führten). Im Übrigen steht sich der tollpatschige, vergessliche Kalmann jedoch sowohl im Gelände als auch auf dem Meer selbst im Wege »wie der hinterletzte Trottel«, so dass »die Schneehühner aufgeschreckt davonflatterten [und] die Polarfüchse das Weite suchten, bevor wir sie überhaupt erspäht hatten«.
Bis zum Alter von vierzehn Jahren besucht der Junge die Schule. Aber weder am Lernen noch an seinen Klassenkameraden findet er Gefallen. In der Verbannung auf der hintersten Schulbank fristet er seine Tage allein, und der Platz neben ihm wird nur gelegentlich und notgedrungen mit Übeltätern besetzt. Selbst mit zugehaltener Nase können die Strafversetzten die Ausdünstungen kaum ertragen, die von Kalmanns Pausenproviant (einer Dose mit klebrigem Gammelhai) ausgeht. Im Sportunterricht lachen die Kumpanen und rufen: »Run, Forrest, run!«. Zwar kennt Kalmann den gehandicapten Filmhelden, aber anders als der kann er weder schnell laufen noch Pingpong spielen.
Viele Jahre später ist der geliebte Großvater immer noch die einzige Person, der sich Kalmann offenbaren kann. Doch er lebt jetzt im Altenheim und ist nicht mehr Herr seines Gehirns. Die Vergangenheit hat er vergessen, er ist misstrauisch und barsch, erkennt den Enkel nicht mehr richtig. So hat es wenig Sinn, ihm die Sache mit Róbert McKenzie, dem »Quotenkönig« des Fischfangs, zu berichten, ein Erlebnis, das den »Anfang vom Ende« bedeutet. Die Mutter lebt zu weit weg und ist obendrein mit ihrem Job als Krankenschwester voll ausgelastet. Und würde sie verstehen, was ihr Sohn ihr anvertraut? Auch Nói, sein bester Freund, mit dem er per Internet kommuniziert, wohnt weit weg. Der neunzehnjährige Computernerd aus der über 600 km entfernten Hauptstadt Reykjavík ist ein Genie und insofern »mein Gegenstück … wenn wir beide eine Person wären, wären wir unschlagbar«.
So fühlt sich Kalmann ganz allein gelassen mit dem ganzen Schlamassel. Warum musste er auch ausgerechnet an jenem Tag auf Jagd gehen? Der Spur eines Polarfuchses folgend fand er auf einmal Blut – verwirrend viel Blut, als habe hier ein gefährlicher Eisbär gewütet. Das ist zwar in Island ein selten gesehenes Tier, aber Kalmann kennt nun mal nur seine eigene Sicht und teilt sie allen mit, der Polizei, den Fernsehleuten und damit sämtlichen Haushalten Islands. Schnell machen die kühnsten Mutmaßungen die Runde: Róbert McKenzie, der reiche Big Boss eines Hotel- und Fischereiunternehmens, ist wie vom Erdboden verschwunden. Hat er Selbstmord begangen, weil seiner Firma die Pleite droht? Oder haben ihn seine litauischen Angestellten umgebracht? Oder die gut organisierten Drogenschieber, die ihre in Tonnen versteckte Ware an Bojen vertäuen?
Der Autor dieses literarischen Schneekristalls aus einer uns kaum bekannten Region am Ende der Welt heißt Joachim B. (Beat) Schmidt, wurde 1981 in der Schweiz geboren und lebt und arbeitet als Touristenführer in Reykjavík. »Kalmann« ist bereits sein vierter Roman. Mit zartem Feingefühl zeichnet der Autor seinen kauzigen Protagonisten und ungewöhnlichen Ich-Erzähler. Da der stets etwas neben der Spur läuft, entwickelt sich eine skurrile Handlung. Während alle im Dunkeln tappen und Kalmanns absurd erscheinenden Hinweis auf einen Eisbären belächeln, nimmt die sympathische, ruhige Kommissarin Birna den vermeintlichen Spinner ernst und baut ein Vertrauensverhältnis zu ihm auf. Das fulminante Ende erweist (so viel sei verraten), dass sie den richtigen Weg beschritten hat, und Kalmann wird – wer hätte das je gedacht? – zum gefeierten Helden.
Dieses Buch habe ich in die Liste meiner 20 Lieblingsbücher im Winter 2020 aufgenommen.
 · Herkunft:
· Herkunft: