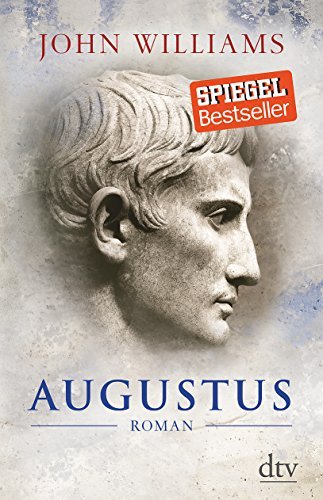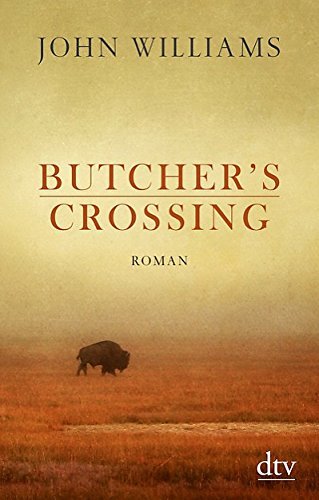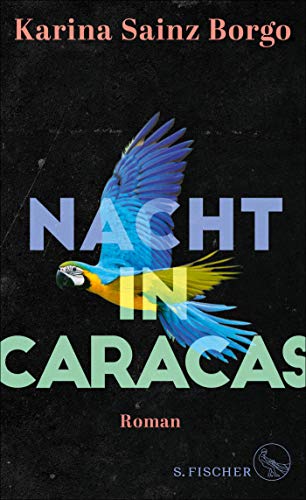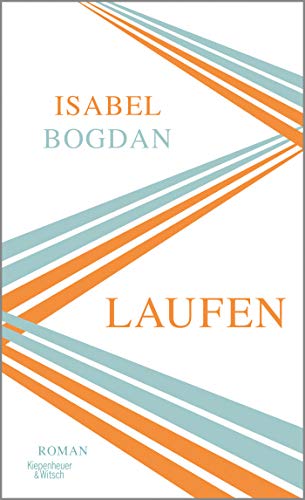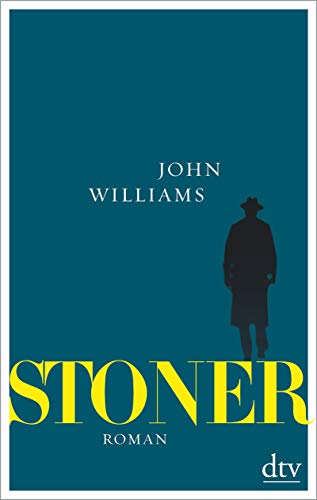
Stoner
von John Williams
William Stoner wandelt sich vom armen Farmerjungen zum engagierten, sensiblen Literaturprofessor. Doch er ist kein Genie, kein Erfolgsmensch und keine Kämpfernatur. Gegen seine Widersacher und das Schicksal verliert er. Seine Stärke ist, alles zu ertragen.
Das Leben nehmen, wie es ist
William Stoner, von dem John Williams in seinem erst postum gefeierten Roman erzählt, wird 1891 als einziges Kind armer Farmer in Missouri geboren. Kaum dass er laufen kann, müssen seine kleinen Hände in Haus und Hof mit zupacken. Das harte, entbehrungsreiche Dasein der Familie prägt seinen Charakter frühzeitig und nachhaltig.
Obwohl die Eltern davon ausgehen, dass William sein Leben ebenfalls auf der Farm verbringen wird, darf er nach seinem Highschoolabschluss 1910 die University of Missouri besuchen, um Landwirtschaft zu studieren. Nebenbei belegt er einen Einführungskurs in englischer Literatur, und hier wächst seine wahre Leidenschaft. Die Rückkehr in eine karge, rustikale Existenz auf dem elterlichen Stück Land erscheint ihm bald undenkbar. Der Vater, von der Arbeit gebeugt und vorzeitig gealtert, billigt die Entscheidung seines Sohnes. Fortan wird William seine Eltern nur noch gelegentlich besuchen und das Anwesen nach deren Tod verkaufen.
Die Erzählung konzentriert sich nach dieser Vorstellung der Ausgangssituation räumlich, inhaltlich und thematisch auf den universitären Bereich. Wir bleiben mit dem Protagonisten dem Campus-Geschehen, den Studenten, den Dozenten, den Gegenständen der Seminare verbunden. Der strebsame, nicht sonderlich kontaktfreudige Student macht seinen Abschluss als Magister der Literaturwissenschaft, wird Assistenzprofessor und bleibt auf dieser akademischen Stufe bis zu seinem Lebensende.
Im Jahr 1919 heiratet er seine große Liebe Edith Bostwick, eine Tochter aus gutem Hause. Doch die Beziehung schlägt in tiefe Enttäuschung um. Wie alle anderen Schicksalsschläge, die William noch treffen werden, erträgt er sie mit Gleichmut, seinem zentralen Wesensmerkmal.
1932 erlebt William eine kurze Phase intensiven, leidenschaftlichen Glücks mit der Doktorandin Katherine Driscoll. Zwar erträgt seine frustrierte Ehefrau, um ihren Status und die Fassade zu wahren, seine Affäre mit der wesentlich jüngeren Frau, doch es ist die Universität, die ihn zu einer Lösung drängt, damit ihr guter Ruf keinen Schaden nimmt. Während William bereit wäre, seine Ehe für Katherine aufzugeben, hat diese längst selbst eine Entscheidung getroffen und die Universität verlassen.
Nun konzentriert sich William in einer Art Rückzug ganz auf seine Lehrtätigkeit. Mit Hingabe müht er sich, die Studenten für Literatur zu begeistern. Doch nicht jeder schätzt den kauzigen Dozenten, den seine zunehmende Schwerhörigkeit belastet und der schnell altert.
Auch mit seinen Kollegen hat William manche Schlacht zu schlagen. Insbesondere Hollis N. Lomax, später Leiter der Fakultät, entwickelt sich zu einem hartnäckigen Widersacher über Jahre hinweg. Er unterstellt William menschlich schäbige Grundhaltungen, schiebt ihn an den Rand des akademischen Betriebes ab und möchte ihn frühzeitig in den Ruhestand versetzen – für den engagierten Lehrer William eine undenkbare Option. Als bei ihm Krebs diagnostiziert wird, muss er seine Berufstätigkeit aufgeben. Die Bilanz seines Lebens schätzt er realistisch ein: Er hat wenig erreicht, ihm ist nicht viel geglückt, sein Ansehen ist durchwachsen, doch er ist sich treu geblieben.
William Stoners Wesen erklärt sich aus den einfachen und mitleidlosen Umständen, in denen er groß wurde und aus denen er sich in höhere geistige und ästhetische Sphären emporarbeitete. Der nackte Überlebenskampf bestimmte das Farmleben, und es blieb keinerlei Raum, um elterliche Liebe als wärmendes Gefühl spüren zu lassen, geschweige denn über abstrakte Ideale und Kunst zu reflektieren. Simpler Pragmatismus – die Zufälle des Lebens nehmen, wie sie kommen, aus jeder Situation das Beste machen – bestimmt auch Williams Weg durch seinen privaten Dschungel als strebsamer Studierender, als friedliebender Mensch, der, anders als seine beiden Freunde, nicht freiwillig in den Krieg zieht, als Kollege, der einen schweren Stand hat.
Stoners Haltung zwischen Geduld, Gelassenheit, Langmut, Besonnenheit und Stoizismus verwundert besonders in seiner Beziehung zu der Frau, die er aus tief empfundener Liebe heiratet und die ihn sehr schnell aller Erwartungen beraubt. Edith Bostwick ist eine diffizile, disparate, chamäleonartige Figur. Mag der Leser ihre anfängliche körperliche Verweigerung als Resultat einer prüden Erziehung als behütetes Einzelkind begreifen, so wird er (ebenso wenig wie ihr Ehemann) nachvollziehen können, wie sich diese Frau dann im Verlauf ihrer Ehe entwickelt. Unablässig verändert sie sich, schlagen ihre Verhaltensweisen ins jeweilige Gegenteil um. William lässt sich jedoch zu keinem Kleinkrieg hinreißen. Während Edith sich allen Tätigkeiten im Haus entzieht, lädt er sich alle Aufgaben auf. Ihr einziges gemeinsames Kind zieht er groß, bis Edith ihm aus einer Laune heraus jeden Kontakt zur Tochter nimmt.
Der Protagonist zeigt manche biographische Züge seines Autors John Edward Williams (1922-1994), der an der University of Denver Literatur und kreatives Schreiben lehrte und neben Lyrik vier sehr unterschiedliche Romane verfasste, die alle zu seinen Lebzeiten weitgehend unbeachtet blieben. Nach »Nothing But the Night«, einer deprimierenden psychologischen Studie (1948), und dem Western »Butcher’s Crossing« (1960) erschien »Stoner«  (1965), der nur etwa zweitausend Käufer fand, und schließlich der historische Briefroman »Augustus« (1973), der zwar den National Book Award erhielt, aber auch kein Verkaufserfolg wurde.
(1965), der nur etwa zweitausend Käufer fand, und schließlich der historische Briefroman »Augustus« (1973), der zwar den National Book Award erhielt, aber auch kein Verkaufserfolg wurde.
Nach seinem Tod geriet der Autor mitsamt seinem literarischen Werk vollends in Vergessenheit, bis der Literaturkritiker Morris Dickstein 2007 in der New York Times befand, »Stoner« sei »a perfect novel«. Das löste eine Welle europäischer Übersetzungen aus, ins Deutsche durch Bernhard Robben für den Deutschen Taschenbuch Verlag. Die Erstausgabe von 2013 wurde 2019 neu aufgelegt und mit Aufsätzen von Alan Prendergast, Charles J. Shields und Bernhard Robben sowie einer Zeittafel zu »John Williams – Leben und Werk« bis ins Jahr 2013 ergänzt.
Unzählige internationale Rezensenten haben »Stoner« besprochen und gewürdigt. Meine eigenen Erwartungen an den Roman orientierten sich an den zuvor gelesenen, »Butcher’s Crossing« [› Rezension] und »Augustus« [› Rezension], was eine gewisse Ernüchterung zur Folge hatte. Denn »Stoner« erzeugt eine ganz andersartige, abstraktere Leseerfahrung. Statt Spannung und Western-Abenteuer des Ersteren und der geradezu zärtlichen Annäherung an die beeindruckende Persönlichkeit des ersten römischen Kaisers im Letzteren bietet »Stoner« eine geradlinige, chronologische Handlung voller tragischer Schicksalsschläge über das traurig stimmende Leben eines Universitätsdozenten. Literarisch interessierte und bewanderte Leser werden auf vielen Seiten aufschlussreiche und befriedigende Einsichten entdecken – so wie Stoner in einer Unterrichtsstunde als junger Student erfuhr, was Literatur ist: »die Epiphanie, durch Worte etwas zu erkennen, was sich in Worte nicht fassen ließ«. Andere Leser werden mit eben diesen anspruchsvollen, fachkundig eingewobenen Inhalten nicht viel anfangen können oder wollen.
Im Fazit mag ich mich den teils überschwänglichen Lobeshymnen nicht ohne Einschränkungen anschließen, wenn ich die akademischen Ebenen außen vor lasse und die Erwartung eines sprachlich-stilistisch außergewöhnlichen Leseerlebnisses und eines packend gestalteten Handlungsablaufs in den Vordergrund stelle. Da gibt es bemerkenswerte, vielschichtige Szenen, die unter die Haut gehen, wie etwa die Auseinandersetzung um einen körperlich leicht behinderten Studenten des Abschlussjahres. Hollis N. Lomax, Stoners kleinwüchsiger, missgestalteter Vorgesetzter, preist die herausragende Begabung des jungen Mannes, doch der hatte Stoners Seminarstunde immer wieder besserwisserisch unterbrochen und seinen Lehrer bloßgestellt.
Die Begeisterung für die zarte, leise, einfühlende und subtil beschreibende Sprache, die der Figur des William Stoner zutiefst entspricht, teile ich. Aber der erwartete nachhaltige Funke hat mich nicht erreicht.
 · Herkunft:
· Herkunft: