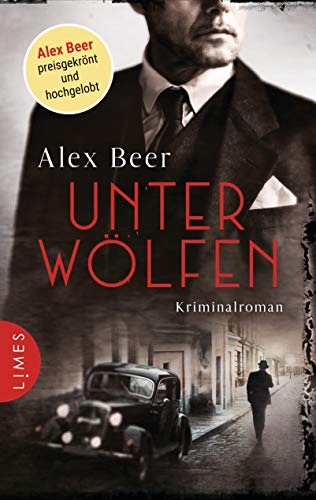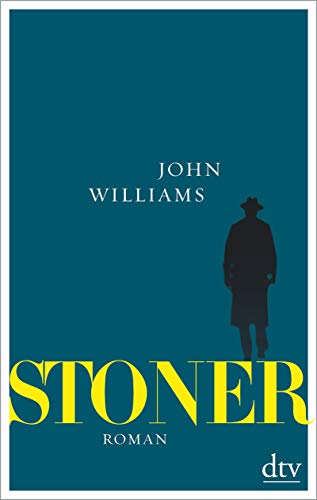Nacht in Caracas
von Karina Sainz Borgo
Die meisten Bürger darben in Armut. Banden marodieren. Niemand schafft Ordnung. Jeder ist sich selbst der Nächste. So stellt man sich das Leben in der Hölle vor. Dabei ist es das erdölreichste Land des Planeten.
Leben in der Hölle
Venezuela, im Norden des südamerikanischen Kontinents gelegen, gehört zu den reichsten Nationen der Erde. Denn nirgendwo in der Welt wurde mehr Erdöl nachgewiesen als hier. Der natürliche Schatz ist allerdings zum Fluch geronnen, wie dies auch anderen Ölstaaten widerfuhr. Die Quellen sprudeln, aber die Einnahmen versickern im Einflussbereich einer Clique von Politikern, Bossen und Firmen, während weit über die Hälfte der Bevölkerung paradoxerweise in Armut vegetiert und die Ordnung sich auflöst. Die wechselnden Führungen des Landes, häufiger Diktatoren als Demokraten, oft durch Putsche oder Revolutionen an die Macht gelangt, konnten ihre Pfründe über Jahre und Jahrzehnte sichern, während das Land durch krasse Misswirtschaft, Korruption, Inflation, Auslandsschulden und die Abhängigkeit vom Öl als einzigem Wirtschaftszweig verfiel und verelendete. Benzin gab es im Überfluss und nahezu gratis, Nahrungsmittel und sauberes Wasser nur als überteuerte Mangelware.
Die venezolanische Autorin Karina Sainz Borgo, 1982 in Caracas geboren und mit 25 Jahren nach Spanien emigriert, schildert in ihrem Debütroman (den Susanne Lange übersetzt hat) Eindrücke und Ereignisse vom Leben in ihrem Heimatland. Sie erzählt eine kaum zu ertragende Realität, einen düsteren Weg durch Sozialismus und Militärdiktatur, Mangel und Machtlosigkeit, Gewalt und Chaos. Die Ich-Erzählerin, die uns all dies vermittelt, ist Adelaida Falcón, die als Seelenverwandte der in etwa gleichaltrigen Autorin verstanden werden kann. Voller Hass und Abscheu – beides mehr als nachvollziehbar – beschreibt sie die politisch herbeigeführten Zustände eines ganzen Landes, das trotz seiner natürlichen Segnungen im Elend versinkt.
Die Familie Falcón stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe des Meeres. Adelaidas Großtanten, inzwischen achtzig Jahre alte Zwillinge, betreiben dort eine Pension, obwohl sie längst heruntergewirtschaftet ist und sie kaum noch ernähren kann. Adelaidas Mutter verließ den Ort frühzeitig, um in Caracas Pädagogik zu studieren. Als Erste in der Familie erreichte sie einen akademischen Abschluss. Als sie schwanger wurde, nahm der Kindesvater, wie es geradezu üblich ist, umgehend Reißaus. Mit Nachhilfestunden brachte die Mutter sich und ihr Kind in der Hauptstadt über die Runden. All die Jahre blieben die beiden eine einander genügende, wenn auch nicht immer problemlos funktionierende Einheit. Ab und zu besuchten sie das armselige Dorf und die Tanten.
Der Roman beginnt mit der tristen Beerdigung der an Krebs gestorbenen Mutter. Adelaida (die für einen Verlag arbeitet) sinniert, wie sich »der Tod als Erstes in der Sprache vollzieht«. Die Verbform des Präteritums vermag »die Personen aus der Gegenwart zu reißen und in die Vergangenheit zu pflanzen. Sie in abgeschlossene Handlungen zu verwandeln. In Dinge, die in einer erloschenen Zeit begannen und endeten«. So wird ihr die Endgültigkeit bewusst, mit der sie nun alleine und auf sich gestellt bleiben wird. Damit ist der deprimierend triste, lakonische Grundton des Abgesangs gesetzt.
Die Tanten erscheinen nicht zur Trauerfeier. Aber überall begegnen Adelaida Spuren ihrer unbeschwerten, abenteuerlichen Kindheit in den Achtzigerjahren, die nicht anders verliefen als die hundert Jahre davor. Wie leuchtend aufblinkende Punkte werden die Erinnerungen sie durch die immer finsterer und bedrohlicher werdende Gegenwart der Handlung begleiten. Die zarte, in ihren Augen mickrige, viel zu dürre Nichte war das Ein und Alles der Tanten. Sie sorgten und kümmerten sich und kommentierten unentwegt ihr Wohl und Wehe. »Iss nur«, tönte es beständig. Dabei war es dem Mädchen schon zum Frühstück schlecht: »knusprig gebratene Schweineschwarten«, Gemüse, dazu »Kaffee mit Zuckerrohrsaft und Zimt«, gefiltert durch einen Strumpf.
Für Idylle und Zuneigung ist in Adelaidas brutaler Gegenwart kein Raum mehr. Allenthalben muss man gewärtig sein, von marodierenden Banden verprügelt, misshandelt, eingesperrt zu werden. Viele von ihnen halten ein ideologisches Deckmäntelchen hoch, schlagen aber grausam und willkürlich zu. Die »Hijos de la Revolución« « haben demonstrierende Studenten verschleppt und rücken nicht einmal gegen Bezahlung damit heraus wohin. Besonders berüchtigt sind die »Motorizados de la Patria« «. Ehemals eine Schutztruppe des Revolutionsführers (»Comandante Presidente«), sind diese Motorradmänner in roten T-Shirts längst außer Kontrolle geraten und kassieren, quasi mit einem Freifahrtschein ausgestattet, Maut, plündern, brechen ein, freveln und töten nach Belieben, und »jeder, der Lust zum Töten und Sterben hatte, konnte sich bei ihnen einschreiben«. Selbst auf dem Friedhof veranstalten sie und ihre vor ordinärem Selbstbewusstsein strotzenden Begleiterinnen einen barbarischen, vulgären, gottlosen Totentanz, eine »Art Hexensabbat«. Adelaida macht ihre eigenen bitteren Erfahrungen mit den sadistischen Frauen.
Die Autorin betont die Fiktionalität ihrer Erzählung. Fakten und Figuren der Realität, an die sie angelehnt ist, »lösen sich von der Wirklichkeit«, denn ihre »Absicht ist eine literarische, keine dokumentarische«. Es geht ihr um die Darstellung dessen, was wir Mitteleuropäer uns kaum vorstellen können: wie das Leben in einer Gesellschaft vonstatten gehen kann, in der jegliche Ordnung aufgehoben scheint, Gesetze ihre Gültigkeit und die Menschen jeden Halt und jede Orientierung verloren haben. Die Vielfalt der Nöte des Alltags ist unüberschaubar: Hunger, Armut, Schwarzmarkt, Stromausfälle, Gewalt, Angst, Kriminalität, Terror, Hyperinflation bis zur völligen Entwertung des Geldes (»eine Serviette war wertvoller als einer der Hunderter, die auf dem Gehweg wie ein Menetekel brannten«). Wo jeder jeden fürchten muss, ist sich jeder selbst der Nächste, schnüffelt mit »Rattenäuglein […], ob der Nachbar etwas hatte, was knapp geworden war«, und so »reduzierte sich […] das Leben: auf die Jagd gehen und lebendig zurückkehren«. Derlei schmerzvolle Erlebnisse und ihre verheerenden Auswirkungen auf das Seelenleben der Protagonistin und ihrer Mitbürger schildert Karina Sainz Borgo mit einer Mischung aus drastischem Realismus und bisweilen poetisch anmutender Bildlichkeit, die unter die Haut geht.
Wie kann man in solch einem desaströsen, zerrissenen, dahindarbenden Land ohne Ordnung und Perspektive (über-) leben? Was Karina Sainz Borgo in ihrem hochgelobten, sprachlich außergewöhnlichen und in mehr als zwanzig Sprachen übersetzten Roman ausmalt, lässt keinerlei Hoffnung erkennen. Das Bild bestimmen verrohte, empathielose Menschen, vordergründige Gewaltszenen, erbärmliche Lebensbedingungen, hohle Fassaden im »Reservat einer kosmetischen Republik«. In der »zusammengewürfelten Gesellschaft, in der alle ihre Zambos und Schwarzen im Blut hatten«, scheinen alle Werte und jeder Zusammenhalt über die Grenze der Kernfamilie hinaus aufgelöst.
Auch die Ich-Erzählerin ist keine Heldin. Auch sie verschanzt sich gegen das feindliche Draußen, schämt sich ihrer feigen Verweigerung, eine Petition zur Freilassung der Demonstranten zu unterschreiben, schweigt lieber, als den Tod zu riskieren. Allein und mutlos zieht sie sich in die innere Emigration zurück. Durch einen makabren Glücksfall, den sie kühn beim Schopfe packt, gelingt es Adelaida, sich auf gewagte Weise aus dem Lande zu befreien. Sie nimmt die Identität einer verstorbenen Nachbarin an, einer gebürtigen Spanierin (darauf verweist der Originaltitel »La hija de la española« «  ), und riskiert mit deren Pass die Flucht. Dem Grauen der Hölle entkommen zu sein löst kein triumphales Hochgefühl aus, sondern Verzweiflung: »An dem Tag wurde ich von mir selbst entbunden. Mit zusammengepressten Zähnen brachte ich mich zur Welt, ohne Blick zurück.«
), und riskiert mit deren Pass die Flucht. Dem Grauen der Hölle entkommen zu sein löst kein triumphales Hochgefühl aus, sondern Verzweiflung: »An dem Tag wurde ich von mir selbst entbunden. Mit zusammengepressten Zähnen brachte ich mich zur Welt, ohne Blick zurück.«
 · Herkunft:
· Herkunft: