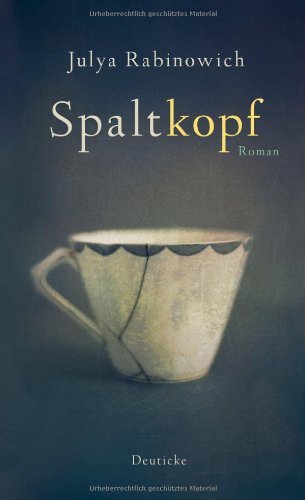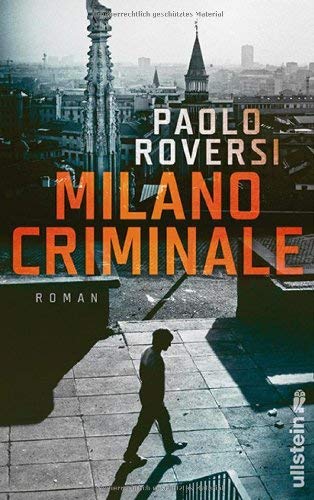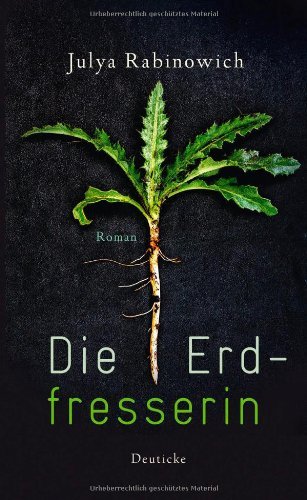
Unterwegs mit zu viel Gepäck
Es muss einmal eine gute Zeit gegeben haben für Diana, ihre Schwester und ihre Mutter. Als sie ein Kind war, lebten sie in einem steinernen Haus, dem größten und schönsten ihres russischen Dorfes, und sie »hatten Geld«. Der Vater war ein belesener Mann, seine Bibliothek bestens ausgestattet, viele Bücher dicht annotiert, und diese Schatzkammer war so geräumig, dass die Kinder darin Roller fahren konnten. Doch eines Tages verließ er die Familie, und seitdem gefror die Mutter zu einem gefühlskalten Eisklotz. Unbeirrbar lebte sie fort in der Gewissheit seiner Wiederkehr. »Die Türschwelle wusch sie jeden Tag, damit sie für Vater sauber und frisch blieb, damit er, wenn er zurückkehrte, ein gemütliches Zuhause vorfand, das all die Jahre nur auf seine Rückkehr gewartet hatte.«
Dianas Erinnerung an ihn ist verblasst zu einem Geruch und einem wohligen Gefühl: »Eine warme, große Brust, an der mein Hinterkopf lehnte, eine nach Tabak riechende Pfeife mit schwarzem Griff und gelblichem Mundstück.« Dass er seine Lieblingspfeife zurückgelassen hat, trägt zu Mutters Hoffnung bei.
Dann verschlechtern sich die Verhältnisse in der Sowjetunion. Es mangelt an Arbeit und Einkommen. Für Lebensmittel und die nötigsten Dingen des Alltags versetzt Mutter ihren Schmuck. Diana hat inzwischen anderswo Theaterwissenschaft studiert und einen Sohn geboren (von dessen Vater wir nichts erfahren); das Kind ist geistig behindert, neigt zu Gewaltausbrüchen und benötigt teure Medizin. Um für die Familie Geld zu beschaffen, ist auch Diana initiativ, als Grenzgängerin. Des Nachts nutzt sie geheime Schleichpfade gen Westen, kehrt dann mit ihrem Verdienst wieder zurück zur Familie, schlägt sich durch bis Wien, arbeitet als Prostituierte auf der Straße oder in »Slavkos Bar«.
Doch es ist nicht nur die Not, die sie zur Emigration treibt. Da sind auch das gestörte Verhältnis zu ihrer Mutter, die in ihren Zwängen gefangen lebt, und die Enttäuschung durch den Verlust des Vaters, an den sie sich in vielen Situationen und Begegnungen erinnern wird; letztendlich drängt sie ihr eigenes Identitätsproblem fort: »In jedem Mann finde ich den Vater und suche doch das Kind.« Doch weder von der Mutter noch vom Vater wird sie sich je befreien können; sie wird niemals ihres Schicksals Herrin.
Bei einer Razzia in Wien wird sie als Illegale aufgegriffen. Dabei lernt sie den Polizisten Leopold Brandstegl kennen, etwa zwei Jahrzehnte älter als sie und vereinsamt; er gewährt ihr Unterschlupf und lässt sich im Gegenzug rundum von ihr versorgen. Immerhin genießt sie, die stets von ihrer Verantwortung für ihre Angehörigen zu Hause Getriebene, bei ihm einmal die Ruhe einer gesicherten Existenz; jedoch nur für wenige Monate. Denn Leo ist schwer krank und stirbt bald.
Zuvor erfährt sie per Zufall noch, wie wenig sie ihm bedeutete. Das bestärkt sie in ihrer illusionslosen Haltung Männern gegenüber: der Vater abgehauen, die Freier nichts als zahlende Kundschaft, der Sohn missraten, und nun »der dumme Leo mit seiner kleinen Welt rund um sein stinkendes Bett.« Sie beschließt: »Keiner soll sich je an meine Fersen heften können, nie wieder soll mir jemand so nahe kommen.«
Mit der Enttäuschung über Leo scheint Diana den Boden unter den Füßen zu verlieren. Bei ihrem ersten Besuch an seinem Grab, »seinem neuen Zuhause«, übermannt sie eine tiefe Sehnsucht und brennende Leidenschaft, die sie zur Erde des Grabes hinab, in sie hinein zieht. Ihr Kopf senkt sich, sie berührt erst, riecht dann, empfindet ihre Wahrnehmungen als »tröstlich«, »beruhigend«, wühlt im Erdreich, »die Schwerkraft verdreifacht sich ohne Vorwarnung und reißt mich hinab zu Leos Grab … ich würge … spucke … lecke … verschlinge große Stücke aus dem von mir mit meinem Gesicht gerührten Erdteig … wühle in Leo, ich dringe in ihn ein, verdaue ihn, untrennbar diesmal … während der Brechreiz parallel zum Hunger wächst … Fressen und Kotzen … Hineinschaufeln und Hinausspeien« …
»Danach« – so der Titel des zweiten Kapitels – verbringt Diana ein paar Monate in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie, wo die »Erdklumpen verschlingende Irre« von Dr. Petersen therapiert und mit Tabletten behandelt wird. Einige Fragen des Arztes, zu dem Diana nur langsam Vertrauen fasst und den sie spöttisch »Gott« nennt, waren den Kapiteln des ersten Teils (»Davor«) jeweils vorangestellt, als dienten sie zum Anlass, die betreffenden Episoden aus ihrem Leben zu erzählen.
Nun steht ihre Entlassung bevor – doch wohin soll sie entlassen werden? Sie ist ja doch nur eine illegal eingereiste osteuropäische Prostituierte ohne Aufenthaltsgenehmigung wie viele andere auch. Sie ist weder »ethnisch verfolgt« noch »politisch aktiv« noch »heimlich religiös« gewesen, ihr droht keine Folter. »Sind Sie wenigstens vergewaltigt worden?« – nicht einmal das … Ihre Sorge, »dass meine Familie erfriert, wenn ich kein Geld schicke«, ist nicht justiziabel und wird gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Es gibt also keine Gründe, warum sie nach ihrem Klinikaufenthalt nicht abgeschoben werden sollte.
Bei einem Telefonat mit ihrer Schwester erfährt Diana, dass man ihren Sohn wegen einer Gewalttat in eine Anstalt gesperrt hat. Da flüchtet sie aus dem Krankenhaus. Eigentlich will sie zurück nach Russland, doch es fehlt ihr an Entschlusskraft, an Zielgerichtetheit; sie lässt sich treiben, wohin das Schicksal sie führt. Was folgt, ist ein Irrweg durch Europa, über die Alpen, nach Rom. Immer wieder überkommt sie ihre Psychose, die Sehnsucht der Einswerdung mit der modrigen Erde (»eine Heimkehr voller Umarmung«). Sie droht ihre Identität zu verlieren. Um ihren Namen nicht zu vergessen, spricht sie ihn wie ein Mantra vor sich hin.
Julya Rabinowichs dritter Roman »Die Erdfresserin« ist ein strapaziöses Buch, durchaus klar in der Sprache, aber in Inhalt und Sinn schwer zu verstehen, schwer zu verdauen. Die Autorin, mit etlichen Preisen ausgezeichnet, hat bei Therapiesitzungen in psychiatrischen Kliniken als Dolmetscherin mitgewirkt und dabei viel erlebt und gelernt, was hier eingeflossen sein wird. Aber der Roman ist weder eine psychologische noch eine soziologische Fallstudie. Dazu hat das Faktische einen viel zu niedrigen Stellenwert, während der poetische Überbau überfrachtet ist.
Die Figuren sind diffus charakterisiert: Welche Rolle spielte der Vater in den Fünfziger, Sechziger Jahren in der Sowjetunion, dass er eine geradezu großbürgerliche Existenz führen konnte? Warum setzte er sich ab von seiner Familie? Was hat Diana mit dem Vater ihres Kindes erlebt? Einerseits erweckt ihre Vita Mitleid, andererseits ist sie keineswegs nur Opfer; hart und entschlossen, lebenstüchtig und stark, auch kriminell, aber niemals wehleidig schlägt sie sich durch. Wie ist dann ihr totaler Zusammenbruch, ihr Realitätsverlust nach Leos Tod zu erklären? Natürlich gibt es solche Brüche, und man kann sie plausibel gestalten; hier aber sind sie kaum nachzuvollziehen.
Vage bleibt der Zeitrahmen, vage sind die Schauplätze umrissen, teils nur benannt, teils stereotypisch etikettiert. Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerungen, Fantasien und Realität der Elemente fließen ineinander. Das Buch endet in einer seitenlangen Sequenz traumähnlicher Kurzszenen, die Dianas Weg wie isolierte Puzzle-Elemente andeuten, ohne dass für uns oder sie selbst ein Gesamtbild erkennbar würde …
Diffus ist die Bildlichkeit. Ein zentrales, wiederkehrendes Motiv ist die altjüdische Legendenfigur des Golem, des aus Lehm gefertigten Homunkulus, der seinem Erschaffer gehorcht und dient, aber nicht sprechen kann. Diana entdeckte ein »Golem«-Buch in der Bibliothek ihres Vaters, las es gegen den Willen ihrer Mutter, und das Bild begleitet sie durch ihr Leben. Es löst Überlegungen aus über die Erschaffung Adams und Evas, über das Verhältnis zwischen Frau und Kind, zwischen ihr und ihrem Sohn im Besonderen. Ihre eigentümliche Beziehung zur Erde als Lebensquell, Nahrungsspender und Grab mag damit zu tun haben. Schließlich ›gebärt‹ sie selbst ein »Wesen«, das »aus den Erdschichten auftaucht«, mit denen sie sich zuvor vereint hat, dem sie in rhythmischem Gleichmaß von Diastole und Systole Leben einhaucht. Sie befiehlt dem Wesen, das ohne Gesicht bleibt, sie nach Hause zu führen, aber dann überkommen sie Ratlosigkeit und Wut, sie zerschlägt ihren Golem und schreit ihn doch gleichzeitig an: »Verlass mich nicht!« Ohne seine Führung erweist sie sich als hilflos, orientierungslos. Am Ende vergeht, zergeht schließlich alles in einem Gebär-/Todesakt, und alles wird eins …
»Die Erdfresserin« ist ein überladenes Buch, das auf der Folie des Schicksals einer »Illegalen« eine Reise aus einer tristen Realität in eine Bilderwelt der Mythen und Symbole erzählt und dabei seine Substanz verliert.
 · Herkunft:
· Herkunft: