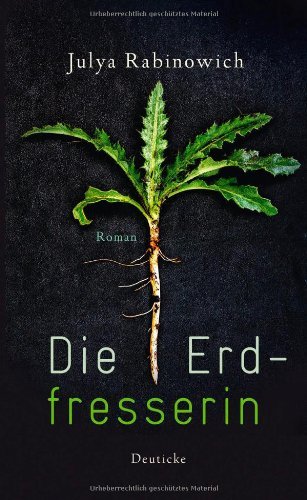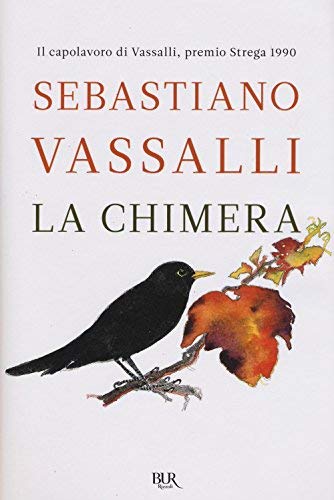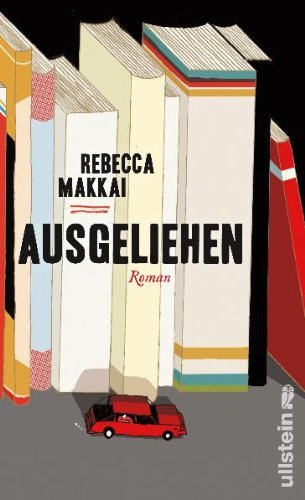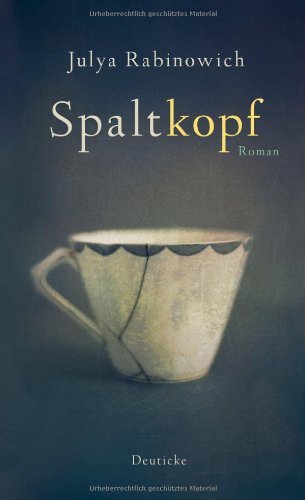
Heimatlos
Bekenntnisse der Erzählerin Mischka: "Meine Geschichte blutet sich aus mir heraus. Wo ich gestern zu Hause war, ist morgen verändert, und übermorgen vergangen." (S. 180) – "Wenn ich die Wahl zwischen zwei Stühlen habe, nehme ich das Nagelbrett." (S. 12, S. 181) – "Für das gärende Gift in mir verachte ich mich auch." (S. 190) Was muss ein Mensch erfahren haben, der so von sich spricht, der Hass, Gewalt, Schmerz und Blutleere empfindet?
Mischka entstammt einer russisch-jüdischen Familie aus Leningrad. Beide Eltern sind malende Künstler und kritische Intellektuelle, die sich immer geweigert haben, der Partei beizutreten. Sie leisten auf ihre Weise heimlich Widerstand. Ein pensionierter Oberst der Reserve bespitzelt sie. In den 70er Jahren genehmigt das Regime die zahlreich gestellten Ausreiseanträge, denn Oppositionelle will man gerne abschieben, und Juden sind nicht gut gelitten. Viele emigrieren nach Israel oder in die USA; Mischkas Eltern und Großmutter Ada wollen nach Australien.
Ihre erste Durchgangsstation ist Wien. Lustlos schlägt Mischka die Zeit in sämtlichen Kunstmuseen tot, die sie auf Wunsch der Eltern besucht. Sie soll auch Dostojewski lesen, um ihre russischen Wurzeln nicht zu vergessen. Nun lebt das Mädel also im Westen, soll sich aber den oberflächlich konsumorientierten amerikanischen Einflüssen entgegenstemmen. Wie soll sie hier jemals heimisch werden? Viel lieber würde sie sich auf dem Naschmarkt herumtreiben, die Warenvielfalt bestaunen, Junkies beobachten.
Vater Lev knüpft derweil Kontakte und organisiert seine erste Ausstellung – die auf Anhieb ein Erfolg wird. Obwohl sie doch nie wirklich Revolutionäre waren, zieht das Künstlerehepaar als dem Kommunismus Entflohene das Interesse der linken Intellektuellen an. Nun wird die Familie in Wien bleiben. Mischka wird eingeschult, bleibt aber Außenseiterin.
Für ihren Vater wollte Mischka der "ersehnte Nachfolgesohn" sein, doch das kann nicht gelingen. Sie erlebt ihre erste Blutung, ekelt sich vor ihrem Körper, der gegen ihren Willen knospende Hügel bildet, den Flaum der keimenden Behaarung empfindet sie als "Vorbote [ihres] Versagens" (S. 81), sie leidet an Essstörungen. Sie wird plötzlich in ihren Freiheiten eingeschränkt. Als Vater keine abendlichen Ausgänge mehr erlaubt, ist Kampf angesagt. Mischka provoziert mit Kleidung und kahl rasiertem Schädel, treibt sich nachts in Diskos und Bars herum, schläft in der letzten U-Bahn. Ihre Schwester Magdalena wird geboren – sie ist behindert, spricht nicht. Die Ehe der Eltern kriselt zusehends. Nachdem die Mauer in Berlin fällt, reist Vater Lev nach St. Petersburg, wo er stirbt und begraben wird. Die belastende familiäre Situation gibt Mischka keinen Halt. Sie haut nach Berlin ab, lebt in einer WG mit Studenten, Kriminellen, Feministinnen, Alkoholikern und anderem Volk.
Wie stark Mischka unter ihrer schmerzvollen Identitätskrise leidet, findet Ausdruck in ihrer geradezu manischen Ausrichtung auf Spiegel und Gläser, die ihr Gesicht reflektieren. Sie sucht sich ständig, blickt bei jeder Gelegenheit in ihre Augen, findet sich nie. Wer ist sie? Oft genug erschrickt sie vor sich selber, glaubt, da schaue ihr der Spaltkopf, ein dämonischer Geist, entgegen, oder gar die Hexe Baba Yaga. Beide sind mythische Gestalten, mit denen man unfolgsamen Kindern in Russland Angst machte: "Warte bis der Spaltkopf kommt, er stülpt sich über dein Haupt und saugt Gedanken und Seele aus."
Was treibt Mischka in die Ehe mit Franz? Ist es ihre Schwangerschaft? Ist es Liebe? Sucht sie Geborgenheit? Will sie endlich Wurzeln schlagen können als Partnerin und Mutter? Nichts von alledem ergibt diese Beziehung. Schnell sind die beiden wieder geschieden. Geradezu wahnhaft identifiziert sich Mischka mit der bösen Hexe Baba Yaga. In dieser Rolle darf sie nicht nur sich selbst, sondern auch dem Kind, das sie in sich trägt, Gewalt zufügen; sie tötet es, und diesen Wunsch hegt sie auch gegen Franz, der zum zweiten Mal heiratet.
Als Mischka in ihre Geburtsstadt St. Petersburg reist, das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, und das Grab des Vaters aufsucht, bemerkt sie, dass auch dort niemand sie willkommen heißt – eine, die damals abgehauen ist, sich nie mehr gemeldet hat. Sie ist eine Heimatlose.
Was für eine bittere, qualvolle, zynische, sarkastische Entwicklungsgeschichte! Ein junges Mädel wird plötzlich und unvorbereitet ihrer Wurzeln beraubt, in eine fremde Welt verpflanzt. Zerrissen in sich selber, kommt sie eigentlich nie in der Realität an, steckt voller Ablehnung gegen andere, aber besonders schmerzhaft gegen sich selbst. Ihr Glück findet sie im goldenen Westen nicht.
Mischkas emotionale Auswüchse, sprunghafte Wendungen, irrationale Art und heftige Widersprüche spiegeln sich in der literarischen Form. In kurze Aussagesätze gedrängt, jagen die Ereignisse den Leser voran. Mitten im Text springt die Erzählerin in völlig andere Situationen, andere Zeiten, andere Orte, formuliert rätselhaft. Eingeschobene und kursiv abgesetzte Texte haben poetischen Charakter, betrachten aus anderen Perspektiven, erzählen zum Beispiel Erlebnisse aus Großmutter Adas Vergangenheit.
"Spaltkopf" steckt voller Überraschungen, ist stellenweise sehr anstrengend zu lesen, fordert volle Aufmerksamkeit. Hat der Leser den Handlungsfaden aufgenommen, schon schüttelt die Autorin ihn wieder durch, spielt mit ihm, reiht Sätze in assoziativer oder Sinn entwickelnder oder verdrehender oder geradezu dadaistischer Weise aneinander – etwa in der uhrwerkähnlichen Sequenz über Zahl, Wort, Wissen und Macht (S. 165 f.).
Julya Rabinowichs "Spaltkopf" ist ein intellektuell anspruchsvoller Roman, keine leichte Lesekost. 2008 erschien der mit dem "Rauriser Literaturpreis" ausgezeichnete Debütroman in der Wiener edition exil; 2011 hat Deuticke das vielbeachtete Buch neu aufgelegt.
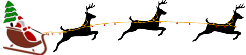 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: