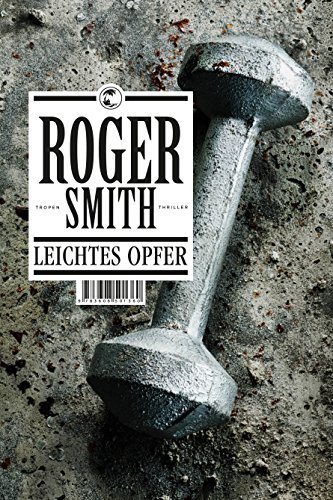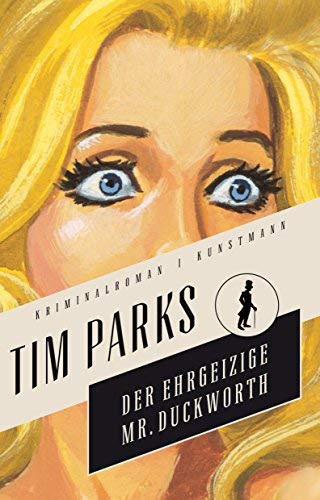Zuviel des Guten
Die Familie Cooke aus Bloomington, Indiana, das ist wahrhaftig eine ungewöhnliche Gemeinschaft. Sie wird uns von Rosemary, der 1970 geborenen Tochter, aus der Ich-Perspektive vorgestellt. Ihr Bruder Lowell ist etwas älter. Vince Cooke, beider Vater, war Professor für vergleichende Verhaltenspsychologie bei Mensch und Tier, ein pedantischer, ehrgeiziger Wissenschaftler, absent father, workaholic, Kettenraucher und Trinker, bis er 1998 an einem Herzinfarkt verstarb. Seine Frau (die namenlos bleibt) war ihren Kindern eine sensible und fürsorgliche Mutter. Dass sie, als Rosemary neun Jahre alt war, eine Fehlgeburt erlitten habe, war nur eine Legende, um zu begründen, warum ihr Töchterchen plötzlich bei den Großeltern untergebracht werden musste. In Wirklichkeit hatte eine urplötzlich hereinbrechende, unausweichliche Veränderung in der Familie Mom derart aus der Bahn geworfen, dass sie für lange Zeit in Depressionen fiel und den Haushalt nicht mehr führen konnte. Heute lebt Rosemary, die Grundschulkinder unterrichtet, mit ihrer über sechzigjährigen Mutter in einem gemeinsamen Haushalt.
Rosemary war gerade einen Monat auf der Welt, als sie eine Art Schwester bekam: ein Schimpansenbaby namens Fern und bereits drei Monate alt. Die beiden würden ihre ersten Lebensjahre intensiv teilen, und bis heute betrachtet Rosemary ihr ungewöhnliches Familienmitglied als ihren ›Zwilling‹.
Dass Fern ganz anders aussieht, sich anders verhält und anders spricht als sie selbst, fällt der kleinen Rosemary nicht auf. Im Gegenteil: Sie ahmt die menschenähnlichen Verhaltensweisen ihrer tierischen Schwester nach, bis sie ihr selbst zueigen werden. Sehr lange läuft das Mädchen auf allen vieren, klettert über Tisch und Bänke. Im Kindergarten wird sie von Anfang an als »Monkey-Girl« geschnitten, nicht nur wegen ihrer auffälligen Mimik und Gestik, sondern auch wegen ihrer Vorliebe, andere Kinder zu beißen oder an den Haaren zu ziehen. Auch in der Schule findet sie keine Freundin, bleibt das »Affenmädchen« mit »höchstens teilmenschlicher Natur«. Ausgestoßen aus der Gemeinschaft erfindet sich Rosemary eine Freundin in der Fantasie und schenkt ihr den zweiten Teil des eigenen Namens: Mary.
Mit ihrer ›Zwillingsschwester‹ hat sie derweil längst ein inniges, intimes Verhältnis entwickelt. Die gemeinsamen Spiele, der stetige enge Körperkontakt, der Geruch, der feuchtklebrige Atem im Nacken, wenn Fern mit ihren »Pfeifenreiniger-Armen« Rosemary umklammert, all das ließ beide geradezu zu einer Person verschmelzen.
Dann wird das Fern-Projekt abrupt beendet. Der verantwortliche Professor Cooke verliert seine Forschungsstelle, seine wissenschaftlichen Mitarbeiter müssen sich neue Arbeitsplätze suchen. Die beiden Untersuchungsobjekte Fern und Rosemary haben ebenfalls ausgedient: Der Affe wird aus der Familie genommen, das Mädchen bleibt allein zurück. Die Folgen sind dramatisch und nachhaltig über Jahrzehnte. Der Vater kompensiert den Verlust seiner Reputation durch regelmäßigen Alkoholkonsum, die Mutter bricht zusammen, muss ihre kleine Tochter zu den Großeltern ausquartieren, Sohn Lowell setzt sich für immer ab, wird später als Aktivist der »Animal Liberation Front« vom FBI gesucht.
Rosemary, einst eine nicht zu stoppende »Quasselstrippe«, hört auf zu sprechen. Mit ihrem »Verstummen« beginnt eine Zeit der »merkwürdigen Stille«, die sich auch zwischen den Eltern breit macht, während sich Rosemarys psychisches Leiden als lebenslanges Trauma in stereotypen Zwangshandlungen niederschlägt: mit dem Körper schaukeln, Nägel kauen, Augenbrauen ausreißen ...
Warum und wie genau das alles so gekommen ist, warum Rosemary die Zusammenhänge – einschließlich ihrer möglichen eigenen Schuldanteile – erst nach vielen Jahren begreift, das erzählt sie nach und nach in kleinen Portiönchen, weit ausholend und unchronologisch. Ihre Erzählung setzt »in der Mitte meiner Geschichte« ein, im Winter 1996. Da studiert Rosemary schon im fünften Jahr Geschichte, Volkswirtschaft und Philosophie weit weg vom Elternhaus an der University of California in Davis. Ihren Bruder Lowell hat sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, Fern ist seit siebzehn Jahren verschwunden. Den strukturellen Trick, mittendrin zu beginnen, wählt die Erzählerin bewusst, um Ferns wahre Identität vorläufig zu verschleiern. Bis nach etwa neunzig Seiten enthüllt wird, dass die ›Zwillingsschwester‹ ein Schimpanse ist, soll ihr Wesen immer undurchsichtiger und exotischer erscheinen. Freilich können selbst Leser, die sich vorab kein bisschen über ihre neue Lektüre informiert haben, durchaus erschließen, was es mit der merkwürdigen Kreatur auf sich hat. Die Verrätselung wirkt daher künstlich und aufgesetzt.
Karen Joy Fowlers Grundkonzept, eine ungewöhnliche Familienkonstellation zu entwickeln, in deren Zentrum ein Mensch und sein nächster Verwandter aus dem Tierreich gemeinsam aufwachsen, ist reizvoll und birgt zahllose darstellens- und diskutierenswerte Themen. Was sollen wir von einem Vater halten, der seine eigene Tochter zum ›Versuchstier‹ macht? Zwar lautete das offizielle Forschungsziel zunächst, zu ergründen, wie weit ein Affe die menschliche Sprache erlernen könne, doch immer stärker gerät in den Fokus, wie sich Rosemarys Verhalten im ständigen Zusammensein mit der zwangszugeführten Gefährtin entwickelt, insbesondere ob das Menschenkind irgendwann mit dem Tier sprechen kann. Sehr gut nachvollziehbar arbeitet die Autorin die Konsequenzen dieses fragwürdigen Experiments heraus, Rosemarys emotionales Leid nach der abrupten, unverständlichen Trennung von Fern, ihre soziale Störung, das Zerbrechen der Familie.
Warum aber überzeugt dieser Roman (der sprachlich vorwiegend sachlich-nüchterne oder unterhaltende bis kräftig witzige Töne anschlägt) am Ende doch nicht recht? Nach meinem Eindruck will Karen Joy Fowler einfach zuviel – zu Unterschiedliches, zu Widersprüchliches, zu schwer Vereinbares. So vielfältig ist zwar das Leben, dieser Roman aber kann nicht, wie er es anstrebt, dessen Tiefe bieten. Manche Passagen sind brüllend komisch, aber die tieftraurigen Ereignisse schaffen es nicht, bis unter die Haut des Lesers zu wirken. Die Erzählung soll nicht einfach an der Handlungsoberfläche plätschern, sondern wissenschaftliche Untermauerung mitliefern. Also kommt Rosemary immer wieder auf die Verhaltensforschung bei Primaten zu sprechen und erwähnt Erkenntnisse renommierter Forscher wie Jane Goodall, Call und Tomasello, Day und Davis, Iwanow. Da purzeln die wissenschaftlichen Fachausdrücke nur so über die Seiten (»Solipsismus«, »Idioglossie«, »Metakognition« ...), aber dem unbedarften Leser bringt all das weder einen fundierten Wissenszuwachs noch erhöht es den erhofften Unterhaltungswert. Das Mischkonzept führt zu nichts Halbem und nichts Ganzem.
Und dann all diese thematischen Abschweifungen und blinden Nebenhandlungen: ein Diskobesuch, ein Hausmeister, eine Mitkommilitonin, die sich in Lowell verliebt; ein Koffer mit Mutters Tagebüchern geht verloren, dafür taucht eine Bauchrednerpuppe namens »Madame Defarge« auf; eine Vorlesung über »Religion und Gewalt«; eine inhaltliche Exkursion über weibliche Gewalt am Beispiel des WKKK (weiblicher Ku-Klux-Klan). In einem Kurs über Europäische Literatur erregt Franz Kafka Rosemarys Aufmerksamkeit; jedem der sechs Hauptteile ist eine kurze Passage aus seinem »Bericht für eine Akademie« vorangestellt (den die Erzählerin – wen wundert's – »gänzlich unmetaphorisch« auffasst).
Ein besonderes Lob gebührt dem Übersetzer Marcus Ingendaay, dem es gelungen ist, die unterschiedlichen Töne und Stile dieses Unterhaltungsromans verlustlos ins Deutsche zu transponieren. Ein Blick in seine Werkstatt – drei Vergleiche mit der englischen Vorlage »We Are All Completely Beside Ourselves«  – verrät, wie frei solche literarischen Profis ihre sprachlichen Fahnen flattern lassen und dem Originaltext gern noch eins draufsetzen.
– verrät, wie frei solche literarischen Profis ihre sprachlichen Fahnen flattern lassen und dem Originaltext gern noch eins draufsetzen.
1. »I nodded some more and the whole time I was making this agreeable gesture, I was telling him that his position on superpowers was balderdash and had no bearing on the real world. ›Poppycock,‹ I said. ›Flapdoodle. Bollocks. Piffle. Crapola. Codswallop.‹«
»Aber ich nickte weiter zu allem – und versicherte ihm gleichzeitig, dass seine Haltung zu den Superkräften so ziemlich der größte Mist sei, den ich je gehört habe, weil sie, seine Haltung, nicht den geringsten Bezug zur realen Welt aufweise. Mit anderen Worten: Es sei semantikfreie Kopfkotze. Schmonzes. Kiki. Killefit. Schnullipuh. Pillepup.«
2. »I was a ball. I was a blast. I was so not what was going on here.«
»Ich war knorke, ich war schnafte, ich war voll die Hoschibraut. Und ich hatte keinen Schimmer, was gerade vor mir ablief.«
3. »How amazed my long-ago babysitter Melissa and my Cooke grandparents would be if only they could see it. I tried to imagine them all in the room with me, offering encouragement. ›Keep quiet!‹ they told me. ›Stop your infernal talking! Give me a minute to hear myself think.‹«
»Keine Ahnung, was meine beiden Großmütter oder meine Babysitterin Melissa dazu gesagt hätten, aber ich wette, sie wären beeindruckt gewesen, welche Fortschritte der Mensch machen kann. Umgekehrt motivierte mich ihr altes Lamento: ›Herrgott, Kind, halt endlich den Sabbel, du quasselst mir noch einen Pilz ans Ohr.‹«
 · Herkunft:
· Herkunft: