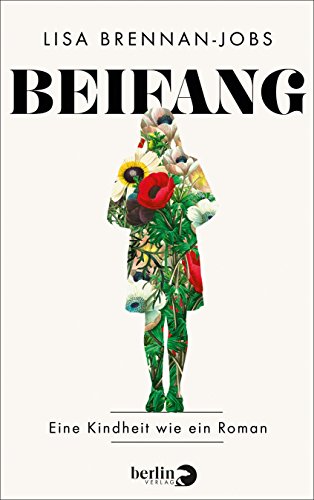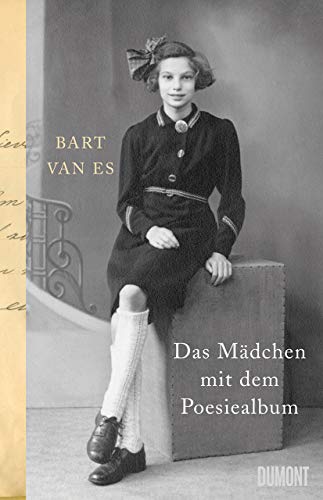Die Durchlässigkeit der Zeit
von Leonardo Padura
Ex-Kommissar Mario Conde soll einen Kunstraub aufklären – auf Bitten eines Schulfreundes. Tiefe Einblicke in das heutige Kuba, wo viele Hoffnungen enttäuscht wurden.
Tempelritter, die Schwarze Madonna und der Sozialismus
Mario Conde, Ex-Polizeikommissar in Kubas Hauptstadt Havanna, ist bald sechzig Jahre alt und schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Die große Wende darin ereignete sich zu Beginn der 1990er Jahre und zwang nicht nur ihn, sondern sein ganzes Land, ja große Teile der Welt, sich neu zu arrangieren. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks verlor Kuba damals seine lebenswichtigen Verbündeten und Handelspartner und versank in bitterarmen Umständen. Der revolutionäre Elan des sozialistischen Castro-Regimes schlug plötzlich auf dem harten Boden politischer und wirtschaftlicher Tatsachen auf. Man musste neue Wege finden, entdeckte den Tourismus als Goldesel, ließ den Menschen ein wenig Freiraum für unternehmerische Initiativen, hielt aber an der Doktrin und der starren Kontrolle aller Lebensbereiche fest. Während die einen der jahrzehntelang verklärten Ideologie nachhingen, machte sich bei anderen Enttäuschung breit, weil frischer Wind und erhoffte Freiheiten ausblieben.
Teniente Conde gehörte zu Letzteren. Unzufrieden mit der Entwicklung und den Zuständen in seinem Berufsfeld hängte er seinen Polizistenstatus an den Nagel und handelte fortan mit antiquarischen Büchern. Wie er sich seither nur noch nebenbei mit Kriminalfällen befasst, ist Gegenstand von Leonardo Paduras mittlerweile sieben Romanen und einer vierteiligen Netflix-Serie (»Four Seasons in Havana«, 2016).
Der neueste Band, »La transparencia del tiempo«  (übersetzt von Hans-Joachim Hartstein), spielt im Herbst 2014 und dreht sich um die Holzstatue einer Schwarzen Madonna. Die Figur kam während des spanischen Bürgerkriegs nach Kuba und gelangte in den Besitz der Familie eines Schulfreundes, Roberto Roque Rosell, genannt Bobby. Jetzt wurde ihm das Kunstwerk gestohlen, und deshalb wendet er sich nach vielen Jahren erstmals wieder an Mario Conde. Warum nicht an die Polizei? Bobby kennt den Dieb – und hatte eine Liebesbeziehung mit ihm. Homosexualität wird aber in Kuba nicht toleriert.
(übersetzt von Hans-Joachim Hartstein), spielt im Herbst 2014 und dreht sich um die Holzstatue einer Schwarzen Madonna. Die Figur kam während des spanischen Bürgerkriegs nach Kuba und gelangte in den Besitz der Familie eines Schulfreundes, Roberto Roque Rosell, genannt Bobby. Jetzt wurde ihm das Kunstwerk gestohlen, und deshalb wendet er sich nach vielen Jahren erstmals wieder an Mario Conde. Warum nicht an die Polizei? Bobby kennt den Dieb – und hatte eine Liebesbeziehung mit ihm. Homosexualität wird aber in Kuba nicht toleriert.
Bobby, ein androgyner Typ mit extravagantem Äußeren, das Conde weder mit seinen Erinnerungen an früher noch mit der in sich gekehrten, niedergedrückten, verzweifelten Erscheinung seines überraschenden Besuchers in Einklang bringen kann, erzählt dem Ex-Kommissar seinen Lebensweg. Da die Gesellschaft, seine Eltern und er selbst seine Neigung ablehnten, hat er vierzig Jahre damit verbracht, dagegen anzukämpfen, sich »hinter einer Maske verborgen«, allen ein Ich vorgelebt, das nicht seins war. Er hat geheiratet und Kinder gezeugt.
Dann lernte er Raydel kennen, wesentlich jünger und »atemberaubend« attraktiv. Doch dessen Interessen sind weniger amourös denn materialistisch. Nachdem er es sich zwei Jahre lang in Bobbys vermögendem Dunstkreis gut gehen ließ, verschwand er vor gut einer Woche auf Nimmerwiedersehen, im Gepäck Juwelen und die hölzerne »Jungfrau von Regla«. Den Schmuck kann Bobby locker verwinden, nicht aber die Marienstatue, deren Wunderkräften er seine Gesundheit schuldet. Hilfe bei der Wiederbeschaffung ist ihm eine beachtliche Summe wert, und Mario Conde ist dafür genau der Richtige. Keine andere Spürnase bringt so viel Talent und Bauchgefühl, dazu ein weit verzweigtes Netzwerk guter Freunde mit, die ihrerseits beliebige Kontakte, auch gefährlicher Natur, in den Armenvierteln herstellen können.
Mehr als die Erzählung der konkreten Ermittlungsarbeit interessiert den Autor allerdings die sorgfältige Figurenzeichnung und die Erfassung der gesellschaftlichen Entwicklung seines Heimatlandes. Schon seit vielen Jahren verweigert sich Leonardo Padura dabei den offiziell gewünschten Klischees vom kubanischen Inselidyll, und erstaunlicherweise hat ihn die Zensur trotz seiner kritischen Haltung bislang einigermaßen ungeschoren durchkommen lassen.
Im Mittelpunkt seiner detaillierten Beschreibungen steht die Hauptstadt Havanna. Die Mär von der Gleichheit aller ist im unerträglich heißen Herbst des Jahres 2014 längst zerstoben und einem schockierenden Kontrastprogramm gewichen. Eine kleine Oberschicht, die beste Kontakte in die USA pflegt, genießt ihren Reichtum, auf welche Weise er auch immer angehäuft sein mag, und geht in den noblen Einkaufszeilen, Edelrestaurants und im traditionellen Stil frisch renovierten Hotels für superreiche Touristen ein und aus. In unmittelbarer Nachbarschaft hausen Einheimische und ungeliebte Zuwanderer aus dem Osten der Insel in unbeschreiblich heruntergekommenen Elendsquartieren, lebensgefährlichen Ruinen ohne Wasser und Strom. Wer dort Tag für Tag ums nackte Leben kämpfen muss, für den hat die minimale Öffnung des sozialistischen Modells keinerlei Verbesserung gebracht. In manchen Vierteln gedeiht rohe Kriminalität dermaßen, dass sich selbst Ex-Polizist Conde nur in Begleitung seiner drei Freunde hineinwagt.
Aber – und das ist vielleicht der noch größere Tabubruch – in Paduras Büchern gibt es Kriminalität auch in den höheren Bevölkerungsschichten – sie ist allerdings raffinierter, verborgener und einträglicher. Da hält ein Polizist die Hand auf, ein anderer schließt lieber seine Augen, damit die illegale Schattenwirtschaft floriert, clevere Gauner saugen das Land aus, verscherbeln seine verbliebenen Schätze. Überdeutlich prangert Padura an, dass sämtliche Chancen einer menschenfreundlichen neuen Revolution vertan wurden.
Die Aufklärung des Kunstdiebstahls und weiterer damit verbundener Verbrechen bis hin zu Mord trägt die Romanhandlung. Was es mit der Statue auf sich hat, erfahren wir aus einer umfänglichen eigenständigen Erzählung, die Hobbyautor Mario Conde selbst verfasst. Sein fiktionaler Held zieht mit den Tempelrittern (die später selber als Ketzer verfolgt, gefoltert und hingerichtet wurden) gen Jerusalem, um die Ungläubigen zu richten. Er beteiligt sich am Gemetzel, bereut später seine Untaten und betet um Vergebung. Mit einer hölzernen Mutter Gottes gelangt er auf verschlungenen, abenteuerlichen Wegen zurück in das Pyrenäental seiner Kindheit.
»Die Durchlässigkeit der Zeit« ist eine nachdenklich stimmende Lektüre. Die Kriminalgeschichte um die gestohlene Madonna unterhält gut mit allerlei Überraschungen, besticht aber eher durch ihren interessanten historisch-kulturellen Hintergrund als durch Nerven aufreibende Spannung. Einen noch größeren Leseanreiz bilden die überzeugende gesellschaftliche Analyse und die anschaulichen, bildkräftigen Schilderungen aus diversen Milieus, verbunden mit tiefer Empathie für die vielen geschundenen Mitbürger. Dass der Protagonist (wie sein Autor) der dramatischen Entwicklung seines Landes nur ohnmächtig zusehen kann (»was in Kuba nicht verboten ist, ist illegal«; »aus dieser jahrelang kumulierten Verwahrlosung konnte nichts anderes entstehen als noch mehr Verwahrlosung, und zwar die schlimmste von allen: die menschliche Verwahrlosung«), trägt zu der Wehmut bei, die Mario Conde an der Schwelle zu seinem nächsten Lebensjahrzehnt bedrückt. Was ist von seinem Leben geblieben? Was wird ihm die Zukunft noch ermöglichen? Oft genug kann er seine tiefe Traurigkeit nur mit billigem Fusel betäuben. Aber im Schreiben findet er eine Form der persönlichen Freiheit. Dann erscheint er wie ein Alter Ego seines Autors.
 · Herkunft:
· Herkunft: