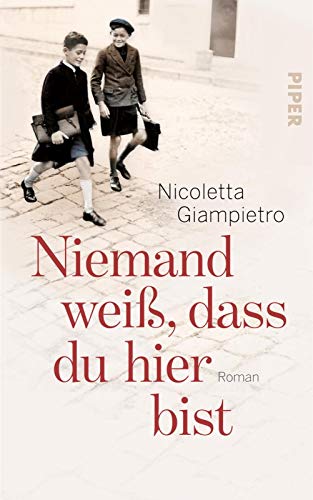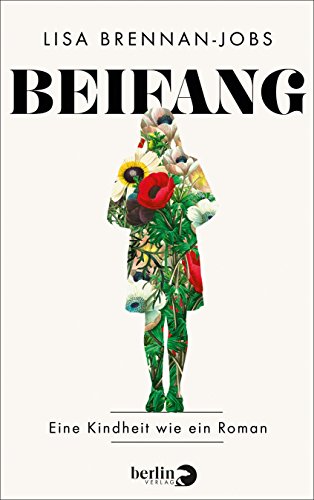
Beifang
von Lisa Brennan-Jobs
Die Autorin ist die älteste Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs. Von Anfang an war sie „nur Daddys Fehler". Wie sie damit früher und heute gelebt hat, erzählt sie hier.
Vater werden ist nicht schwer
Wäre dieses Buch ein Bestseller geworden, wenn der Vater der Autorin John Doe (»Max Mustermann«) hieße? Wie viele Käufer haben sich in Wirklichkeit für den illustren Vater und nicht so sehr für die wenig bekannte Tochter interessiert? Und ist es denn belangreich, fast vierhundert Seiten über die Probleme der ungeliebten Tochter eines exzentrischen Nerds zu lesen?
Gleich der Titel setzt den Ton auf Verletztheit. »Hey, Small Fry, let’s blast«, schlug der längst schwerreiche Papa bei seinen raren Wochenendbesuchen vor – eine kumpelhafte Einladung an seine Siebenjährige zu einer Rollschuhtour. Aber »alternativeHeadline">Small Fry«  , das sind nun mal »kleine Fische«, »junges Gemüse«, »Kleinkram« oder eben »Beifang«, wofür sich die Übersetzerin Bettina Abarbanell entschieden hat: kümmerliche Jungfischchen, die der Fischer ins Meer zurückwirft, weil sie noch nichts bringen, und schon das kleine Mädchen spürt wohl, dass das kein sonderlich liebevoller Kosename für sie ist. Lieber klammert sie sich an die Wunschvorstellung, der gerade mal wieder greifbare Vater liebe sie innig. Darin bestärkt sie seine Nähe, wenn er sie huckepack nimmt, und wenn sie zusammen stürzen, ignoriert sie tapfer ihre Wunden an Armen und Knien, um das bisschen erlebte Zärtlichkeit nicht zu gefährden.
, das sind nun mal »kleine Fische«, »junges Gemüse«, »Kleinkram« oder eben »Beifang«, wofür sich die Übersetzerin Bettina Abarbanell entschieden hat: kümmerliche Jungfischchen, die der Fischer ins Meer zurückwirft, weil sie noch nichts bringen, und schon das kleine Mädchen spürt wohl, dass das kein sonderlich liebevoller Kosename für sie ist. Lieber klammert sie sich an die Wunschvorstellung, der gerade mal wieder greifbare Vater liebe sie innig. Darin bestärkt sie seine Nähe, wenn er sie huckepack nimmt, und wenn sie zusammen stürzen, ignoriert sie tapfer ihre Wunden an Armen und Knien, um das bisschen erlebte Zärtlichkeit nicht zu gefährden.
Solche schlaglichtartige Beispiele lesen wir viele in Lisa Brennan-Jobs’ Autobiografie. Als kleines Kind nimmt sie die Umstände ihres Lebens noch hin, wie sie sind, leidend, fragend, aber wohlwollend. Je älter sie wird, desto mehr verzweifelt sie an den erschreckenden Diskrepanzen zwischen kleinen Interessensbekundungen und bitteren Demütigungen, die sie durchleben muss, wenn sich Steve Jobs alle paar Monate oder gar Jahre einmal sehen lässt. Als Vierzigjährige durchforstet sie das Erlebte und betrachtet es im Rückblick neu, distanzierter, mit reiferem Verständnis urteilend.
Es ehrt die Autorin, das Ansehen des 2011 Verstorbenen, so gut es geht, relativieren zu wollen, doch unterm Strich kommt der Mann in den Darstellungen seiner Tochter nicht gut weg: ein auf seine Weise genialer, aber kaum liebenswerter Mensch, der gelegentlich guten Willen aufbringt, aber als Lisas Vater an seinen vielen Schwächen und fragwürdigen Eigenschaften scheitert. Er ist ihr (wie auch vielen anderen) gegenüber unberechenbar, herrisch und manipulativ, rachsüchtig, unsensibel und gefühllos, so dass er seine Mitmenschen brutal demütigen und verletzen kann, und er ist – wer hätte das gedacht – geizig. An diesem traurigen Bild eines komplizierten, kalten Charakters ändert auch die Tatsache nichts, dass er sich kurz vor seinem Krebstod mit seiner ältesten Tochter aussöhnte und bereute, ihr so wenig Zeit und Verständnis geschenkt zu haben. Ihr Erbe dürfte einen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen.
Lisa ist das Kind einer Highschool-Beziehung zu Hippie-Zeiten in Kalifornien. Der siebzehnjährige Steve (den seine Eltern gleich nach seiner Geburt zur Adoption freigegeben hatten) und die ein Jahr ältere Mitschülerin Chrisann Brennan finden Anfang 1972 zueinander, werden aber nie ein festes Paar. Man zieht für eine Weile zusammen, hat andere Partner, geht weg, lebt in Kommunen, trifft sich wieder. Steve schmeißt sein soeben begonnenes Studium, jobbt bei Atari, experimentiert mit alternativen Ernährungs-, Medizin- und religiösen Anschauungen, reist in Indien herum. Dorthin zieht es auch Chrisann, aber mit einem anderen. Obwohl er selbst ständig eigene Wege geht, muss es ihn zutiefst kränken, bei Chrisann nicht die Nummer Eins zu sein. So kriselt die Freundschaft vor sich hin, während Steve sich in der jungen Computerbranche einen Namen macht und 1976 mit zwei Freunden die Firma Apple gründet. Ihr Modell Apple II schlägt auf dem brandneuen Markt der Heimcomputer ein. Da kommt Chrisanns Mitteilung, sie sei schwanger (man war mal wieder zusammengezogen), äußerst ungelegen. Steve ist wütend, streitet seine Vaterschaft ab (schließlich habe die Mutter noch andere Beziehungen gehabt), ist gegen Abtreibung und Adoptionsfreigabe, verweigert aber jede Hilfe.
Chrisann, allein gelassen und von Gelegenheitsarbeiten lebend, bringt ihre Tochter am 17. Mai 1978 in einer Kommune in Oregon zur Welt. Steve fliegt für ein paar Tage ein, um sich bei der Namensgebung zu engagieren. Apples nächstes Computermodell soll einen weiblichen Namen bekommen, und es wird der sein, den Chrisann für ihre Tochter vorschlägt. (Erst Jahrzehnte später wird der Mann einräumen, dass »Lisa« doch nicht, wie er hartnäckig behauptet hatte, für »Local Integrated Software Architecture« stand, sondern seine Tochter meinte.)
Steve Jobs’ Strategie, jegliche Verantwortung für Mutter und Kind von sich zu weisen (»Es ist nicht mein Kind.«), treibt absonderliche Blüten. Er verunglimpft öffentlich Chrisanns Lebenswandel, behauptet unter Eid, unfruchtbar zu sein, zweifelt das Ergebnis eines DNA-Tests an (94,1%!) und lässt sich im Dezember 1980 vom Bundesstaat Kalifornien zu 500 Dollar monatlicher Unterhalts- und Sozialhilfezahlung verdonnern. Vier Tage später wird Apple an der Börse gehandelt – zum Unternehmenswert von 1,8 Milliarden US-Dollar. So dominiert ausgerechnet Armut die frühesten Erinnerungen des vierjährigen Milliardär-Töchterchens. Während Mutter und Tochter in einem angemieteten Zimmer hausen, fährt Steve im Porsche vor, um ihnen seine neue Protz-Villa vorzuführen – für Lisa ein unverständliches Gebäude voller übergroßer Räume, die der Hausherr im Übrigen niemals betreten wird, wie wir später erfahren.
Lisas Kindheit ist durch lauter Zerrissenheiten, einander abstoßende Pole, sich widersprechende Emotionen beeinträchtigt. Denn nicht nur ihr Vater ist voller Widersprüche und Wandlungen, eine extreme Ausnahmepersönlichkeit, die zu lieben kaum möglich ist. Auch ihre Mutter hat einen problematischen, fragilen Charakter. Von Geldnot und instabilen Bekanntschaften zur Verzweiflung getrieben, scheitert sie in ihren Bemühungen, Lisa eine gute Mutter zu sein, ebenso wie in ihren Träumen, sich als Künstlerin zu verwirklichen. Als Lisa in der Pubertät rebellisch wird, jede Mithilfe verweigert, mit Schminke und Kleidung provoziert, ist sie hilflos. Die Streitigkeiten eskalieren, bis Lisa die Ausbrüche ihrer Mutter (Reue, das Mädchen geboren zu haben, Selbstmordgedanken) nicht mehr erträgt und wegläuft.
1991 hatte Steve Jobs Laurene Powell geheiratet, mit der er bis 1998 drei Kinder bekommt. Lisa darf in diesem Luxushaushalt oft zu Gast sein, wenngleich sie dort Schuldgefühle belasten, ihre Mutter in ihrer schlechten Verfassung im Stich gelassen zu haben. Gleichzeitig fühlt sie sich in der Familie als Aschenputtel behandelt und zutiefst einsam. Man sagt ihr nicht einmal Gute Nacht. Oder war sie überempfindlich? Hegte sie zu hohe Erwartungen? Es wundert kaum, dass die Stiefmutter das Bild, das Lisa jetzt in ihrer Biografie von Steve Jobs als Ehemann und Familienvater veröffentlicht, entschieden leugnet. Immerhin räumte sie Lisa gegenüber einmal ein: »Wir sind einfach kalte Leute.« So findet Lisa schließlich nirgendwo Orientierung, niemals Seelenfrieden.
In ihrer Autobiografie ringt sie darum, ein Bild ihres prominenten Vaters zu zeichnen, das ihre zutiefst persönlichen Erfahrungen eher trister Natur vermittelt, aber auch seine Qualitäten aufspüren soll, selbst die, die für sie selber schwer erkennbar blieben. Aus ihrer eigenen Perspektive und der vieler anderer Personen setzt sich ein vielfarbiges, bisweilen paradoxes Porträt zusammen. Dass er ein gewinnendes Wesen vorzeigen, charmant sein konnte, ein begnadeter Präsentator seiner Produkte wie seiner selbst war, dann wieder abrupt eiskalt, geradezu bösartig austeilen konnte, illustriert seine Tochter in unzähligen Beispielen.
Ihr Erwachsenendasein hat Lisa Brennan-Jobs im Übrigen eigenständig (abseits des Scheinwerferlichts) und erfolgreich gemanagt. Sie arbeitete im Finanzwesen, lebte in Großbritannien und Italien, publizierte Artikel in literarischen Zeitschriften. Ihr kluges Buch ist sprachlich auf gutem Niveau und vermittelt überzeugend ihre Bemühung, ohne Gehässigkeiten schreibend endlich Klarheit zu gewinnen, das zerrissene Wesen des Vaters besser verstehen, ihm am Ende womöglich verzeihen zu können und für sich selbst den Kopf frei zu bekommen. Die gewaltigen Auflagehöhen sind allerdings gewiss der Anschubhilfe des weltweit strahlenden Namens geschuldet – und der Neugier des Publikums, ein paar Blicke durchs Schlüsselloch zu erhaschen. Davon bekommt man genug, zwischen Trivia (der Papa pupt) und Tragik (»Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein.«).
 · Herkunft:
· Herkunft: