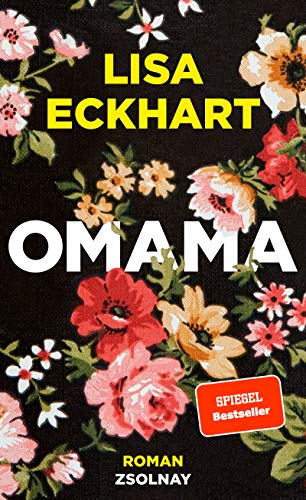Pandatage
von James Gould-Bourn
Ein Trostbuch: Nach dem Unfalltod seiner Mutter versinkt ein kleiner Junge in einem Schweigetrauma, seinem Vater droht die Kontrolle über seine Lebensführung zu entgleiten. Ein Panda-Kostüm hilft beiden aus der Not.
Trauern, bis der Panda tanzt
Das einzige Glück, das Danny Malooney in seinem Leben beschieden war, ist Liz gewesen. Ansonsten gehörte er, seit er ein kleiner Junge war, zur Sorte Unglücksrabe. Als Vierjähriger biss er erwartungsvoll in etwas, das lecker nach Zitrone duftete, dann aber eklig nach Seife schmeckte. Mit zwölf kletterte er mutig auf einen Ahornbaum, um eine Katze aus vermeintlicher Not zu befreien, fand sich dann aber selbst in der Misere, nachdem er unsanft zu Boden gefallen war und erstmals Körperteile zu spüren bekam, die er als schmerzfreie Zonen in Erinnerung hatte. Als er siebzehn war, glaubte er gar allgemein bekannte Naturgesetze missachten zu können. So entstand durch »ein wenig unbeholfenes Gefummel« mit einer Freundin neues Leben: der kleine Will. War es nicht folgerichtig, dass das Schicksal so einem Pechvogel auch noch eine kleine Eisplatte auf der Landstraße unterschiebt, um ihm Liz, die wichtigste Person in seinem Leben, für immer und ewig zu entreißen?
Nun ist Danny noch keine dreißig, und sein Unglück setzt sich fort. Ohne Liz an seiner Seite fehlen ihm Halt und Disziplin. Sein ungepflegtes Äußeres spricht Bände. In der Küche türmen sich unbezahlte Rechnungen. Die Zimmerpflanzen sind längst verdorrt. Die Wohnung versinkt im Dreck. Der Vermieter hat ihm gekündigt. Sein Arbeitgeber hat ihn gefeuert.
Das alles aber setzt ihm nicht so sehr zu wie die Angst, seinen kleinen Sohn Will zu verlieren. Der saß an dem Schreckenstag ein Jahr zuvor mit Liz im Auto, erlebte den Crash mit, sah sie am Unfallort sterben. Seither ist er schwer traumatisiert und hat kein Wort mehr gesprochen (»selektiver Mutismus«).
Obwohl Dannys Gefühlswelt völlig aus dem Lot, sein Herz zerrissen ist, lässt er sich in Wills Beisein nichts anmerken. Er plaudert mit ihm wie immer, auch wenn Antworten ausbleiben. Schlimmstenfalls schweigen sich die beiden schon beim Frühstück an.
Will hat sich in den Schutz eines Schneckenhauses zurückgezogen. Er hat nur einen einzigen Freund: Mohammed ist ebenfalls elf, pummelig, trägt eine dick umrandete Brille und hat Hörgeräte in beiden Ohren. In der Schule sind die beiden als »Loser« auserkoren (»Dumm und dümmer. Oder eher taub und stummer?«) und müssen immer mit frechen Sprüchen und Prügeln rechnen. Vor allem das gefürchtete Trio Mark (»mit Abstand der Kleinste, [aber] als größter Terrorist der Richmond Highschool verschrien«), Gavin (so picklig, »dass sein Kopf mehr Eiter als Hirn enthielt«) und Tony setzt ihnen bei jeder Gelegenheit zu.
Dannys vordringlichstes Problem ist freilich, irgendeinen neuen Job zu finden. Wählerisch kann er nicht sein, denn um einen Mann ohne jegliche Ausbildung, dessen Lebenslauf auf ein Post-it passt und dort noch genügend Platz für Notizen lässt, reißen sich die Headhunter nicht gerade. Wie er einmal wieder demoralisiert auf einer Parkbank sitzt und im Handy Stellenanzeigen verwirft (»Erfahrung vorausgesetzt«), fallen ihm all die One-man-shows auf, die er schon des öfteren mit Will angeschaut, aber nie wirklich beachtet hat. Jetzt registriert er, dass die Künstler keineswegs mit herausragendem Talent brillieren, sondern lediglich unkoordiniert mit ihren Gliedmaßen herumhampeln oder sich albern verkleiden und »total zum Narren machten«. Das hält die flanierenden Menschen freilich nicht davon ab, sich begeistert um sie zu scharen, sie zu filmen und ihnen anerkennend Geld zuzuwerfen. Bei Danny fällt der Groschen: Schließlich beschwert doch auch ihn kein Talent, und in dem Laden, wo er sich unlängst einmal um eine Stelle beworben hatte (vergeblich), gibt es billige Kostüme. Nazi-Uniform (»Prinz Harry war einmal hier«) und Boris-Johnson-Outfit erscheinen ihm trotz attraktiven Minipreises zu provokant. Das Panda-Fell ist dagegen unverfänglich, wenngleich es ein wenig traurig dreinschaut und sein Geruch auf den unverdauten Mageninhalt seines letzten Entleihers verweist.
Wie die anrührende Vater-Sohn-Geschichte ausgeht, wird jedem Leser spätestens jetzt klar sein, ohne dass noch mehr angedeutet zu werden braucht. Doch gemach, zwei Drittel der bedruckten Seiten liegen noch vor uns, und darauf schreitet die Handlung nicht direkt zielführend, sondern mäandernd voran, und dabei sinkt leider auch das inhaltliche Niveau.
Anfangs überzeugt die Story durch ihre liebenswerten Haupt- und Nebenfiguren, die mit einer guten Prise Humor der leiseren Töne gegen Trauer, Melancholie und Antriebslosigkeit ankämpfen. Situationskomik und flotte Sprüche passen gut dazu. Später driftet der Plot in die Nachtclubszene ab, drei derbe ukrainische Schlägertypen kommen ins Spiel, das Sprachniveau sackt ins Ordinäre, und all dies fällt irgendwie aus dem ansonsten schlichten, betulichen Rahmen.
»Keeping Mum«  , Debütroman des britischen Autors James Gould-Bourn (1982 in Manchester geboren), ist amüsant und unterhaltsam, literarisch aber anspruchslos (Stephan Kleiner hat es übersetzt). Seine erzählerische Strategie ist leicht durchschaubar, der Stil flach. Unbestritten ist dessen ungeachtet sein Potenzial der aufheiternden, vielleicht tröstenden Wirkung auf Leser, die ähnlich dem Protagonisten leiden und trauern.
, Debütroman des britischen Autors James Gould-Bourn (1982 in Manchester geboren), ist amüsant und unterhaltsam, literarisch aber anspruchslos (Stephan Kleiner hat es übersetzt). Seine erzählerische Strategie ist leicht durchschaubar, der Stil flach. Unbestritten ist dessen ungeachtet sein Potenzial der aufheiternden, vielleicht tröstenden Wirkung auf Leser, die ähnlich dem Protagonisten leiden und trauern.
 · Herkunft:
· Herkunft: