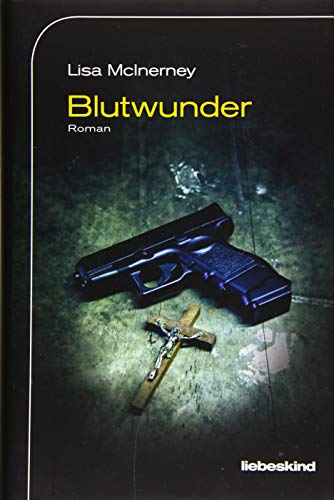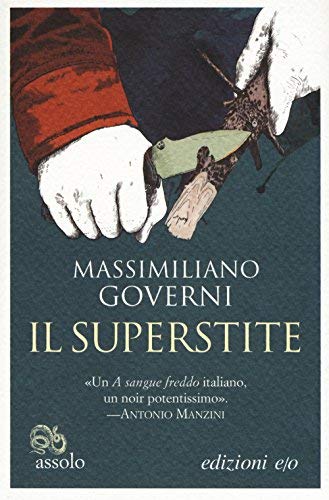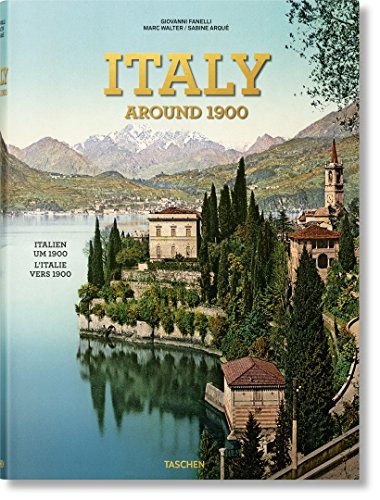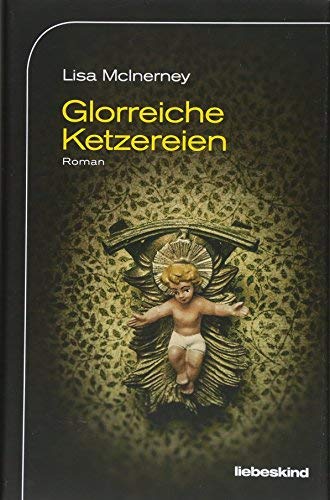
Glorreiche Ketzereien
von Lisa McInerney
Wie ein Gegenbild zu sämtlichen Klischees irischer Tourismuswerbung schildert die Autorin ein deprimierendes Stadtmilieu der Hoffnungslosigkeit, der Gewalt und des Verbrechens. Aber wie sie erzählt, das ist ein Erlebnis!
Der Hölle näher als dem Himmel
Als Sweary Lady betrieb Lisa McInerney ein paar Jahre lang einen Blog namens Arse End Of Ireland, was in etwa das bedeutet, was man auch ohne Englischkenntnisse vermutet. Was die 1981 geborene Irin unter der despektierlichen Überschrift notierte, kann man sich ebenfalls unschwer denken (leider nicht mehr nachschlagen): Sicher zeichnete sie deftige Szenen aus ihrem Land. Ihr Talent fiel auf, der Landsmann Kevin Barry (»Dunkle Stadt Bohane« [› Rezension]) bestärkte sie in ihrer Entschlossenheit, Schriftstellerin zu werden, und tatsächlich reüssierte sie 2015 mit einem Roman: »The Glorious Heresies«  . Darin schlugen sich die Geläufigkeitsübungen des Bloggens nieder – in der Vielfalt seiner Themen, der ungezwungenen Lockerheit des frischen Stils, dem Spiel mit mehreren Genres –, so dass der Erstling gleich den Baileys Women’s Prize for Fiction und den Desmond Elliott Prize erhielt. Werner Löcher-Lawrence hat ihn jetzt ins Deutsche übersetzt.
. Darin schlugen sich die Geläufigkeitsübungen des Bloggens nieder – in der Vielfalt seiner Themen, der ungezwungenen Lockerheit des frischen Stils, dem Spiel mit mehreren Genres –, so dass der Erstling gleich den Baileys Women’s Prize for Fiction und den Desmond Elliott Prize erhielt. Werner Löcher-Lawrence hat ihn jetzt ins Deutsche übersetzt.
»Glorreiche Ketzereien« ist ein durch und durch irischer Roman – wenn man sich an dem Mosaik orientiert, das Film und Literatur der letzten Jahrzehnte zusammengefügt haben. Dominante Faktoren des irischen Alltags sind demnach der konservative Katholizismus und die allmächtige Kirche, Bigotterie und Sentimentalität, Verrohung und Gewalttätigkeit, Geringschätzung der Frauen (missbraucht, unehelich geschwängert, verachtet, verprügelt und verlassen), erbärmliche Lebensbedingungen und Chancenlosigkeit, fehlender Respekt vor dem Gesetz und ein rebellischer Geist, Anfälligkeit für Alkohol und Drogen. Von all dem sind McInerneys Figuren geprägt: Prostituierte, Schläger, Säufer, Zuhälter, Drogendealer und andere Kriminelle bilden ein verwahrlostes Milieu von kaum zu unterbietender Tristesse. Angesiedelt ist es in Cork, der Hafenstadt im Südwesten Irlands.
Die Handlungsführung suggeriert Perspektivlosigkeit, denn die Verhältnisse bestehen im Kern schon seit Langem so, und Schicksalsmuster wiederholen sich. So verlief der soziale Absturz der jungen Maureen in den 1960er Jahren nicht anders als der der jungen Georgie fünfzig Jahre später: Maureen wurde unehelich geschwängert, als Sünderin geächtet, musste ihr Baby weggeben, zog nach London, wo niemand von ihrer Schande wusste, schlug sich einsam und riskant durch, verhärtete.
Was in der Realität schier zum Verzweifeln bringen muss, ist auch in seiner fiktionalen Verarbeitung schwer hinzunehmen. Nicht nur die Handlungsweisen, sondern auch der obszöne Sprachjargon und die abstoßenden Sexpraktiken, die unverkrampft, ungeschönt und detailreich beschrieben werden, machen die Lektüre zum Hindernislauf. Was dann doch weitertreibt und tatsächlich für ein außergewöhnliches Leseerlebnis sorgt, ist McInerneys souveränes Erzählen, das den schweren Tobak durch Leichtigkeit, ironische Distanzierung, prägnante Pointen, Humor und Poesie genießbar macht.
Mit einem folgenschweren Einbruch bei der unlängst nach Cork zurückgekehrten Maureen nimmt die Handlung ihren Lauf. Die rabiate Sechzigjährige bemerkt, wie ein Kleinganove in ihr Haus einsteigt. Mit dem nächstbesten Objekt zieht sie ihm eins über den Schädel. Ihn zu töten lag ihr fern, dennoch ruht der Mann nun auf ihrem Küchenboden hingestreckt in seinem Blut. Sein Weg dorthin, glaubt Maureen, war vorgezeichnet, er hätte »sein natürliches Verfallsdatum« nie erreicht. Mit dem unbeabsichtigten Tötungsakt fällt der erste Dominostein – er wird viele weitere stürzen, und die Schaden sind groß.
Da Maureen es nicht so hat mit Aufräumen und Putzen, beauftragt sie ihren Sohn Jimmy mit Leichenentsorgung und Tatortreinigung. Der hat die gesamte kriminelle Unterwelt des Viertels unter Kontrolle und für derlei Drecksarbeit seine Leute. Tony Cusack, 37, sein Kumpel aus Londoner Tagen, soll den Job erledigen. Allerdings ist der mit jeglicher Aufgabe restlos überfordert, inklusive der des Alleinerziehers seiner sechs Kinder. Das Elend seines permanenten Versagens, das er im Alkohol zu ersäufen sich bemüht, nährt seinen Hass auf alles und jeden, und den lässt er vor allem an seinem ältesten Sohn Ryan aus.
Mit diesem geprügelten Hund und Sündenbock kommt eine Zentralfigur ins Spiel, deren Coming of Age ein Kernmotiv des Romans ist. Ryan, 15, ist ein guter Schüler, ein hochtalentierter Klavierspieler (leider verscherbelt sein Vater das Instrument an Jimmy Phelan, der ein Statussymbol nötig hat), und er hat eine Freundin aus gutem Hause, mit der er von einer gemeinsamen Familie träumt. All dies nützt ihm nichts. Denn an ihm klebt auch der Ruf, er sei ein »kleiner Dreckskerl«, ein missratener Sohn, der seinen Vater in Wahnsinn und Sucht treibt. (Dass die Dinge andersherum liegen, könnten Lehrer und Sozialarbeiter an seinen Hämatomen ablesen, doch sie ignorieren sie.) Tatsächlich ist der Junge ein gewiefter Drogendealer und wird nicht ohne Grund zu neun Monaten Jugendknast verurteilt.
Der als nächster involvierte Dominostein heißt Georgie. Unter dem Einfluss ihres Freundes Robbie O’Donovan verkaufte sie schon als Fünfzehnjährige ihren Körper und finanzierte damit ihre Drogen (die sie von Ryan bezog). Nachdem Robbie überraschend von der Bildfläche verschwand, konnte sie sich von der Prostitution lösen. Bei einer christlichen Sekte findet sie Geborgenheit und Nächstenliebe, muss sich aber keusch kleiden und ausgerechnet in ihrem eigenen Viertel Haustürmission betreiben. Dabei erfährt sie zufällig etwas über ihren lange verschollenen Freund …
Dieses aus unterschiedlichen Perspektiven erzählte Geflecht aus diversen Figuren und Handlungsfäden, die einen Zeitraum von etwa fünf Jahren umspannen, hängt alles irgendwie mit allem zusammen – Teufelskreise, aus denen sich keine Auswege eröffnen wollen. Ausbruchsversuche verpuffen bestenfalls mit einem Knall oder kollabieren zum Schaden der Verzweifelten. Maureen fackelt in innerer Auflehnung gegen die Allmacht der katholischen Kirche und ihrer Priester eine kleine Kirche ab. Georgie kehrt der christlichen Gemeinschaft nach zwei Jahren enttäuscht den Rücken, nachdem sie niemand in ihrem Kampf um ihr Baby unterstützte. Was blieb ihr, als wieder anschaffen zu gehen, wenn sie Geld verdienen und ihr Kind jemals wiedersehen wollte? Die Verhältnisse ändern zu wollen erscheint so unsinnig wie »gegen den Himmel zu Felde ziehen und Gottes Abdankung verlangen«.
Aus dem kleinen Ryan ist nach der Haftzeit ein Großer geworden. Trotz seiner Anlagen und entgegen seinen guten Vorsätzen ist er ein »Arschloch« geworden: ein Krimineller, ein untreuer Partner seiner großen Liebe. Jimmy, der einst allmächtige »König des Viertels«, kann Ryan nicht mehr beeindrucken.
Wenngleich die Autorin ihre Leser an die Grenzen des guten Geschmacks führt und ihre Figuren durch ein deprimierendes, instinktgetriebenes, hilfloses Leben voller Sehnsucht, aber ohne Hoffnung stolpern lässt, ist ihre Milieustudie aus der irischen Unterschicht doch absolut empfehlenswert. Von Lisa McInerney werden wir noch mehr hören, denn sie hat insgesamt drei Cork-Romane geplant. 2018 erschien der zweite (»The Blood Miracles«, umgehend mit dem Encore Award geehrt), und eine TV-Serie soll folgen.
 · Herkunft:
· Herkunft: