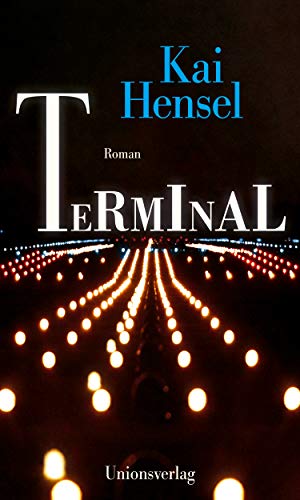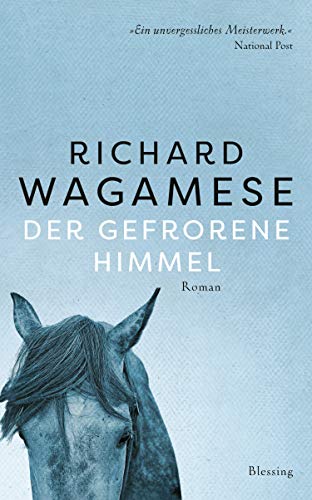Die Harpyie
von Megan Hunter
Eine musterhafte Ehefrau und Mutter wird in ihrem traditionellen Rollendasein jäh erschüttert und wandelt sich in eine Rachefurie.
Der Mythos lebt
Was in aller Welt ist eine »Harpyie«? Der Begriff wurzelt in der griechischen Mythologie und hat, wie es scheint, mit unserer Realität nicht mehr viel zu schaffen. Doch beim Nachforschen erfährt der Suchende, dass die Vorstellung, die in dem Fabelwesen Gestalt findet, in unseren Köpfen durchaus präsent ist. Als Mischwesen mit Raubvogelkörper und gelocktem Frauenkopf sind sie den Betrachtern mittelalterlicher Kirchenfassaden, Kreuzgang-Kapitelle und Renaissance-Paläste zumindest optisch vertraut. Die altgriechischen Harpyien waren schnell, stark, wild und unverwundbar, mal schön, mal abstoßend dargestellt, jedenfalls gleichermaßen faszinierend und bedrohlich, und sie erledigten im Auftrag der Götter unangenehme Aufgaben wie in Ungnade Gefallene ins Totenreich zu befördern und Rache zu üben. In Südamerika trägt ein riesiger Greifvogel diesen Namen, und erstaunt registrieren wir, dass Harpyien sogar noch als leibhaftige Figuren in Internet-Serien, Filmen und Literatur unserer Tage auftreten und durch ihre bloße Erscheinung düstere Assoziationen aus unserem Unterbewussten erwecken.
Nun hat die britische Autorin Megan Hunter (1984 in Manchester geboren) das steinalte Motiv zum Titel eines Romans gemacht (»The Harpy«  ) und damit eine moderne Frauengeschichte gewaltig aufgeladen. Schon das Cover (der englischen wie der deutschen Ausgabe) verwundert und verstört erst einmal. Der Kern des Plots ist geradezu trivial (die Rache einer betrogenen Ehefrau), der evozierte Überbau umso düsterer, archaischer. Die sprachliche Gestaltung (kongenial von Ebba D. Drolshagen ins Deutsche übersetzt) fügt starke poetische und märchenhafte Töne hinzu, während sich die Handlung mit höchst zeitgemäßen Themen auseinandersetzt. Kann diese Mischung gutgehen?
) und damit eine moderne Frauengeschichte gewaltig aufgeladen. Schon das Cover (der englischen wie der deutschen Ausgabe) verwundert und verstört erst einmal. Der Kern des Plots ist geradezu trivial (die Rache einer betrogenen Ehefrau), der evozierte Überbau umso düsterer, archaischer. Die sprachliche Gestaltung (kongenial von Ebba D. Drolshagen ins Deutsche übersetzt) fügt starke poetische und märchenhafte Töne hinzu, während sich die Handlung mit höchst zeitgemäßen Themen auseinandersetzt. Kann diese Mischung gutgehen?
Lucy, die Protagonistin und Ich-Erzählerin, ist Mitte 30 und Gemahlin des Universitätslehrers Jake Stevenson. Das gut situierte Paar wohnt mit den beiden Söhnen in einer englischen Kleinstadtidylle. Ihre eigenen akademischen Ambitionen als Altphilologin hat Lucy aufgegeben, um ihr Glück in der Rolle als Hausfrau und Mutter zu finden. Obwohl auch ihre Mutter so gelebt hat, hat sie sich nicht gedrängt gefühlt, den gleichen Weg zu gehen. Sie empfindet es als sinnvollen Lebenszweck, die Termine ihrer Kinder und der Familie zu organisieren, den Haushalt in Ordnung zu halten, für Mann und Kinder verfügbar zu sein. In ihrem traditionell definierten Dasein geht sie auf, wähnt sich erfüllt und glücklich.
Was wie ein Klischee anmutet, wird durch ein weiteres abgeräumt. Professor David Holmes, ein Kollege von Jake, ruft Lucy an und sagt nicht viel mehr als »Ihr Ehemann schläft mit meiner Frau. Ich meine, dass Sie das wissen sollten.« Lucy treffen die Wörter wie »Atomzertrümmerer, ein wissenschaftliches Experiment, das die Zusammensetzung des Universums veränderte«. Während ihre innere Balance ins Trudeln gerät, triggert ihre Selbstdisziplin bewährte stabilisierende Verhaltensroutinen. Wie, fragt sich Lucy, würde die Heldin eines Films auf solch eine Nachricht reagieren? Konzentration auf die Zubereitung des Abendessens! Gesicherte Gesten, die schon die Mutter vormachte (die Zitrone mit der Faust umklammern, die Nägel hineingraben, quetschen, bis sich »der Kiefer verkrampfte«, das Gesicht hässlich verzerrt). Aber ihre Realität verschwimmt, das Zerteilen der Hühnerbrust fällt schwer, die Gedanken schweifen und bündeln sich in der Definition ihres neuen Ichs: »eine Frau, deren Mann eine Affäre hat«. Als plötzlich ihr Sohn in der Tür steht, kann sie sich für ihn wieder fassen, bringt ihn in sein Bett zurück, singt die Jungs in den Schlaf.
Jake kommt wie so oft verspätet nach Hause (»Zug verpasst«). Er registriert Lucys Unruhe (»Etwas in mir brach aus der Verankerung … Als habe sich ein Organ losgerissen, um entwurzelt durch meinen Körper zu treiben.«), bringt ihr ein Glas Wasser, mimt Anteilnahme (»Wie war dein Tag?«). Lucys kompakte Aufklärung (»das mit dir und Vanessa«) quittiert er allerdings nicht etwa mit der Reue des Ertappten, sondern mit blanker Wut auf den Gehörnten. Während er über die nächsten Tage hin Empathie heischt (»weinend auf dem Küchenboden«), zusammenbrechend Schuld bekennt (»es tut mir unendlich Leid«), die Affäre zu beenden verspricht, setzt Lucys Wandlung ein. Angewidert wird sie zu einer »scharfkantigen Kreatur«, einer Tarantel. Schlimme Erinnerungen an ihren schluchzenden Vater und die zerrüttete Ehe ihrer Eltern befeuern ihre Wut, und sie verurteilt Jake, seine Nächte fortan auf »dem gottverdammten Sofa« zu verbringen. Jake, ganz einsichtig, bietet an, wenn es ihr helfe, könne sie ihn »auch verletzen … Wie oft? Drei Mal?«, und an dieser Racheoption findet Lucy Gefallen. Die »Struktur hatte etwas Religiöses«.
Als die Romanhandlung einsetzt, vollzieht sich bereits »Das letzte Mal.« Die beiden haben sich »auf einen winzigen Schnitt geeinigt«. Mehr sei hier nicht verraten, zumal die drei Strafaktionen nicht die Hauptsache in diesem bemerkenswerten Buch sind. Vielmehr geleitet uns Megan Hunter mit dem inneren Monolog ihrer Protagonistin – eine Kette sehr kurzer, teils Handlung berichtender, teils introspektiver, teils reflexiver Abschnitte – durch die eigenartige Metamorphose einer Frau, die aus ihren konventionellen Rollen auf ganz unkonventionelle Weise ausbricht, sich ihrer Umgebung entfremdet, schließlich einem Raubvogel gleich ihre Flügel entfaltet. Das ist auf mehreren Motivebenen vielschichtig und fantasievoll konzipiert, dazu einfühlsam gestaltet und amüsant, auch süffisant formuliert und lässt uns Lesern viel Spielraum für eigene Deutungen.
Ist Lucys Selbstverständnis zum Beispiel fremdbestimmt, wurden ihre Rollen ihr aufoktroyiert? Tief sitzen die Erlebnisse der aggressiven Streitereien ihrer Eltern. Ganz im Einklang mit der bürgerlichen Fassade ihrer Ehe fragt sie sich »Bin ich eine gute Frau?«, bezieht sich dabei auf biblische Bilder (»edler denn die köstlichsten Perlen«) und weiß gleich, »dass ich das nicht bin.« Andererseits lehnte sich schon ihre Urgroßmutter gegen alle Konventionen und weibliche Rollenmuster auf. Könnte die Wut im Bauch der »Suffragette« nicht als »Parasit« durch alle Gebärmütter der folgenden Generationen bis zu Lucy weitergelebt haben?
Jedenfalls entfesselt sich die Partnerschaft zwischen Lucy und Jake radikal. Erst wird Lucy noch von der Wut darüber beherrscht, hintergangen, gedemütigt worden zu sein, dann greift das Harpyienwesen in ihr um sich. Dabei spielen eingeschobene kursiv gedruckte Passagen eine Schlüsselrolle: Blitzlichter in Lucys Kindheit, als sie eine Art Vogelkunde-Buch zu faszinieren begann, insbesondere die Abbildungen der Harpyien: »Ich wollte wissen, warum ihre Gesichter so waren: eingefallen, hasszerfressen.« Im Studium begegnet sie dem geflügelten Mischwesen als mythologische Figur, studiert ihre Rollen: »Männermörderin. Monstrosität. […] Perfekter Körper, Vogelfüße. Angst einflößend. Verführerisch«. Sie »reißt Augen aus, zerrt, versengt, kratzt, verkrüppelt […] auf Anweisung der Götter, aber nicht widerwillig [, sondern] mit leuchtenden Augen.« »Sie wurde zum Inhalt meiner Tage«, bis Lucy sogar eine körperliche Verwandlung an sich bemerkt: »Mein Gesicht sank ein, meine Nase wurde spitzer, meine Stirn niedriger.«
Der Roman schließt mit einer fantastischen Metamorphose, die nicht absurd oder lächerlich wirkt, sondern folgerichtig. Die vorausgegangene konsequente Perspektive mit ihrer Mischung aus Realität und Traumwelt, aus Mythologie und Gegenwart, aus innerem Monolog und prägnanten Dialogen hat uns mit behutsam steigender Spannung genau dort hingeführt.
 · Herkunft:
· Herkunft: