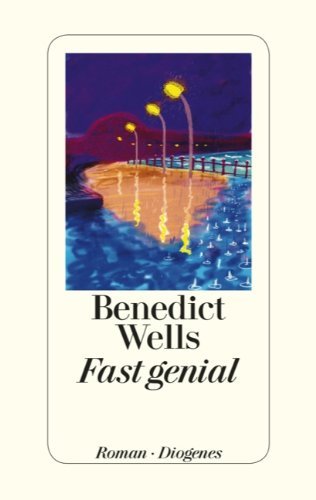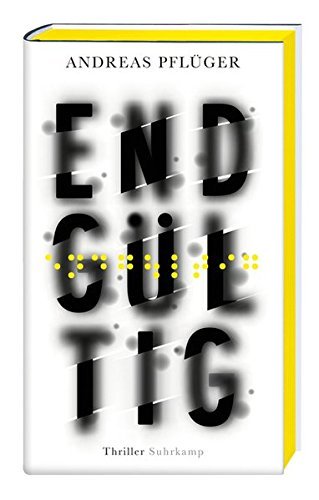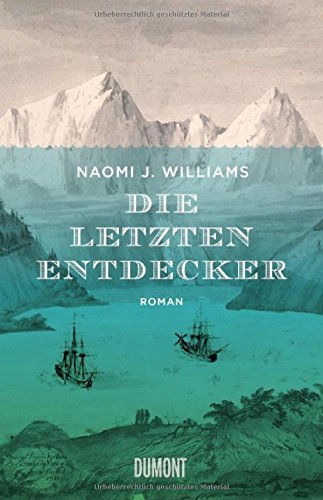Die Suche nach dem Konstanten
»Ich kenne den Tod schon lange, doch jetzt kennt der Tod auch mich.« Ein wuchtiger Romananfang von einem Jungautor. Kann ein Zweiunddreißigjähriger die Last stemmen, die der Satz mit all seinen Implikationen ihm vorlegt? Benedict Wells kann. Das hat er schon mit seinen drei Vorgängerbüchern bewiesen. »Vom Ende der Einsamkeit«, nach fünf Jahren Romanpause und sieben Jahren Arbeit erschienen, ist ein ausgereiftes, großartiges Werk – der Roman eines Lebens, einer Familie, einer Liebe, der gewichtige Fragen von philosophischer Tiefe behandelt und eine gute Geschichte erzählt und dazu einen individuellen, sensiblen, literarisch-ästhetisch befriedigenden Stil findet, der das Lesen zum Vergnügen macht und den Leser wie in einem Sog weiterzieht bis zur letzten Seite.
»Was wäre das Unveränderliche in dir? Das, was in jedem Leben gleich geblieben wäre, egal, welchen Verlauf es genommen hätte?« Noch so eine wuchtige Überlegung für grauhaarige Weise über das Wesen des Menschen an sich. In Wells' Buch richtet Ich-Erzähler Jules, 41, die Frage an Alva, seine langjährige große Liebe und engste Vertraute seit der Schulzeit. Doch der Autor hat ihnen kein einfaches Glück beschert, sondern sie auf verschlungenen Pfaden und die meiste Zeit getrennt durchs Leben geschickt. Nichts auf ihren Wegen war voraussehbar, beeinflussbar, hatte System. Vielmehr wechselten Trennung und Zusammenfinden, Einsamkeit und Geborgenheit, Glück und Unglück einander wie zufällig ab. Das lässt in Jules' Rückschau in der Mitte des Lebens die Frage aufkommen, ob es einen konstanten Kern im Menschen gebe – »Dinge in einem, die alles überstehen«.
Die Erzählung beginnt am Ende, in der Gegenwart (September 2014). Nach einem schweren Motorradunfall und zwei Tagen im Koma kehrt Jules Moreau im Krankenhaus ins Leben zurück und rekonstruiert in Episoden seinen eigenen Lebensweg und den seiner beiden Geschwister Marty und Liz.
Ihre Kindheit war beneidenswert unbeschwert und gut behütet. Jules erinnert sich an eine Familienreise 1980 zur Großmutter in die südfranzösische Heimat des Vaters. Zu Weihnachten 1983 – da war er zehn, Marty dreizehn und Liz vierzehn – schenkte ihm sein Vater eine gebrauchte, verkratzte Mamiya-Kamera, was das Kind enttäuschte und doch ein (späteres und vorübergehendes) Interesse am Fotografieren säte. Beide Ereignisse verbindet eine Eigenschaft: Sie waren letzte gemeinsame Unternehmungen der Familie. Wenige Tage nach dem Fest sterben die Eltern bei einem Autounfall.
Die drei Waisen werden in einem Internat aufgenommen, aber getrennt untergebracht und sehen einander nur noch selten. Der Schicksalsschlag – »ein nicht korrigierbarer Fehler im System« – erscheint ihnen wie eine Weiche auf ihrem Lebensweg, an der sie falsch abgebogen sind und ab der sie ein »falsches Leben« führen. Wiewohl vereint im Schmerz um den Verlust der Eltern, driften sie mehr und mehr voneinander weg. Jedes Kind muss die Not des einsamen Zurückgelassenseins für sich allein verarbeiten, ist gezwungen, sich allein mit der »Endlichkeit des Lebens« auseinanderzusetzen, kämpft für sich allein um einen Ausweg.
Seine Schwester Liz liebt Jules über alles. Seit Kindesbeinen genießt sie es, im Mittelpunkt zu stehen und sich zu inszenieren – als Prinzesschen, als Frühreife, als Wildfang, als trostbedürftiges Elfchen, als Künstlerin. Die Mutter spielt gerne mit, die Mitschülerinnen weniger. Sie verlachen und ärgern sie. Im Internat entwickelt sie enormes Selbstbewusstsein. Auffallend groß und attraktiv, beherrscht sie mit siebzehn ihr Repertoire, gibt mal die »Königin«, mal die Revoluzzerin, mal die Emanze. Sie erntet Bewunderung, nicht Zuneigung. Ehe sie wegen allzu arger Unverschämtheiten der Schule verwiesen wird, schmeißt sie ihr Abitur und verschwindet dann für Jahre aus Jules' Leben.
Ihren Bruder Marty empfanden Liz und Jules als »widerlichen Freak«, als »Fremdling ... zwischen uns«. Er sondert sich von der Familie ab, seziert in seinem Kinderzimmer tote Kleintiere und steht für Jules' Wunschträume von einem heldenhaften Beschützer-Bruder nicht zur Verfügung. Erst recht nicht mehr im Internat. Als Jules einmal böse gedemütigt wird und lautstark nach Marty ruft, bleibt dessen Zimmertür verschlossen. Nichts scheint ihn rühren zu können, weder der Verlust der Eltern noch die Zustände im Internat – »eine Ameise, die nach einem Atomkrieg unbeirrt weitermachte«. Nach außen stilisiert er sich als intellektuell, cool und abweisend: schwarze Kleidung, Brille auf der Hakennase, langes Haar zum Zopf geknotet. Mädchen haben für die »existentialistische Vogelscheuche« nichts übrig. Stattdessen führt er mit sechzehn eine »Schattenarmee« von »Nerds und Klugscheißern«.
Auch Jules, als Kind selbstbewusst, übermütig, abenteuerlustig und mutig, zieht sich nach dem familiären Schnitt in seine Gedankenwelt zurück, entwickelt nie gekannte Ängste »vor dem Dunkeln, vor dem Tod, vor der Ewigkeit«. In der Klasse verkriecht er sich in die hintere Bank, wo er nicht aufzufallen hofft.
Eben dort nimmt eines Tages ein geheimnisvolles Mädchen namens Alva auf dem freien Stuhl neben ihm Platz. Sie hat auffallend rotes Haar und trägt eine Hornbrille im hübschen blassen Gesicht. Schweigsamkeit und düsterer Blick machen sie schwer durchschaubar, aber Jules erscheint sie seelenverwandt, als hüte sie im Verborgenen ein Leid vor den anderen. Er verliebt sich in ihr rares Lächeln und ihren »schiefen Schneidezahn«, der vorwitzig hervorlugt. Als Sehnsuchtsziel und große Liebe wird Alva sein ganzes Leben bestimmen.
Die hindernisreiche love story ist jedoch nur eine Façette dieses Buches. Interessanter ist die Familiengeschichte, eine Art Entwicklungsroman der seelisch verletzten Geschwister, der dem Protagonisten psychologische, philosophische und existentielle Fragen auftischt. Es geht um Erinnern und Vergessen, Zufall und Bestimmung, Endlichkeit und Dauerhaftes. Um den irreparablen Systemfehler in ihrer Vita wenigstens zu kompensieren, suchen die Geschwister den Weg zu ihrer Identität, wollen Vertrauen ins Leben und in die Liebe zu anderen Menschen wiedergewinnen. Ihr beruflicher Erfolg gibt ihnen äußere Sicherheit und Selbstbewusstsein. Aber offenbar kommen sie nicht wirklich bei sich selbst an.
Marty ist am Ende des Romans Dozent an der Universität München und wirkt abgeklärt. Doch ein Bündel von manierierten Ticks und Obsessionen verrät, dass ihn noch immer Ängste vor Verlust und Schicksalsschlägen quälen. Liz hat die heftigste Jagd nach dem Glück hinter sich, unruhige Jahre mit Alkohol, Drogen und unverbindlichen Männerbeziehungen. Jetzt scheint sie sich als Gymnasiallehrerin gesetzt zu haben. Doch sie ist weder bindungsfähig noch mit einem geregelten, harmonischen Alltag zufriedenzustellen. Ihr Kern verlangt weiterhin nach einem pulsierenden, verrückten Leben und außergewöhnlichen Menschen, solchen, »die brennen, brennen, brennen, wie römische Lichter in der Nacht« (Jack Kerouac).
Jules, inzwischen Lektor in einem Münchner Verlag, hat Alva zwar auf allerlei Umwegen endlich wiedergefunden und erlebt mit ihr und den gemeinsamen Zwillingstöchtern eigenes familiäres Glück. Dennoch lastet auch auf ihm bleischwer das Bewusstsein um die abgeschnittenen Leben seiner Eltern, um die der Familie vorenthaltenen Jahrzehnte miteinander, während die zu kurze gemeinsame Zeit zu starren Episoden versteinert oder sich in bloßem Gefühl entkonkretisiert. Er weiß auch, dass die späte Erfüllung mit Alva und den beiden Kindern keine vom Schicksal gewährte Kompensation für Unordnung und frühes Leid ist. Er darf also nicht auf Dauer des Zustandes, auf nachhaltige Gerechtigkeit hoffen, muss jederzeit mit erneutem Verlust rechnen. Der tief verwurzelten, beklemmenden Grundangst versucht er sich mit einer Therapie zu stellen.
Gibt es wirklich »Leute, die nur Pech haben, die alles, was sie lieben, nach und nach verlieren«? Und wenn Jules, wie es scheint, zu ihnen gehört, gibt es einen Grund dafür – sei es Schicksal, Zufall, Bestimmung, Ungerechtigkeit, Pech? Als er Alva wieder abgeben muss, verzweifelt er, droht in seiner erneuten Einsamkeit unterzugehen. Jetzt aber trägt ihn die Geborgenheit unter seinen ungleichen Geschwistern. Als Erwachsene haben sie gelernt, Verständnis füreinander aufzubringen und einander emotionalen Halt zu geben. Denn »die Einsamkeit in uns können wir nur gemeinsam überwinden«.
Aus den tragischen Ereignissen in Jules' Leben, den daraus entstandenen Ängsten und Erkenntnissen der eigenen Machtlosigkeit erwächst ihm schließlich eine überraschend zuversichtliche, konstruktive Haltung: dass nämlich »in Wahrheit nur ich selbst der Architekt meiner Existenz bin«. Mit hoffnungsvollem Blick nach vorn statt zurück ist er »bereit«, Entscheidungen über seinen weiteren Weg zu treffen, Verantwortung für seine Kinder zu übernehmen – ein Leben zu gestalten, das gar nicht mehr so »falsch« erscheint. Ein schönes Bild verknüpft den hoffnungsvollen Anfang von Jules' Leben mit dem ebenfalls hoffnungsvollen Neubeginn am Ende des Romans. In beiden Situationen balanciert Jules wagemutig auf einem glitschigen Baumstamm über einen Fluss voller gefährlicher Gesteinsbrocken. Als Junge bewährt er sich selbst, indem er seine Angst überwindet. Als Erwachsener inszeniert er einen »Moment der Saat«: Der Vater setzt seinen Kindern ein Beispiel, um sie zu stärken, damit sie ihre »Angst für immer verlieren«.
In der Gesamtschau kann man anmerken, dass der Autor seine Botschaft vielleicht ein wenig näher am Alltagsleben hätte illustrieren können, ohne dass das zu Einbußen geführt hätte. Seine Figuren sind gesuchte Charaktere, ihre Schicksale heftig (»Mein lieber Hiob«, tröstet Alva ihren Jules.). Eine leicht melancholische Grundstimmung prägt sie, doch niemals überkommt sie zerstörerisches Selbstmitleid oder Jammern. Benedict Wells ist ein schönes, ein aufbauendes Buch gelungen.
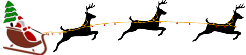 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: