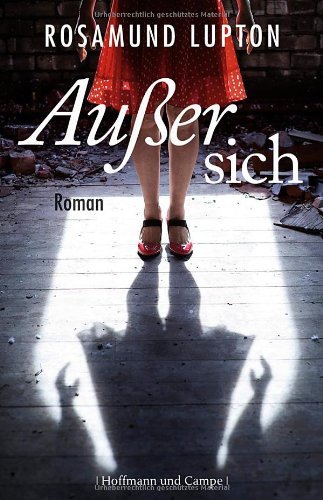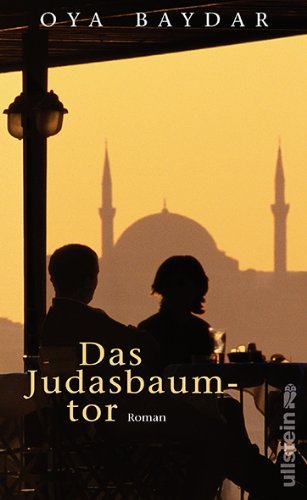
Ein Land frisst seine Kinder
Ist es Zufall oder eher Schicksal, dass ausgerechnet diese vier Menschen in Istanbul zusammentreffen? In einem Zeitraum von zwei Jahren werden sich ihre Wege immer wieder kreuzen. Sie werden sich gegenseitig beeinflussen, zeitweise eine sehr enge Beziehung zueinander aufbauen, um am Ende wieder auseinanderzugehen.
Das Judasbaumtor des Titels war - so heißt es - ein Teil der Stadtmauer Istanbuls aus ihrer byzantinischen Phase. Für eine der vier Personen ist es das konkrete Objekt einer wissenschaftlichen Suche, aber Sinn gebend steht es zugleich für alle. Die Suche nach dem Tor symbolisiert die Suche nach ihren Wurzeln, ihrer Bestimmung, ihrer Identität.
Teo, 1960 geboren, stammt aus einem griechischen Elternhaus. Als die Griechen ab 1974 in der Türkei nicht mehr gelitten waren, verließ die Familie das Land. Teo studierte Kunst und Geschichte mit Schwerpunkt Byzanz und lebt in Amerika. An Politik ist er nicht sonderlich interessiert; von der Vertreibung seiner Familie weiß er wenig, und welches Fähnchen im Jahr 2000 in der Türkei weht, interessiert ihn nur peripher. Es ist die Entschlüsselung einer alten byzantinischen Handschrift, die ihn nach Istanbul führt. Auf einem Pergament, dessen Entstehungszeit um 1000 n.Chr. vermutet wird, steht ein Gedicht mit den ebenso poetischen wie geheimnisvollen Zeilen "Um die verlorene Seele der Stadt zu retten, / schreitet er durch ein geheimes verfallenes Tor, / das Judasbaumtor, / auf seinem Haupt die Krone aus purpurnen Judasblüten, / gewandet in Purpur, / purpurfarben seine Wunden, / folgt er dem Schatten eines leugnenden Mönchs / auf dem Weg zur Heiligen Weisheit."
Gab es in den alten Ringmauern der Stadt Byzanz tatsächlich ein Judasbaumtor? Und wenn ja, sind davon im heutigen Istanbul noch Überreste zu finden? Und wer mag der Mann gewesen sein, der durch das Tor schritt? Jesus? Judas?
Mit Teo wird der Leser zu einem Reisenden durch die Vergangenheit einer kulturgeschichtlich reichen Stadt, in der "die Seelen der Menschen und die Seelen der Räume miteinander verschmelzen". Die bedeutende Stadt auf den sieben Hügeln, die drei klingende Namen trug (Konstantinopel - Byzanz - Istanbul), fasziniert mit ihrer Jahrtausende alten Historie, ihrer multikulturellen Gesellschaft voller Gegensätze, ihren Geheimnissen und Legenden aus tausendundeiner Nacht.
Für zeitgemäße Spannung sorgt zudem, dass ausgerechnet der unpolitische Teo im Verlauf der Handlung in das Netz einer revolutionären "Organisation" gerät, für einen CIA-Agenten gehalten wird, liquidiert werden soll.
Bei einem Treffen mit einem türkischen Historiker lernt Teo die junge Derin kennen, die in Lausanne studiert. Die Zwanzigjährige ist die zweite Figur, die Oya Baydar aus ihrer Perspektive erzählen lässt. Auch sie führt eine Suche nach Istanbul. Ihr Vater Arin, ein türkischer Diplomat, wurde 1992 getötet - warum? Erstmals erfährt sie, dass sie einen Bruder hatte; der war 1997 zusammen mit zwei Kommilitonen in einer konspirativen Wohnung von den politischen Mächten aus dem Weg geräumt worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Morden?
Durch ihre Recherchen wird Derin in die politischen Wirren des Jahres 2000 hineingezogen, als die Kämpfe zwischen Machthabern und Terroristen eskalieren. Demonstrationen, Barrikaden, Hungerstreiks und Militäraktionen bewegen Tausende und fordern viele Todesopfer.
Derin lernt Kerim kennen, einen jungen Mann, der sich in sie verliebt und sie als Bourgeoise für die agitatorische "Organisation" gewinnen will. Angezogen vom Leben der Menschen auf der anderen Seite ebenso wie von den Kämpfen gegen das politische Regime, bezieht sie ein Haus in den Slums des Gecekondu-Viertels. Dort wird sie toleriert, aber dazu gehört sie nicht. Hautnah erlebt sie mit, was in den "Todeshäusern" vor sich geht, wo sich Menschen für die "Organisation" dem Hungerstreik angeschlossen haben: Dem heimtückischen Gemeinschaftszwang der "Organisation" erlegen, sterben Mütter, töten Henker ihre Opfer. Derin muss dem sinnlosen Treiben hilflos zuschauen, denn ihre Person und ihre Einstellung sind hier unerwünscht. Desillusioniert verlässt sie das Viertel, aus dem sie wenigstens einen kleinen verwaisten Jungen in ihre Welt hinüberretten kann.
Auf Drängen Derins kehrt die fünfzigjährige Ülkü, eine ehemalige Journalistin, nach Istanbul zurück. Sie führte das letzte Interview mit Arin, bevor er dem Attentat zum Opfer fiel. Doch Ülkü will gar nicht ernsthaft in ihrer Vergangenheit forschen. Als überzeugte Linke brach sie einst zu einem politischen Egotrip nach Moskau und Paris auf und ließ dafür ihren kleinen Sohn bei seiner Großmutter zurück. Der wurde später bei einer Polizeirazzia getötet. Sie weiß, dass sie nie Muttergefühle und Verantwortung für ihren Sohn übernommen hat. Trägt sie womöglich indirekt Schuld an seinem Tod?
Die vierte Perspektive - die Kerims - ist sicher die dichteste und bedrückendste. "Der Prinz der Slums" ist nicht nur aktives Mitglied der konspirativen "Organisation", sondern will in ihrer Hierarchie aufsteigen, und dafür muss man einen Preis zahlen, "einzelne Personen [...] opfern", denn "Macht [ist] ein schmutziges Geschäft". Dass es für Derin und Kerim keine gemeinsame Zukunft geben kann, ist beiden schnell klar. Kerim ist durchdrungen vom Hass auf die herrschende Ungerechtigkeit, auf das Ungleichgewicht der Gesellschaftsschichten. Derin aber steht zwischen beiden Welten; sie kann ihre Herkunft nicht ungeschehen machen.
Baydars Roman fesselt auf vielschichtige Weise. Die Autorin kann wunderbar erzählen; man versinkt förmlich in ihrem ästhetischen, warmen Sprachstil. Wer Istanbul schon einmal besucht hat, wird die Schauplätze der Handlung voller Wehmut und Sehnsucht wiedererkennen. Blumen, Bäume, Farben, Gerüche - überall werden unsere Sinne angesprochen.
Packend und emotional aufwühlend lesen sich die Handlungsstränge der vier Figuren. Sie kommen abwechselnd zu Wort, und doch muss man erst forschend ein bis zwei Seiten lesen, bis man den Ich-Erzähler ausmacht. Denn die Geschichten verweben sich ineinander, und manchmal erschließt sich erst aus der Ansicht des anderen eine individuell geprägte Variante des Geschehens.
Oya Baydars kritische politische Gesinnung tritt sehr deutlich zutage. "Dieses Land frisst seine Kinder, es schneidet sich die eigenen Finger ab." - diese Botschaft wiederholen ihre Figuren immer wieder. Bei aller einfließenden Kritik - vor allem an den Machenschaften des türkischen Staats von 1990 bis 2000 - trägt sie sie nie aufdringlich oder kategorisch vor. Sie möchte als Literatin, nicht als Agitatorin geschätzt werden. Daher der Vorrang der feinfühligen Charakteristik der Protagonisten , daher die Offenkundigkeit ihrer (in Teo repräsentierten) Liebe zur Kultur, zur Poesie. Und daher ist es nur folgerichtig, dass Oya Baydar für ihren Roman "Das Judasbaumtor" ("Erguvan Kapısı", 2004 erschienen und von Monika Demirel ins Deutsche übersetzt) eine der bedeutendsten türkischen Literaturauszeichnungen (den Cevdet-Kudret-Preis) erhalten hat.
 · Herkunft:
· Herkunft: