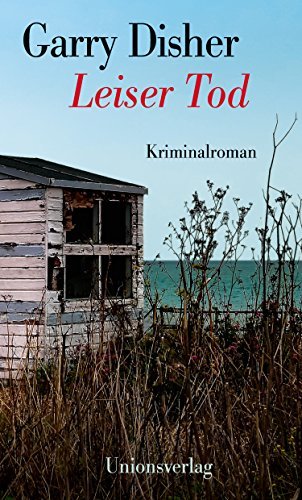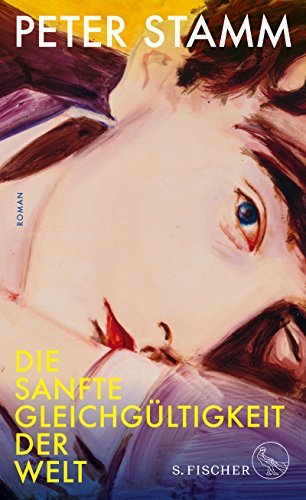
Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt
von Peter Stamm
Ein alternder Schriftsteller begegnet dem jugendlichen Abbild seines eigenen Lebens. Trifft der Doppelgänger damit seine eigene Zukunft? Ein Spiel mit Realität und Fiktion, Freiheit und Vorbestimmung.
Chance auf Reset?
Christophs Schriftstellerkarriere befindet sich im Leerlauf. Fünfzehn Jahre ist es her, dass sein erstes und einziges Buch erschien und genügend Aufmerksamkeit fand, um bis heute Publikum für Lesereisen anzulocken. Wie die Beziehung mit Magdalena, von der er in seinem Erstling erzählt, nach drei Jahren scheiterte, so sind auch Christophs künstlerische Ambitionen versandet. Die Erinnerungen an Magdalena begleiten den Fünfzigjährigen freilich unvermindert bis in seine Träume.
Nach einem Leseabend in seiner Heimatstadt widerfährt Christoph Frappierendes: Im Nachtportier des Hotels meint er sich selbst als jungen Mann zu erkennen. Die Doppelgängerschaft erweist sich als umfassend: Der junge Mann, Chris genannt, wohnt im selben Haus wie er einst, ist ebenfalls Schriftsteller, selbst seine Freundin Lena ähnelt der Magdalena von damals, und beide sind Schauspielerinnen.
Christoph ist gebannt und besorgt. Leben die beiden sein eigenes Leben nach wie eine Imitation? Oder hat er das ihre vorgelebt wie einen Probelauf? Beeinflusst, beschädigt oder bessert nun jeder Schritt das Schicksal der anderen?
In Stockholm verabredet sich Christoph (der Ich-Erzähler) mit der zwanzig Jahre jüngeren Lena und bietet ihr an: »Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen.« Er versteht das als Warnung. Natürlich ist Lena verblüfft, dass den älteren Herrn nichts, was sie ihm über sich und Chris berichtet, überrascht, dass ihm ihr Leben so vertraut scheint. Indem der Romancier an der Schwelle des Alters ihr seine Lebens- und seine gescheiterte Liebesgeschichte zu Magdalena offenlegt (»eine Geschichte über unsere Trennung und über die Unmöglichkeit der Liebe«), muss sie befürchten, dass auch die Entwicklung ihrer eigenen Beziehung mit Chris Element der Doppelexistenzialität sein und sie ihre Zukunft keineswegs so frei entfalten könne, wie sie glaubt. Was bliebe dann anderes übrig, als die »sanfte Gleichgültigkeit der Welt« zu ertragen, die uns Menschen unbeteiligt zuschaut, wie wir unsere Existenz zu gestalten trachten?
Auf einen Blick in ihre eigene Zukunft hoffend, drängt Lena, Christoph solle ihr enthüllen, wie denn alles ausgeht. Doch das ist ihm unmöglich. Im Leben, sagt er, gibt es keine Regeln wie in Geschichten. »Ein literarischer Text braucht eine Form, eine Folgerichtigkeit, die unser Leben nicht hat … Ein Ende haben Geschichten nur in Büchern.« Und »Glück macht keine guten Geschichten«.
All dies hat Christoph selbst erfahren. Magdalenas Rat, »ein Buch über dich und mich, über unser Leben, unsere Liebe« zu schreiben, half ihm zwar aus einer Schreibblockade, führte ihn aber in ein Dilemma. Je mehr er über Magdalena schrieb, desto vertrauter wurde ihm dieses literarische Geschöpf, während ihm sein reales Vorbild fremder wurde. Die Erkenntnis schreckt ihn, und er wird skeptisch gegenüber »großen Worten und Gefühlen, zweifelte nicht nur an jenen der anderen, sondern auch an meinen eigenen.«
Natürlich handelt es sich bei den Doppelungen nicht um platte Wiederholungen. Gerade die Brüche und Risse in den vermeintlichen Spiegelungen faszinieren und verunsichern die Protagonisten wie den Leser. Sie provozieren Fragen nach dem Wesen der eigenen Existenz, nach Vorbestimmung, Zufällen und Freiheit. Hätte Christoph mit dem Wissen, was alles geschehen wird, nach einem Reset in Gestalt Chris’, des jüngeren Ichs, andere Wege beschritten? Hätte das Leben eine andere Wendung genommen, wären sie sich nie begegnet? Verständlich, dass Lena sich sorgt, Christoph habe als Schriftsteller in »unser Leben« eingegriffen, rein »aus Neugier, um auszuprobieren, was dann geschieht«. Doch können sich die fiktionalen Akteure ihrer von Christoph vorgeschriebenen Rolle nicht entziehen, einfach anders agieren als erwartet? Im Übrigen existiert das fragliche Buch ja vielleicht gar nicht. »Wie soll dieses Buch noch mal heißen, das ich in ein paar Jahren schreiben werde und das Sie längst publiziert haben wollen?«, fragt Chris, als er Christoph trifft. Der Titel ist nirgendwo aufzutreiben und nicht einmal im Katalog der Zentralbibliothek aufgenommen. Am Ende steht die radikalste Frage: War alles nur Fiktion, hat Christophs Leben so gar nicht stattgefunden?
In seinem kleinen Roman – 155 luftige Seiten – manövriert Peter Stamm seine Figuren wie auf einem Schachbrett in ausgeklügelten Zügen hin und her. Sein raffiniertes Jonglieren mit Realitäten, Träumen und Fiktion, mit Gegenwart und Vergangenheit gewinnt an Tempo, Zeitebenen wechseln übergangslos und oft unbemerkt.
Wiewohl ästhetisch erfüllend, ist dieser schlicht und fedrig leicht formulierte, von schwereloser Melancholie durchwehte Künstlerroman nicht jedermanns Sache. Der Schwerpunkt liegt auf dem intellektuellen Reiz der philosophischen Fragestellungen, denen die arg artifizielle Gesamtkonstruktion und das im Kern phantastische Grundmotiv dienen.
Am Ende des Romans erinnert sich der Ich-Erzähler an ein Erlebnis als Zwanzigjähriger. Bei einem Spaziergang in seinem verschneiten Heimatdorf sieht er auf der anderen Seite des Flusses einen alten Herrn, der auf dem steil ansteigenden Weg gestürzt ist und ohne Hilfe nicht mehr aufstehen kann. Der junge Mann bringt den verwirrten Alten, der von einer Frau erzählt, »mit der er spazieren gegangen sei«, zurück ins Männerheim. Das Bild legt nahe, dass Anfang und Ende des Ich-Erzählers zusammenfließen. Denn der junge Mann hat bereits die Reife des Alters, und mit dem Greis verbindet ihn etwas, »was viel tiefer reicht als Worte, als würden wir eins, ein vierbeiniges Wesen, zugleich alt und jung, am Anfang und am Ende«. Noch ehe sein Leben richtig begonnen hat, stellt er sich sein Ende vor, »von allem befreit [...], ohne eine Spur zu hinterlassen«. Die Vorstellung stimmt ihn nicht traurig, sondern erscheint ihm »angemessen und von einer klaren Schönheit und Richtigkeit«.
Übrigens ist der Titel ein Zitat aus dem Essay »Der Mythos des Sisyphos« (1941) des Existentialisten und Nobelpreisträgers Albert Camus: »La tendre indifférence du monde«.
 · Herkunft:
· Herkunft: