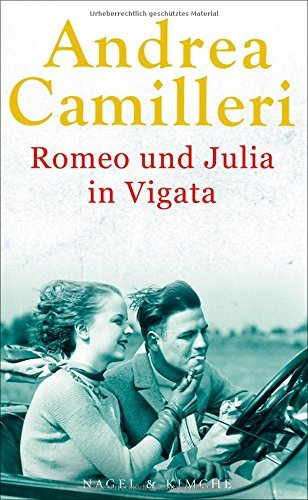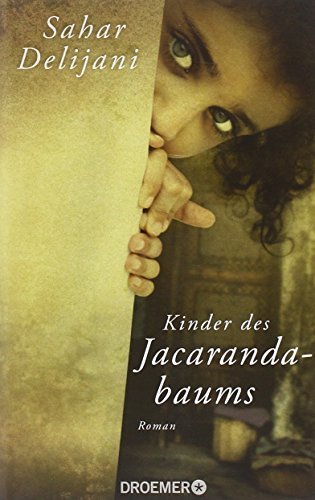Nachkriegsgewinnler
Waffenstillstand? Wirklich? Es ist der 2. November 1918, und die Soldaten in den Schützengräben können kaum glauben, dass, wie man munkelt, das Kriegsende kurz bevorsteht.
Waffenstillstand? Endlich! Soldat Albert Maillard will jetzt kein Risiko mehr eingehen, denn »als Letzter zu sterben ist, wie als Erster zu sterben: vollkommen idiotisch«. Also am besten aufs Marschgepäck hocken und die verbleibende Zeit absitzen.
Waffenstillstand? Mais non! Leutnant Henri d'Aulnay-Pradelle braucht unbedingt noch ein Scharmützel, um sich Orden und Beförderung zu erobern und als Held und Hauptmann in die Zivilisation zurückzukehren. Leider will niemand mehr mitscharmützeln im unbedeutenden Frontabschnitt 113, weder hier noch drüben bei den Deutschen. Der Hauptmann in spe muss nachhelfen – wenn nicht jetzt, wann dann? – und inszeniert eine spektakuläre Aktion. Zwei harmlose Späher ziehen los, um die Lage beim Feind zu erkunden, drei Schüsse legen sie um, laute Flüche gegen die »Schweine ... Boches, elendes Pack! Barbaren!« entfachen längst erkaltete Aggressionen neu, schon kreuzen Granaten wieder ihre Bahnen, und der Leutnant befiehlt den Angriff: Raus aus den Gräben!
Da muss auch der lustlose Albert mit. Im Zickzack schlägt er sich voran. Die Kugeln zischen. Kamerad Édouard Péricourt stürzt verletzt auf einen der toten Kundschafter. Albert robbt heran, um ihm zu helfen – und entdeckt zwei Einschüsse in der Späher-Leiche, genauer gesagt: in deren Rücken ...
Alberts tiefer Einblick kann Pradelle, der also über Leichen geht, um seine Schlacht zu provozieren, nur unliebsam sein. Der Noch-Leutnant stürmt auf Albert zu und befördert ihn durch einen gezielten Schubs in einen klaffenden Granattrichter, wo der lästig gewordene Untergebene vollständig im Morast versinkt. Eine Handgranate pulverisiert die beiden corpora delicti, eine zweite wirft er den Boches als »Abschiedsgeschenk« in den Schützengraben. Der geniale Handstreich über die Deutschen im Frontabschnitt 113 wird ihn zum Hauptmann machen.
Derweil glaubte Albert schon, »das Licht geht aus«, doch dann haucht ihm ein totes Pferd im Schlamm ganz unerwartet seinen Odem ein, bis Édouard ihn aus seinem vorzeitigen Grab befreit. Unglücklicherweise trifft den Retter beim Ausbuddeln ein Granatsplitter und reißt ihm die untere Gesichtshälfte davon.
Mit dieser makaber-zynischen Szene endet der Erste Weltkrieg in Pierre Lemaitres Roman »Wir sehen uns dort oben«. Aber die Party fängt jetzt erst richtig an; in der Nachkriegszeit entspinnt sich eine rabenschwarze Komödie von skrupellosen Geschäftemachern in einer reichlich korrumpierten Gesellschaft. Alle streben nach oben, wollen ihre gesellschaftliche Stellung verbessern, und das mit maximalem Profit. Dazu wird auf Teufel-komm-raus bestochen, betrogen, gelogen, nach unten getreten und ausgebeutet. Im Privaten gönnt man sich, ob Mann oder Frau, jegliche Sinnesfreude, geht hemmungslos fremd.
Nur zwei Menschen halten das Fähnchen aufrichtiger Menschlichkeit hoch: ein nettes kleines Mädchen namens Louise und ein Ministerialbeamter vor der Pensionierung, ein »Bürokrat auf der untersten Stufe, ohne Karriere, ohne Zukunft«, ungelitten in seiner Behörde.
Albert und Édouard müssen sich auf der Verliererseite durchschlagen. Édouard, einst gelangweilter Sohn reicher Pariser Bürger, leidet im Lazarett unter nicht enden wollenden Schmerzen und seinem grausam entstellten Antlitz. Albert pflegt ihn, flößt ihm flüssige Nahrung ein und beschafft ihm auf illegalem Wege jede Menge barmherziges Morphium. Operation und Prothese verweigert Édouard, und in die Öffentlichkeit oder zurück zu seiner Familie will er auch nicht. Vielmehr möchte er das Lazarett mit neuer Identität verlassen. Auch diese Aktion zieht Albert geschickt mit ihm durch. Obwohl all die kriminellen Vergehen schwer auf seinem schwachen Gemüt lasten, ist er sich der moralischen Verpflichtung gegenüber seinem Lebensretter bewusst.
In Paris beziehen die beiden eine ärmliche Ein-Raum-Wohnung in einem Hinterhof. Kriegsheimkehrer Albert findet keine Anstellung in seinem früheren Beruf als Buchhalter, so marschiert er nun als Plakatträger über die Flaniermeilen von Paris. Der Niedriglohn reicht kaum zum Überleben und schon gleich nicht für die Heroinmengen seines abhängigen Veteranenfreundes.
Einen Lichtblick ins trübe Leben bringt allein Louise, das elfjährige Töchterchen der Vermieterin. Ohne Scheu vor Édouards Fratze, seinem Gurren, dem Rauchen durch die Nase besucht sie ihn täglich, um mit ihm Masken zu basteln. Édouard lernt wieder lachen (Aber »wie sollte das gehen, wenn Édouard lachen musste?«, fragte sich Albert ...), fasst neuen Lebensmut, studiert aufmerksam die Zeitungen, die Louise mitbringt, und findet darin eine gloriose Idee. Als die Not wächst und Albert seine nächtlichen Panikattacken nur noch übersteht, wenn er den von Édouard gebastelten Pferdekopf aus Pappmaché in seinen Armen hält, stimmt schließlich auch Albert zu: Sie werden an einem landesweiten Wettbewerb teilnehmen, der »jede Stadt, jedes Dorf, jede Schule, sogar jeden Bahnhof« mit einem eigenen Kriegerdenkmal versorgt. Doch wenn die Nation ihren Toten teure Denkmäler setzen möchte, während sie ihre überlebenden Kriegshelden in ihrer Not im Stich lässt, werden sich Édouard und Albert eben rächen, alle abzocken, mit der erbeuteten Million Francs in die Kolonien abhauen. So realisieren sie ein Husarenstück mit Entwürfen für Statuen und Büsten und bei Vertragsabschluss verlockendem Rabatt bei Vorkasse. Allerdings ist eine Lieferung der Kunstwerke intern nicht vorgesehen ...
Derweil ist auch Hauptmann Henri d'Aulnay-Pradelle nicht untätig. Der »Landjunker vom verarmten Schlag«, ein wahrer »Kotzbrocken« und raffinierter »Drecksack«, ist der Prototyp des Nachkriegsgewinnlers. Sein erster Coup in Friedenszeiten: Eroberung einer Wohlstandsbasis durch Einheirat in eine gut situierte Bürgerfamilie. Eine Zufallsbegegnung hatte ihm den Weg geebnet, als Mademoiselle Madeleine Péricourt aus Paris ins Schlachtfeld angereist kam. Ein ihr unbekannter Soldat namens Albert Maillard hatte sie und ihren Vater brieflich in Kenntnis gesetzt, dass ihr Bruder Édouard im Lazarett seinen Verletzungen erlegen sei. Nun war sie gekommen, um seine sterblichen Überreste in die Familiengruft nach Paris überführen zu lassen. Für Pradelle, im Verschachern nicht unerfahren, eröffnet sich neben der Tür zur Ehe ein imposantes Tor zu einem gewaltigen Geschäftsmodell: Alle Familien wollen ja ihre Toten zurück, der Staat zentrale Ehrenfriedhöfe einrichten, und Pradelle, auch mit Leichen nicht unerfahren, wird sie liefern. Sein zweiter Coup: Chinesen exhumieren die Körper (ob französisch oder deutsch – tot sind alle gleich), machen zu große irdische Hüllen passend, stellen herrenlose Einzelteile zu Mischindividuen zusammen, während Pradelle sich um die Minimierung der Sarggrößen und -preise sowie die Maximierung der Quote durch gelegentliche Erdbefüllung kümmert.
Pradelles dritter Coup folgt auf dem Fuße. Der neureiche Altadlige will nun auch den gesellschaftlichen Status erobern, der ihm vermeintlich zusteht. Schachzug 1: Bewerbung um die Mitgliedschaft im feinen »Jockey Club«. Mit Bedenken wird der Kandidat aufgenommen. Zwar ist der Kerl vulgär, aber doch von Adel, mit Beziehungen, dazu ansehnlich, wenn er im arroganten Stechschritt durch die Räume stakst, ein erfreulich unversehrter Held. Schachzug 2: Demütigung der verlogenen, hohlen, aufgeblasenen Herrschaften. Erst dann wäre er endgültig arriviert. Für den Traum, sich in feiner Umgebung mal »so richtig gehenzulassen und derb vom Leder zu ziehen«, »sich vulgär auszudrücken«, fehlen Pradelle allerdings noch ein paar Millionen.
Obgleich Autor Pierre Lemaitre darauf verweist, dass Henri d'Aulnay-Pradelles bitterböses Schelmenstück frei erfunden sei, muss es nicht ohne reales Vorbild auskommen. 1920 deckte die französische Presse einen »Skandal um Militärexhumierungen« auf. Darum herum verwebt Lemaitre seine spannenden Erzählfäden mit Akteuren, deren kriminelle Energie sich ungebremst entlädt. Der Roman unterhält mit unerwarteten Volten und Situationskomik, vor allem aber mit satirischem Humor, bei dem einem nicht selten die Luft zum Lachen wegbleibt wie Albert in der Grube. Mit einem fulminanten, skurrilen Schluss, der die beiden großen Handlungsstränge zusammenführt, endet der Roman im Juli 1920.
»Au revoir là-haut«  wurde 2013 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Pierre Lemaitres bissige Gesellschaftssatire, die Antje Peter übersetzt hat, stellt die Bourgeoisie ebenso bloß, wie sie vaterländisches Heldengetue entlarvt. Offiziell werden hehre ideelle Werte propagiert, doch sowie Macht und Geld ins Spiel kommen, fällt jegliche Moral durch den Rost. Lemaitre hat die stolze Siegernation Frankreich im Visier, doch über die historische Bande trifft seine spitze Feder auch die enthemmten Machenschaften unserer heutigen neoliberalen Wirtschaftswelt und gewinnt dadurch weitere Relevanz.
wurde 2013 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Pierre Lemaitres bissige Gesellschaftssatire, die Antje Peter übersetzt hat, stellt die Bourgeoisie ebenso bloß, wie sie vaterländisches Heldengetue entlarvt. Offiziell werden hehre ideelle Werte propagiert, doch sowie Macht und Geld ins Spiel kommen, fällt jegliche Moral durch den Rost. Lemaitre hat die stolze Siegernation Frankreich im Visier, doch über die historische Bande trifft seine spitze Feder auch die enthemmten Machenschaften unserer heutigen neoliberalen Wirtschaftswelt und gewinnt dadurch weitere Relevanz.
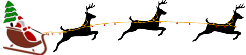 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: