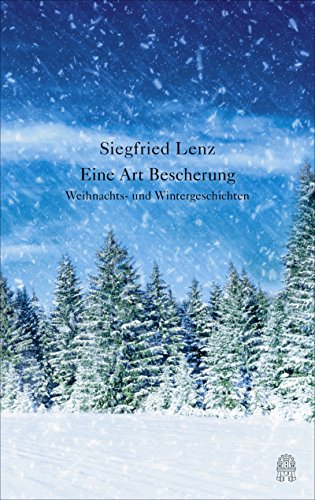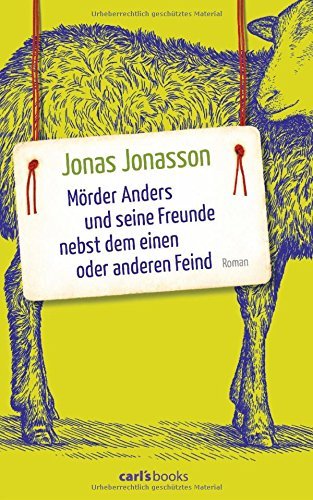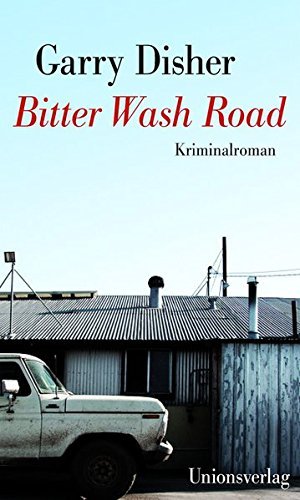Aus einer anderen Zeit
Sechs Jahre ist es her, dass der elende Krieg zu Ende ging. Walter Proska, damals Obergrenadier, hat die letzten Tage des Kriegssommers an der Ostfront überlebt. Jetzt will er einen Brief an seine Schwester Maria abschicken.
Beim alten Ortsapotheker Adomeit will er sich zwei Briefmarken borgen. Als der schwerhörige Greis nicht öffnet, tritt Proska ins Haus. Er findet Adomeit, wie er sich eine Spritze setzt. Sie soll ihm helfen, die Erinnerungen zu schultern, die schon seit dem Weltkrieg – dem ersten – auf ihm lasten. »Schwer wie Zuckersäcke« trägt er an den vielen Toten, speziell dem einen, den er aus dem Hinterhalt erschossen hat.
Auch Proska quält die Vergangenheit. Was er Maria mitzuteilen hat, wird alles zwischen ihnen verändern. Mag sie ihn verfluchen, ihn anzeigen – er ist auf alles gefasst.
In diesen kleinen Rahmen hat Siegfried Lenz die Haupthandlung seines zweiten Romans »Der Überläufer« eingebettet. Schon mit seinem erfolgreichen Erstling »Es waren Habichte in der Luft« hatte sich der Ostpreuße Lenz (*1926) in der soeben gegründeten Bundesrepublik als vielversprechendes schriftstellerisches Talent vorgestellt. Doch mit dem neuen Manuskript konnte sich sein Lektor gar nicht anfreunden. Otto Görner schlug Änderungen vor, denen Lenz anfänglich folgte, die er jedoch nicht mehr umsetzen mochte, als es ans Grundsätzliche ging. So blieb das Werk in seinem Schreibtisch verschlossen, bis es im Nachlass aufgefunden und jetzt, mit 65 Jahren Verspätung, von Hoffmann und Campe veröffentlicht wurde. (Das ausführliche Nachwort rekonstruiert die Vorgänge präzise.)
Was mag Görner bewogen haben, einen Roman ins Abseits zu schieben, der vielleicht ein Verkaufsschlager wie sein Vorgänger hätte werden können? Aus heutiger Sicht ist das schwer nachzuvollziehen..
Auf dem Rückweg vom Heimaturlaub in Lyck (Masuren) zur Ostfront verhilft Proska einer hübschen jungen Polin zur (strengstens verbotenen) Mitfahrt im Zug und verliebt sich in sie. Wanda (der er den Kosenamen »Eichhörnchen« gibt) ist eine Partisanin, die beim nächsten Kontrollhalt wieder in den Sümpfen verschwindet.
In der Nacht attackieren Partisanen den Zug, doch Proska überlebt den heimtückischen Angriff. Mit einem Kameraden macht er sich auf den lebensgefährlichen Weg zu einer anderen versprengten deutschen Einheit. Die Sommerhitze und Myriaden von Mücken machen die Tage unerträglich, und immer wieder kommt es zu Gefechten mit zivilen Widerständlern. Dabei macht er ganz neue Erfahrungen im Umgang mit dem Feind, und die Sinnlosigkeit ihres Krieges dringt unaufhaltsam ins Bewusstsein der Männer.
Schließlich erreicht man die »Festung Waldesruh«. Die Anlage ist ein Hort der Absurdität. Aufgehäufte Grasfladen sollen die aus Holzbohlen errichteten Wände schützen. Die bloße Witterung hat ihren Namenszug zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die verbliebene Rest-Kampftruppe ist ausgemergelt, von traumatischen Erlebnissen gezeichnet, von immerwährender Angst gepeinigt, in den Wahn getrieben. Die Männer sind auf Tuchfühlung umgeben von einer feindlichen Zivilbevölkerung, die insgeheim brutalste Widerstandsaktionen ausheckt. Jeder harmlose Passant kann Dynamit in der Jacke tragen.
In der Miniatur dieses Schauplatzes schildert Lenz den Krieg als Tollhaus. Proska erlebt irrwitzige Befehle, hirnloses Gehorchen, überdrehte Aktionen, nervliche Koller, erschreckende Verrohung, perfides Töten. Das Kommando führt der unerschütterliche, versoffene und verdrießliche Korporal Willi Stehauf. Der ist abgebrüht genug, um einen ernsten alten Pfarrer zu verhöhnen und anschließend hinterrücks zu erschießen. Seine Männer drangsaliert er mit markigen Worten und bissigem Zynismus. »Schneller, schneller!«, treibt er sie beim Gräberausheben an. »Diese Gegend ist kein Kühlschrank für altes Fleisch.«
Stehaufs bevorzugtes Opfer ist Wolfgang Kürschner, genannt »Milchbrötchen«, ein verträumt wirkender junger »Überschlauer« mit Magenleiden, der gern über Politik, den Krieg und den Tod nachsinnt. Wenn er mit Proska auf Patrouille geht, lässt er ihn wissen, was er denkt. Es sind Ansichten, die noch Jahre nach Kriegsende den meisten Deutschen ebenso missfielen wie dem Lektor Görner.
»Was hast du davon, wenn du ärgerst Elefant?«, fragt ein Kamerad und meint: Wozu überhaupt noch schießen angesichts einer erdrückenden Überzahl schwer bewaffneter Partisanen ringsum? Was wir heute als nüchterne Lageeinschätzung akzeptieren, um daraus pragmatische Handlungsoptionen zu entwickeln, war zu Zeiten der Durchhalteparolen als undenkbar gebrandmarkt, ein subversiver Gedanke, der nach Feigheit, Verrat und Desertion schmeckt.
»Milchbrötchens« grundsätzlichere Analyse, der Bruch mit der unmittelbaren Vergangenheit und die politischen Konsequenzen, die er daraus zieht, sind für Proska unerhörtes Neuland. Auf konservative Nachkriegskreise müssen sie als reine Provokation gewirkt haben, so augenfällig uns manche Aussage heute erscheinen mag. Werte wie »Pflicht«, »Gehorsam«, »Nationalbewusstsein« seien keineswegs heilig und ewig, sondern als »rhetorisches Sickergift« systematisch eingeimpft worden; »sie haben uns irre, unselbständig gemacht.« Es sei »doch eine komplette Idiotie, wenn wir uns, die wir Deutschland sind, für Deutschland, also für uns selbst, opferten.« In der Zukunft »müssen [wir] zu einer Form des aktiven Pazifismus kommen«: eine radikale Position mitten in der äußerst kontrovers geführten Wiederbewaffnungsdiskussion der erst zwei Jahre alten Adenauer-Ära ...
Als »Milchbrötchen« den Wahnsinn der »Festung Waldesruh« nicht länger ertragen kann, setzt er sich zur Gegenseite ab – es sind ja nur ein paar Schritte, und es ist ein Kinderspiel, den Kontakt mit den Kameraden aufrechtzuerhalten. Auch Proska schaut sich bei den Partisanen um, findet dort sein »Eichhörnchen« wieder, verbringt mit ihr liebevolle Stunden, die die Zeit vergessen lassen und große Versprechen zeugen. Schließlich wechselt auch er die Seiten. Er sagt, er wolle mithelfen, »die Klicke aus der Welt [zu] schaffen«.
Ein politisch Überzeugter ist der bis dahin standhafte Soldat Walter Proska nicht. Den wahren Überläufer »Milchbrötchen« beschimpfte er noch als Verräter (»Judas«). Proska ziehen die persönlichen Bindungen zu Wanda und »Milchbrötchen« hinüber ins andere Lager; er ist eher ein Nach- und Mitläufer.
Auf der anderen Seite werden die Überläufer keineswegs mit offenen Armen empfangen. Strategisch spielen die beiden keine Rolle, im Prinzip sind sie immer noch Feinde, die man, sobald sie nicht kuschen, formlos erschießen kann, und auch ihre Moral sieht man kritisch: »Sobald ihr besiegt seid, wollt ihr Brüder sein. [...] Erst wenn ihr Gnade braucht[...], dann redet ihr von Brüderlichkeit«. Proska schämt sich.
Die letzten Wintergefechte sind eher Scharmützel als Schlachten. Proska und »Milchbrötchen« kämpfen ziemlich auf sich allein gestellt in Gräben um Höfe und Scheunen. Jetzt ist Proska allerdings »auf der Seite der Gerechten« und richtet sein Gewehr auf die letzten ehemaligen Kameraden.
Nach dem Krieg befindet sich Proska im Osten Deutschlands, wo die Sowjetunion einen sozialistischen Staat zu installieren beginnt. »Die Notwendigkeit zu kämpfen [...] ist nicht vorbei. Innerhalb der sozialistischen Gesellschaft gibt es keinen Stillstand.« Proska erhält einen Büro-Arbeitsplatz. Doch schnell beschleicht ihn ein Unwohlsein. Warum kommen und gehen ständig neue Kollegen? Briefe werden abgefangen, Menschen überwacht, es gibt Verhaftungen. Wieder strebt ein staatliches System nach Allmacht und rechtfertigt Unterdrückung als Mittel zur Durchsetzung einer »Revolution«. Proska besteigt einen Zug und läuft erneut über, in den Westen. In einem Brief gesteht er seiner Schwester im Osten, welche Schuld er auf seinen Wegen auf sich geladen hat. Dann muss er nur noch zwei Briefmarken organisieren ...
Ob »Der Überläufer« so viele Jahre nach seiner Entstehung noch das Zeug dazu hat, sich als verspäteter Nachkriegsklassiker zu etablieren und zu anderen Werken der »Trümmerliteratur« (etwa von Andersch, Borchard und Böll) aufzuschließen, bezweifle ich. Obwohl die Sprache meisterlich schön, die Antikriegsthematik zeitlos und erzählerisch reizvoll gestaltet ist, wirkt der Roman nicht ganz aus einem Guss – wohl in Folge der abgebrochenen Überarbeitung. Der erste Teil – bis zu Proskas Seitenwechsel – ist voller spannender und grotesker Szenen, bei denen das Lachen im Halse erfriert. Dagegen fehlt es im zweiten Teil bisweilen an Klarheit und sprachlichem Nachdruck der Aussage. Lenz' beste Bücher (»Deutschstunde«, »So zärtlich war Suleyken«) setzen sich durch ein entscheidendes Quäntchen an literarischer Kraft und Konsequenz von diesem Frühwerk ab.
Lesen sollte man diesen Roman aber trotzdem unbedingt. Seine Themen, seine Botschaft, seine Machart, seine Ehrlichkeit und seine ungewöhnliche Genese rühren auf eigenartige Weise. Ironischerweise wirkt er jetzt, wo er erschienen ist, nicht viel weniger aus der Zeit gefallen als 1951, als Siegfried Lenz ihn seinem Verlag (schon damals Hoffmann und Campe) vorlegte. Damals war die Zeit noch nicht reif für das Buch, heute hat sie es hinter sich gelassen. Was es an Kriegsschrecken, Skurrilitäten, Leid, Zynismen und Einstellungen präsentiert und 1951 bei vielen Empörung ausgelöst hätte, gehört inzwischen, tausendfach und multimedial überboten, zu unserem Alltag.
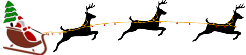 Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
Bücher und Musik für Advent und Weihnacht
 · Herkunft:
· Herkunft: